

Die Arbeit zeigt das Areal rund um den Rosa-Luxemburg-Platz als Schauplatz eines utopischen Szenarios. Das Modell gibt den gegenwärtigen baulichen Bestand wieder, an vielen Stellen ergänzt, an anderen ausgedünnt. Unterschiedliche Themen gesellschaftlicher und politischer Gegenwart haben ihren Einfluss auf die entstandene Form: Gentrifizierung, Ghettoisierung, Autonomisierung, Klimawandel, Kapitalismuskritik, Rekonstruktionswut oder die Krise der Repräsentation manifestieren sich anekdotenhaft innerhalb eines geschlossenen Systems.
NO FUTURE – A MASTERPLAN beschreibt die Schwierigkeit bei der Suche nach Formen umfassender gesellschaftlicher Alternativen, erzählt von der Reibung zwischen Entwicklung und Kontrolle.

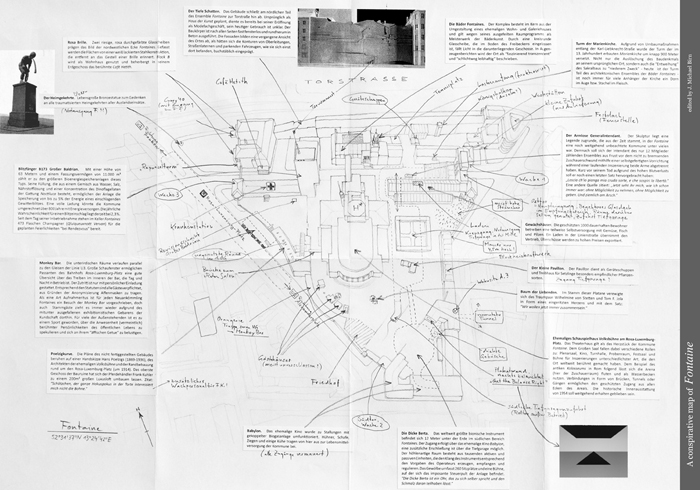

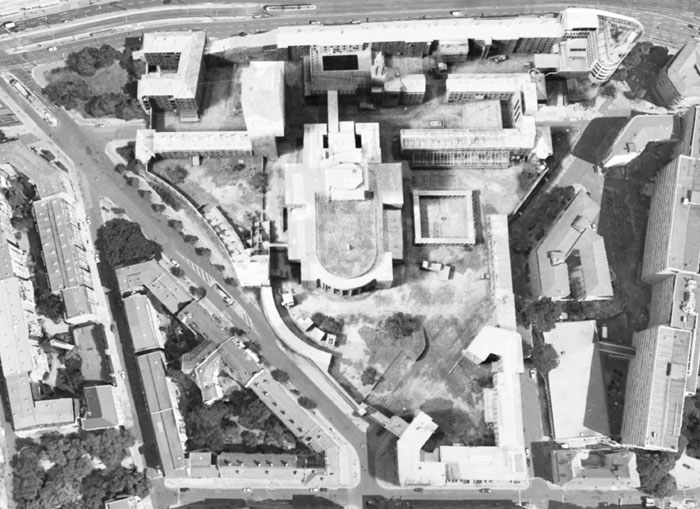

Alle Rechte an Text und Bild liegen beim Autor.
Warum nicht? Wenn du es dir leisten kannst: Fülle eine Baulücke mit gutem Geschmack. Bodentiefe Fenster, Fußbodenheizung, ebenerdige Dusche, Sichtbetonwände in Kontrast mit antiken Möbeln, aber auch Designklassikern.
Sich nackt vor den Kamin legen. Oder auf der Dachterrasse das Olivenbäumchen in den Windschatten schieben.
In der Abendsonne Aperol Spritz trinken und den Blick über die Stadtlandschaft schweifen lassen. Von ganz weit oben.
Bachkantaten hören und in einem Kunstband blättern.
Endlich raus aus der Mietwohnung, alles hinter sich lassen, das Klein Klein von Straßenlärm, Nachbarn und unerwünschter Post.
Teil der neuen Zone werden. Zu den anderen kommen. Mitmachen. Einen Bart tragen. Einen Hund haben. Range Rover fahren. Aus Berlin Mitte nach Berlin Oben. Mitte ist sowieso tot. Wachsfiguren und Leichen, Mittelaltergruften und Fische.
Die alten Bonzen bauten ein Forum und nannten es Palast, die neuen bauen ein Schloss und nennen es Forum.
Wir sind New York. Jeder Tag baut ein neues Haus. Jeder Tag dämmt ein altes. Wegen der Energieeffizienz. Styropor rettet den Planeten.
Ja, es gibt noch begehbare Orte, Ecken in denen sich das Leben versteckt, so wie kühle Luft in einer Hofeinfahrt, an einem heißen Sommertag. Aber nicht mehr lange. Ja, Veränderung tut weh. Wir werden nicht mehr zusammen alt, wir werden nur noch alt.
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
--
Wer in das gerade erschienene Buch „Die Kunst und das schöne Leben“ von Hanno Rautenberg schaut, kann nur darüber erschrecken, wieweit die Verquickung von Markt und Bildender Kunst bereits fortgeschritten ist. Mit Vokabeln wie Refeudalisierung, Postautonomie, Auftragskunst wird die aktuelle Lage beschrieben, die Georg Seeßlen und Markus Metz bereits mit „Geld frißt Kunst, Kunst frißt Geld“ auf eine eingängige Formel brachten.
In den Niederlanden – schreibt mir Anna Seidl aus Amsterdam – fordert der vor ein paar Tagen veröffentlichte neue Kulturplan 2017/20 das Ende der l'art pour l'art, um vom Beginn einer neuen Ära des l'art pour l'homme zu künden. Auch wenn mir kein holländischer Schlingensief bekannt ist, Tatsache ist, dass das Ende der Autonomie der Kunst mit deren Ökonomisierung Hand in Hand geht. Eine Entwicklung, die freiwillig auch vor dem Theater in Deutschland nicht Halt machen wird. Falls sich die Bühnen nicht wehren, werden über kurz oder lang jene Formen zur Strecke gebracht, die mit einer „marktgerechten Demokratie“ (Merkel), pardon mit einer marktkonformen Kunst nicht kompatibel erscheinen.
In diesem Zusammenhang erinnerte ich mich an ein Statement Friedrich Kittlers, der mich vor ein paar Jahren mit der These überraschte, das Wahrheit immer auch Resultat von Kämpfen ist, ja ausgefochten sein will. Die Sieger schreiben nicht nur Geschichte sondern, wie bei Walter Benjamin zu lernen, auch Kunstgeschichte. Je nach Blickwinkel zeigt sich das subventionierte Theater als eine lauschige Blase in einem ansonsten zunehmend kapitalisierten Regime oder als Ausdruck eines eminent konflikthaften Seins. Die Realität, von der Aischylos, Shakespeare oder Kleist erzählen, ist zutiefst von Kollisionen mit zumeist tödlichem Ausgang zersprengt. Sie bringen jene „zona torrida“, jene eruptive Zone der Weißglut in die Sichtbarkeit, die Johann Wolfgang von Goethe als zukunftsgeschwängerter Stürmer und Dränger am 14. Oktober 1771 in seiner Rede zum ersten deutschen Shakespeare-Tag beschwört, wo, wie Friedrich Wilhelm Schelling postuliert, die „Helden gegen die Übermacht des Schicksals kämpfen“ und die Revolte gegen die Determination ihr Zuhause hat. Heiner Müller entnimmt ihr sein Bekenntnis zur Kollision, sein Credo als Dramatiker: „Ich glaube an Konflikt. Sonst glaube ich an nichts.“ Die Rede ist von jenem „Struggle“, jenem Kampf, den Karl Marx anführt, um die Frage eines amerikanischen Journalisten: „Was ist?“ zu beantworten. Ihre ontologischen Wurzeln reichen zurück in jenen Wahnsinn, aus dem die tragische wie die komische Kunst erwuchs, die „Kunst des dionysischen Wahnsinns“, wie wohl nur Friedrich Nietzsche schreiben kann.
Dieses vom Wahnsinn beatmete antagonistische Spannungsfeld ist zugleich Heimat wie Utopie innerhalb einer zusehends befriedeten Konsensgesellschaft, gegen deren Außenmauern immer höhere Wellen von Blut schwappen. Angesichts seiner enormen Ressourcen an Konfliktpotential stellt sich die Frage, wie das Theater seine gigantischen Vorräte an Zusammenstößen und Unfällen verschiedenster Couleur in zeitnahe gesellschaftliche Kämpfe einbringen kann, bevor es selber entkernt und zum Verschwinden gebracht bzw. in künftigen neoliberalen Durchlauferhitzern zerkocht wird. Eine Frage, die sich mit Blick auf seine Geschichte, heute drängender als je stellt.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Man kann sagen, dass das Denken – ob es sich um Philosophie, Kunst oder Wissenschaft handelt – auf das Nichts antwortet. Das „Nichts“, das heisst: Die Inkonsistenz des Seins selbst wie alles Seienden. Alles, was ist, ist bereits von ihm heimgesucht. Nichts ist ohne „Nichts“. Wenn es eine allgemeine Erfahrung des Denkens gibt – dort, wo es an die Spitze der Realitäten rührt, an ihren extremen Punkt, an dem sie sich gegen sich selber wenden, sich implizit verneinen und bedrohen –, dann ist es die einer ontisch-ontologischen Auflösung. Das aber bedeutet, dass mit diesen Realitäten, deren Inkonsistenzpunkt Jacques Lacan das Reale nennt, das Denken selbst und mit ihm das Subjekt auf die Spur des Nichts gesetzt sind. Denkend folgt das Subjekt einer Fährte, die es mit der Prekarität seiner selbst wie seines Realitätszusammenhangs vertraut macht. So bestätigt es sich – um es mit Blanchot zu sagen, der sich wiederum auf Rilke bezieht – als „Vertrautheit mit dem Nicht-Vertrauten“. Das ist die elementarste Erfahrung, die es machen kann und tatsächlich macht: Die Auflösung seiner Konsistenzen, das Unheimlichwerden des Vertrauten, die Verdunkelung seiner Evidenzen, die Implosion seiner Welt. Jean-Luc Nancy hat es einmal so gesagt: dass „das Denken immer mit der einen oder anderen Form eines 'Nichts' zu tun“ habe, „eben dort, wo man meist und allzu leichtfertig glaubt, es mit etwas zu tun zu haben, das gegeben und verfügbar ist und worauf man sich stützen könne, wie etwa eine 'Natur', eine 'Authentizität' beziehungsweise 'Eigentlichkeit', oder 'Werte'.“ Nichts von alldem, das nicht bereits nichts wäre. Wenn wir Nihilismus nennen, was das Nichts ins Seinskalkül einbezieht, dann gibt es im Denken keine Alternative zum Nihilismus. Dabei geht es nicht darum, zu behaupten, es gäbe nichts. Der Nihilismus stellt das Subjekt lediglich vor die Tatsache, dass es sich in einer Inkonsistenzzone bewegt, die letzter Bedeutung entbehrt. Das Subjekt schwimmt in der Kontingenz. Was es als Boden und Grund unter seinen Füssen wahrnimmt, ist ohne Verankerung in einem konsistenten Element. Wir können uns Denken daher nur als ein Schwimmen vorstellen: Selbst flüssige Bewegung in flüssiger Materie, die das Subjekt zu verflüssigen droht.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Immer mehr Menschen setzen sich weltweit aktiv dafür ein, dass ihr Recht auf Gemeingüter, also Commons, anerkannt wird. Dabei kann es um so unterschiedliche Lebensgrundlagen gehen wie Wasser oder Energie, Medikamente oder Netzwerke, aber eben auch Räume oder Werke der Kultur, der Kunst. Doch was bedeutet Recht in diesem Zusammenhang? Geht es um ein Recht, das ein Staat oder ein Souverän gewährt? Oder geht es um etwas, was organisch entsteht, wenn Gemeinschaften für etwas kämpfen? Ich glaube, letzteres stimmt. Doch wie können wir dann über ein Recht auf Commons sprechen?Wir können nicht erwarten, dass dieses Recht uns jemals von denjenigen, die die ökonomische oder politische Macht innehaben, gewährt wird. Denn das Ideal des Commons – horizontale Machtverteilung, Graswurzel-Demokratie, nachhaltige Reziprozität, Entscheidungsfindung auf der Community-Ebene und radikale Autonomie – steht der Organisationsform Staat und dem Regime der Souveränität als „Gefäß“ für die Rechte, wie wir sie uns bislang vorstellen, diametral entgegen. Jedes „Recht auf Commons“ muss also notwendigerweise ein aufständisches Recht sein, eine radikale Forderung, die darauf abzielt, die Souveränität des Staates zu unterminieren und zu ersetzen.
An dieser Stelle ist es unumgänglich, eine kritische und analytische Unterscheidung zu treffen (die allzuoft vermieden wird) zwischen dem Begriff der Öffentlichkeit auf der einen Seite und des Commons auf der anderen. Sie sind nicht das gleiche, auch wenn es Überschneidungen gibt. Man kann öffentliche Parks, öffentliche Rundfunkanstalten oder einen Begriff von öffentlichem Interesse haben, die keine Commons sind. Der Staat kann dazu gezwungen werden, im Interesse der Öffentlichkeit zu handeln (zum Beispiel indem er öffentliche Dienstleistungen erbringt wie Gesundheitsfürsorge oder Bildung), aber das heißt nicht, dass diese automatisch Commons sind.
Commons impliziert und erfordert Graswurzelorganisation, Teilnahme und Gleichberechtigung untereinander. Wenn wir diese Unterscheidung nicht machen, geht die politische Wirkung und das Versprechen von Commons verloren.
Ich stimme mit dem marxistischen Historiker Peter Linebaugh und anderen darin überein, dass „common“ eher als Verb gedacht werden sollte, als als Nomen. Es ist eher etwas, das wir tun, als etwas, das wir besitzen. Wenn das stimmt, dann ist das Recht auf Commons in Wirklichkeit ein Kampf darum. Wir sprechen hier über Recht im doppelten Sinn des Wortes: als legaler Rechtsanspruch und als etwas, was „recht“ ist – richtig oder rechtschaffen. In diesem Sinne ist das Recht auf Commons die Pflicht, das Commons herzustellen und zu erneuern, es zurückzufordern und neu zu erfinden.
*
Um noch einmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Ich halte es tatsächlich für ein Problem, Commons als Recht zu deklarieren. Wir riskieren, die Idee des Rechts auf Commons dem Staat zu ausliefern, wenn wir nicht darauf bestehen, dass a) ein Recht immer von unten gefordert und verteidigt und nie von oben gewährt und geschützt wird, und b) dass Commons ein Prozess ist.
Ich bin daher nicht übermäßig begeistert davon, Commons als ein Recht zu deklarieren. Adorno hat sinngemäß gesagt, dass sobald man das Wort „Kultur“ sagen kann, man tatsächlich von Verwaltung redet. Das bedeutet in anderen Worten, sobald das Konzept von „Kultur“ als solches linguistische Autonomie erlangt, ist seine wirkliche Autonomie verloren. Wir könnten also ein Recht auf Commons benennen, aber die Sorge, dass sobald Commons als Recht artikuliert wird, sein radikaler Charakter verloren geht, bleibt.
Ein Beispiel: Die Idee eines Commons ist heute in der nordamerikanischen Stadtplanung und Architektur weitgehend anerkannt. Der Begriff wird meist dafür benutzt, um euphemistisch neuen Formen von halb-privatisierten Räumen einen Anschein von Öffentlichkeit zu geben. Zum Beispiel kann ein Bauunternehmer, der ein Bürohochhaus für ein Großunternehmen bauen möchte, einen Ort zur Verfügung stellen, an dem eine vorgebliche Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, zusammenzukommen, zu interagieren, zu spielen, was auch immer. Dieses hohle Commons wird mit allen Commons-korrekten Vokabeln gerechtfertigt und verkauft: Uns wird gesagt, dass es ein Ort des Bürgerdialogs sei oder des lokalen Engagements, des Gesprächs und der Gemeinschaft. In Wirklichkeit wird es eine in höchstem Maße überwachte, tote Zone sein. Auf die gleiche Weise nennen zahlreiche der Universitäten in Nordamerika, die zunehmend von Unternehmen gefördert werden, ihre kommerzialisierten Caféterien, Mensen und Bibliotheksfoyers „Lern-Commons“, um die Tatsache zu verschleiern, dass es sich um wenig mehr als bessere Einkaufszentren handelt.
Deshalb schlage ich vor, das Recht auf Commons nicht als ein Recht zu verstehen, das von oben gewährt wird, sondern als ein Bekenntnis zu einem Prozess von unten. Unser Recht auf Commons ist kein allgemeingültiger Begriff, sondern ein Versprechen, das wir uns selbst geben, dass wir die Arbeit des „Commons-Machens“ übernehmen – nämlich eine Gesellschaft aufzubauen, die eher dem entspricht, was Marx das „Gattungswesen“ des Menschen genannt hat. Damit meint er, dass wir als Gattung Mensch erfindungsreich und kooperativ sind. Das Commons ist für mich die gerechte und ethische Weise, dieses Gattungswesen auszudrücken und auszugestalten.
*
Der Prozess, in dem das Recht auf Commons verhandelt, abgewogen und festgelegt wird, ist eigentlich ein Teil des Prozesses, wie Commons an sich geschaffen und zurückerobert wird: Er existiert nur im Kampf, im immanenten Werden. Es hilft uns aber zu sehen, dass unsere Anstrengungen vor Ort Teil einer globalen Bewegung mit einem gemeinsamen Ziel sind.
Nicht, dass wir uns missverstehen: Ich glaube schon, dass wir an einem bestimmten Punkt der Macht des Kapitals und des Staates direkt entgegentreten und sie stürzen müssen. Der Prozess, in dem wir das Recht auf Commons verhandeln, abwägen und festlegen, muss letztendlich danach beurteilt werden, ob er uns in Bezug auf diese Konfrontation in die Richtung eines Ortes der Kraft bewegt. Jede Veränderung der Macht muss in einer revolutionären Veränderung des Alltags begründet werden, um die Gemeinschaft, Autonomie, wirtschaftliche Unabhängigkeit und Basisdemokratie wieder aufzubauen – genau das ist das Commons.
Es gibt den tröstlichen Mythos, dass wir, wenn wir Commons autonom von unten organisieren und unsere Abhängigkeit vom Staat und vom Kapital beenden, eine neue Welt auf den Ruinen der alten aufbauen und die Machthabenden ohne Tränen besiegen können. Möglicherweise kann Commons einfach ohne Widerstand aus dem etablierten System erwachsen und es überwinden. Aber ich bin skeptisch, was das angeht. In der Praxis schaffen Menschen ein gemeinschaftliches Gut nicht aus gutem Willen und schönen Ideen (auch wenn diese auf einer bestimmten Ebene notwendig sind), sondern aus dem Kampf für etwas und aus einem Bedürfnis. Commons entsteht, wenn wir versuchen, Kraft, Solidarität, Autonomie und Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Dieses Bedürfnis setzt eine Konfrontation mit der Macht voraus, auf die eine oder andere Weise.
Dieser Beitrag entstand auf der Basis eines Interviews, das die Berliner Gazette Redaktion mit Max Haiven (maxhaiven.com) führte; eine ungekürzte Fassung erscheint in der Berliner Gazette im Rahmen des Jahresschwerpunkts UN|COMMONS (http://berlinergazette.de/feuilleton/jahresthemen/2015-uncommons/).
Max Haiven ist Juniorprofessor an der Abteilung für Art History und Critical Studies der Nova Scotia College of Art and Design, Kanada. Zuletzt erschienen von ihm die Bücher Crises of Imagination, Crises of Power (2014), The Radical Imagination (with Alex Khasnabish, 2014) und Cultures of Financialization (2014).
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Alle Rechte an den Bildern liegen bei der Autorin.
Theater ist Verwandlung: von Menschen und Dingen in andere Menschen und Dinge. Die Konditionen, unter denen diese Verwandlungen stattfinden, sind die profanen der Realität benannten Gegenwart, nicht der Kunst. Sie sind Konditionen dessen, was sich außerhalb des Kunstanspruchs verwandelt: Menschen in Dinge, Menschen und Dinge in beispielsweise Geld und umgekehrt. Daß sich mit Kunst Geld machen läßt, beweist kein Gegenteil.
*
Anderes Beispiel: Die Deindustrialisierung der Arbeitsgesellschaft führt zur Industrialisierung der Diskursgesellschaft. Was in den Kontext von Lohnarbeit nicht länger paßt, muß ausgelagert werden: in Beschäftigungstherapien, Sozialprogramme und im Zweifelsfall in Kunst. Das vorherrschende Kunstverständnis, ausgedrückt in Trends, ist ein Kunstmißverständnis. Ein Kunstverständnis ist ein künstliches Verständnis. Realismus ist etwas anderes. Realismus ist Politik.
*
Beuys’ Vermutung „jeder Mensch ein Künstler“ ist eine Fehlinterpretation nach Darwin. Die soziale Plastik mag der Mensch sein, die asoziale ist der Künstler. Niemand kann wahrhaft Künstler oder Anwalt sein ohne einen Ansatz krimineller Energie. Wen die Politik nicht erledigt, den erledigt die Ökonomie. Wen die Ökonomie nicht plattmacht, den erledigt die Verwaltung, sie ist der erste Agent politischer Korrektheit. Kunst ist nicht im Sinn der Politik Ermöglichung, sie ist der Ort des Radikalen, sie verunmöglicht, nimmt auf Verluste keine Rücksicht, macht keine Gefangenen, sie kennt keine Moral, sagt nicht Auf Wiedersehn und Guten Tag, die Kunst ist ein Arsch. Sie ist, nach dem Ende des Weltbürgerkriegs in unseren Breiten, der letzte Terrorist, der subventionierte Partisan der Empörung.
*
„Wir haben die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehn“, sagt Nietzsche, Philosoph noch, 1887. Wenn die Kunst besser als die Wahrheit ist, erklären wir die Wirklichkeit zur Kunst. Wir suchen uns, indem wir uns in der Kunst neu erfinden. Indem wir uns verwandeln, verwandeln wir die Wirklichkeit in Kunst, flächendeckend. Das größte Flächendenkmal derart stellen die Staaten des früheren sozialistischen Lagers. Boris Groys’ „Gesamtkunstwerk Stalin“ war nicht nur ein Rekurs auf den Großen Terror, auch eine Vision der Globalisierung. Von den zerfaserten Rändern gräbt sich der Malstrom der Geschichte ins Zentrum und höhlt die Strukturen des Vergangenen aus. Die Teilstadt Ostberlin ist in der Mitte ein besiedeltes Museum, umgeben von Regierungs- und Eigentumsapparaten, in der Mitte der Mitte stehen vier Theater, eins für Kinder steht am Rand. Das Amalgam aus Proletkult, Subkultur, sozialrevolutionärer Avantgarde und Anpassungsbalance während zweier totalitärer Systeme hatte seinen Hauptveranstaltungsort in der Volksbühne am Platz mit den vielen verschiedenen Namen. Das Kürzel OST auf dem Dach stand eine zeitlang für den besseren und dort nicht eingelösten Inhalt der Konsonantenkette DDR. Jetzt ist OST ein Markenzeichen und bald ein Fall fürs Museum.
*
„Die Lage wird dadurch so kompliziert, daß weniger denn je eine einfache Wiedergabe der Realität etwas über die Realität aussagt. Ein Foto der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus.“, insistiert Brecht, Urheberrechtskläger vor dem Landgericht Berlin, im Dreigroschenprozeß 1930. Ein Foto der Volksbühne sagt beinah nichts über die Volksbühne, nichts über die menschlichen Beziehungen, die sie verkörpert. Die Realität eines Fotos ist eine andere als die Realität des Abgebildeten. Die Kunst ist eine Fotografie der Wirklichkeit. „Als ob man von der Kunst etwas verstehen könnte, ohne etwas von der Wirklichkeit zu verstehen.“ Du verstehst sie beide nur, indem du sie erfährst.
*
Im Totenreich der Kunstdefinitionen hat der Grundriß des Theaters zwischen verwitterten Grenzmarken seinen Platz. Soll sein Raum die Kirche zitieren, vielleicht ist am Ende der Keller der Ort, an dem es stattfinden kann vor einer Klientel von Auserwählten. Die Exklusivität des Theaters ist nicht der Klub mit den Klappsitzen, die Exklusivität ist die Zeit, die das Theater sich nimmt, um mit den Toten vor den Lebenden zu kommunizieren, um das Subjekt der Geschichte zu zeigen Abend für Abend, ein Riß in der Zeit und eine Mauer gegen den Sog der Globalisierung, die jede Erfahrung in Information übersetzt.
*
„Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern.“ – notiert der staatenlose Walter Benjamin, ein Kritiker, 1940 auf der Flucht vor der Flucht vor dem Teilchenbeschleuniger Hitler, und beschreibt den Zugriff, mit dem Kunst sich politisch positioniert. Wir sind historische Subjekte und uns droht Gefahr. Benjamin benennt auch die: zum Werkzeug der herrschenden Klasse zu werden. Das finstere Vokabular paßt in ein Wort: Konformismus, dessen Herrschaft ist politisch und ästhetisch real. Das größte Pfund, das wir dagegen haben, ist die Geschichte, der reale Bezug zum Vergangnen, der historische Ballast, der Ort, von dem wir ausgehn, er ist hier. Angesichts von Verhältnissen, die freundlich aber konsequent an der Schleifung von Widersprüchen arbeiten, kann der Gang in die historische Tiefe eine Befreiung sein. Unter der Unterbühne liegt Berlin im märkischen Beton. Nie war die Stadt so am Boden, so erfolgreich plangemacht, so glänzend wie heute. Konfliktpotential, das über krisenhafte Situationen zu revolutionären führen könnte, wird in die Randzonen verschoben. Die Volksbühne ist ein Randgebiet von Politik, Geschichte, Kultur. Sie ist ein biographisches Aggregat, betrieben von Ureinwohnern aus dem Osten und Neuzugängen aus dem Westen. Ihr episches Theater, Castorf vorzugsweise, verwertet das biographische Material, die Sozialisierungsschleife unaufhörlich. Die Kontinuität dieser Produktionsweise, die Bestand der Aufführungen ist, ist zugleich Gegenbewegung und Sprengkommando im Kontinuum der Geschichte. Sie kann nur in der Gegenwart geschrieben werden, mit dem Blick auf das Vergangene, der das Geschehen, das uns umgibt, verfremdet, als Material erkennbar macht, das zur Verfügung steht. „Der Materialist bleibt seiner Kräfte Herr.“
*
Zur Realität gehört das Chaos, das Ungeordnete, die Überstürzung. Der Fehler im System kann der Feind sein, aber der Fehler ist es auch, der jede Funktion zur Reaktion zwingt und das Modell der Realität jedem einzelnen zum Prüfstand macht. Utopie als Projektion eines Systems, das Chancengleichheit möglich macht, mag heute und hier nur noch ein Traum benachteiligter Kindergartenkinder sein – betrachtet vor dem Hintergrund von 25 Jahren subventionierter konsenskapitalistischer Gesellschaftsstruktur OstWest, stehen sich mindestens zwei Generationen gegenüber, die ihre verschiedenen Erfahrungsräume bestenfalls miteinander diskutieren können: eine sozialisiert über den Begriff des Eigentums, die andere über den Begriff der Ideologie. Wo die eine nach dem besten Wohnraum greift, greift die andre nach dem utopisch definierten Gegenraum, er kostet nichts. Beide Erfahrungen miteinander zu verschränken kann eine Möglichkeit der Kunst sein. Sie suggeriert Realität.
*
Noch einmal Benjamin: „Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, erkennen wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick der Gefahr aufblitzt.“ Der Augenblick der Gefahr ist die Stunde des Konformismus, der den Stachel der Kunst bricht. Schiller, Dozent in Jena 1789, in seiner Vorlesung „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“ schwört die Zuhörerschaft drauf ein: „Die Quelle aller Geschichte ist Tradition, das Organ der Tradition ist die Sprache. Die ganze Epoche vor der Sprache, so folgenreich sie auch für die Welt gewesen, ist für die Weltgeschichte verloren.“ Wo die Quelle versiegt, bleibt der einzelne zurück, taub in wortlosem Gebrüll. Er hat nichts zu sagen, er ist das Objekt der Geschichte, die aufgehört hat für ihn. Politik als Interessensvertreter der Industrie – egal ob Kunst oder Krieg, alles hat seinen Markt – wird nichts anderes durchsetzen, als das was profitabel ist und soziale Unwucht kostengünstig befrieden kann. Das aufgesprengte Kontinuum der Geschichte, der freundliche Schützengraben am Rosa-Luxemburg-Platz, wird sich als Lücke schließen unter dieser Politik. Das inkommensurable historische Zufallsprodukt hat seine Halbwertzeit, was bleibt stiften die Archive. Cioran, Rumäne in Paris, Ecke Sorbonne, hatte an der Tür sein Kalenderblatt, vorm Verlassen der Dachkammer zu lesen: „Nur eins zählt: Lernen, ein Verlierer zu sein.“ Die Subversion hat viele Namen.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Bärbel Bolle ist gestorben. Die kleine Schauspielerin mit der Figur wie von Barlach, die tapfere mit der stampfenden stanzenden Stimme, die jedes Wort im Satz über die Bühne wuchten konnte wie eine kolossale Erkenntnis. Die laut und zugleich leise, zart sein konnte wie der Schmelz der jungen Jahre, in dem sie auf der Bühne des Deutschen Theaters in den Rollen liebender Mädchen von klassischem Format stand. In mehr als 50 Jahren auf der Bühne waren ihre Auftritte in den späteren Jahrzehnten rar und jedesmal besonders. Ihre Erscheinung war ein Akzent, sie war das Semikolon in der Interpunktion eines Abends. Die Interpunktionslosigkeit mancher Inszenierungen hat ihre Auftritte zwingend gemacht, unwiderruflich. „Doch! Doch! Doch! Doch! Doch! Doch! Sie haben daran gedacht! Sie haben daran gedacht!“ zwischen Kohlenhaufen und Fernseher in Tschechows/Castorfs/Denics DUELL in den Bühnenhimmel diktiert, war auch als das „Da bin ich aber immer noch!“ einer Schauspielerin zu verstehen, die mit unwiderstehlicher Intensität an sich und an das erinnerte, was das Spiel wesentlich macht: eine kraftvolle Behauptung. Wie ihr Blick, der zwischen nachdenkender Abwesenheit und durchbohrendem Ansehen des Gegenübers dauernd wechselte, sie hatte viel zu fragen. 1962 engagierte sie Wolfgang Langhoff von der Schauspielschule ans DT, wo sie in ihrer ersten Rolle als jugendliche Parteisekretärin in Hacks‘ DIE SORGEN UND DIE MACHT sofort in die Schußbahn der politischen Angriffe der dann verbotenen Aufführung geriet. Es sind die spektakulären Mädchenrollen und die Rollen gewisser älterer Damen aus einer Vielzahl großer Inszenierungen, die die Biographie ihres Theaters wie eine Klammer um ein halbes Jahrhundert markieren. Zwei Karrieren: eine aufsehenerregende frühe und eine sehr markante späte. Dazwischen eine viel zu lange Pause, aus der sie Frank Castorf zurück und auf die Bühne holte. Und es sind zwei Regisseure, die diese Biographie prägten vor allen anderen. Adolf Dresen mit FAUST, ZERBOCHNER KRUG und PRINZ VON HOMBURG in den 60er und 70er Jahren, dann Castorf mit PARIS, PARIS, JOHN GABRIEL BORKMAN in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, und von 2009 bis zu Beginn dieses Jahres mit OZEAN, SOLDATEN, NACH MOSKAU! NACH MOSKAU!, KAUFMANN VON BERLIN, WIRTIN, KAPUTT an der Volksbühne. Die ihr auf den rundlichen Leib geschriebene „große BB“ in Polleschs HOUSE FOR SALE konnte sie zuletzt nicht mehr spielen, schon der Gang zum Schlußapplaus war Überforderung. „Die Bolle“ und eine Handvoll anderer Bolle-Rollen-Miniaturen in den BLUTSBRÜDERN mußte sie vier Tage vor der Premiere abgeben: „Bolle nimmt nur Bestet“ ist nun einer der Sätze, die aus ihrem Mund kein Publikum mehr gefunden haben, weil die Kraft verbraucht war. Wir hatten mit ihr gehofft, daß es ein vorübergehender Abschied wäre, jetzt ist es für immer. Alles, was sie für uns und für ihr Publikum so besonders machte, gehört nun zum Besten unserer Erinnerung.
„The spectacle of terrorism forces the terrorism of spectacle upon us.“
Baudrillard1
In a World ...
Terror ist omnipräsent, ubiquitär, allgegenwärtig, omnipotent, wie Gott, wirkt er überall hinein und wird von überall her bewirkt. Er hat den Überwachungsstaat breiter aufgestellt, nationalistische Gefühlsausbrüche und Opfererzählungen gestärkt, Nachrichtensendungen, Talkshows und Filme mit einem nie versiegendem Content-Vorrat versorgt und in Amerika unter anderem im Patriot Act und in Deutschland mit § 129a (RAF) und § 129b (9/11) gesetzesgebende Kraft bewiesen. Nur denjenigen, wagemutigen Kreuzrittern, die ihn suchen, die sich mit ihm in Tora Bora, Pakistan, Irak, Syrien und sonst überall von Angesicht zu Angesicht oder wenigstens mittelbar durchs Zielfernrohr konfrontieren, die ihn in seinem Kern treffen wollen, die ihn in den seltenen tatsächlich durchgeführten Gerichtsverhandlungen dingfest machen oder mittels investigativer Recherche zu enthüllen versuchen, denjenigen entzieht er sich. Sie kommen zurück, terrorisiert vom Trauma der Begegnung mit seiner inneren Leere und Ortlosigkeit.
Der Schrecken/Terror, den ein solches Gespenst/Gespinst hervorruft, das in jede Pore der Welt verflochten ist, aber nirgends greifbar wird, verlangt nach der Geborgenheit altbewährter Bewältigungsmuster und fesselt uns stärker noch an die neuste medial vermittelte Form seiner Botschaft, den Bildschirm, dessen Allwissenheit wir zu vertrauen gelernt haben, auch wenn wir uns der Interpretation nicht immer sicher sind. Als Tatort des Terrors zeigt sich der „Brennpunkt“, das Newsspecial, der Liveticker, die Unterbrechung des „Tatorts“ für eine dringende Meldung. Und so wird, um der Schockstarre Herr zu werden und die in Wallung geratene Masse zu aktivieren, eine gigantische äußerlich spiegelglatte und innen hohle Wahnvorstellung auf dem Flat Screen installiert. Eine Dauerwerbesendung, die alles verortet in dem actiongeladenen Plot, der sich um die eigene schicksalshafte Gut-Heit und die demselben entgegenstehende dunkle Macht der Anderen, der Übeltäter – „Evil-Doers“2 dreht. Aus dem ziellos durcheinanderblinkenden Pixelhaufen, den die Realität abgibt, aufersteht auf dem Bildschirm mit jeder Katastrophe größer und überzeugender – also realer – eine längst verloren geglaubte Welt. Eine Welt, die uns durch das Training zahlloser Blockbuster als Aufbewahrungsort für Sehnsüchte und als Lager unserer Ängste bereits ans Herz gewachsen ist. Eine Welt, in der seit Anbeginn der Schöpfung ein Kampf zweier Reiche wütet: das Reich des Lichts und das Reich der Dunkelheit, in der das Gute siegt und in der am Ende auch immer eine individuelle Liebesgeschichte den Beginn des neuen Menschen besiegelt. Erzählt von der pathosgeladenen maskulinen reifen Stimme George W. Bushs und anderer Superstars des Politgenres. In a World …
Massen-Haft
Weil wir diese Welt und diese Geschichte so gut kennen, weil wir den Plot auswendig können, ist klar, dass auch in der Terrorvariation Wir, also das Gute siegen muss und es irgendwann gegen Ende kurz sexy wird. Dieser neuste James-Bond-Ableger macht die ganze Welt zum Schauplatz unserer Heldenhaftigkeit, die Mohnfelder Afghanistans ebenso, wie die Grenzbefestigungen, Abschiebeknäste und Vororte unserer Metropolen. Spannung ist das wichtigste Instrument, durch das uns der Plot fesselt. Die Spannung erhält unseren starr auf den Bildschirm gerichteten Blick aufrecht und verhindert, dass wir plötzlich rausfallen und den vergessenen Kinosaal und den ihn umgebenden Alltag erinnern, oder im schlimmsten Fall umschalten. Der Plot verwandelt den Schrecken der Ungewissheit, die Unsicherheit und den Terror des sich stets entziehenden Sinns in unterhaltsame Spannung. Gäbe es ein anderes Programm und könnte man umschalten, kämen die Folgen, die Effekte, die Legitimität der eingesetzten Mittel und absurden Zwecke des heroischen Kampfes unseres All-American-Heroes in den Blick, dann käme die Grenze zwischen gut und böse ins wanken, angesichts der Ahnung, dass wir schon längst selbst die geisterhafte Leere im inneren unserer Phantasie des Bösen ausfüllen. Zum Glück aber folgt die Kamera James Bond und nicht den Leuten, die auf den Marktstraßen, die er auf dem Motorad heimsucht, die Scherben ihrer Existenz zusammenfegen. Weder die Geschichte der Opfer von Drohnenangriffen, noch langweilige rechtswissenschaftliche Erörterungen von Menschenrechtsverstößen im Krieg gegen den Terror generieren hohe Einschaltquoten. Außerdem haben wir in zahlreichen Serien und Filmen gelernt, dass es für große Männer, für die Rächer der Unschuldigen Toten, für die Krieger der Freiheit Wichtigeres, Dringenderes und vor allem Spannenderes gibt, als Gesetze zu befolgen. Kriegsverbrecher, die nicht verurteilt werden, Verdächtigungen, die nie zurückgenommen oder widerlegt werden und deren verheerende Folgen totgeschwiegen werden (Massenvernichtungswaffen, Terrornetzwerke, Verdächtigte in Guantanamo und so vieles mehr) – alles im Dienst der Einschaltquoten. Zwischen den Medien, der Masse und dem Terrorismus besteht eine unlösliche Abhängigkeit. Keine kann ohne die anderen beiden Komponenten bestehen. Baudrillard hat diesen Mechanismus schon 1983 in „Die Fatalen Strategien“ als Geiselnahme/Begeisterung/Faszination beschrieben: Die Medien eine Geisel des Terrorismus – die Massen eine Geisel der Medien (und andersherum). Die Terroristen sind begeistert von den Medien, weil diese die Massen begeistern, die Massen sind begeistert von den Terroristen, weil diese die Medien begeistern, die Medienmacher sind begeistert, weil die Quote oben bleibt und so weiter. Die Begeisterung gilt dabei nicht Medien/Terroristen/Masse an sich, sondern deren jeweiliger Potenz, Begeisterung bei Medien/Masse/Terroristen hervorzurufen und selbst von ihnen begeistert werden zu können.
... ex machina
Innerhalb dieser Begeisterungskreisläufe nistet der Terrorplot, die Erzählung vom monolithischen Bösen, zusammengehalten von der Logik des Verdachts. Sie transformiert alliierte Freedom Fighters in satanisch dreinblickende Taliban, den harmlosen Ausflug arabischstämmiger Jugendlicher ins Disneyland in die durchtriebene Auskundschaftungsoperation einer hochgefährlichen Terrorzelle, sie entlarvt den laut in seiner Muttersprache kommunizierenden Nachbarn als Hassprediger, und das Kopftuch als Angriff auf die Freiheit aller Frauen.
Der nach dem Modell der Fernsehserie geformte Terrordiskurs fesselt die Aufmerksamkeit der Masse, durch die Permanenz von Dringlichkeit, das Prinzip des Cliffhangers, den Terror des ständigen Auftauchens immer neuer Bilder, die uns überwältigen und die unendliche Wiederholung, bei gleichzeitiger Aushöhlung des Sinns. Auf dem Laufenden sein heißt, in Geiselhaft genommen werden vom Laufrad der Masse-Medien-Terror-Maschine. Mitgefangener unserer Aufmerksamkeit ist unsere Urteilsfähigkeit. Spannung wird erzeugt durch den absoluten Antagonismus von Gut und Böse, und die Identifikationsmöglichkeit mit einem der beiden Gegenspieler. Dass die Masse davon überzeugt wird, über ein angeborenes Wissen vom absolut Guten zu verfügen und prädestiniert zu sein, das Reich des Guten zu verteidigen, ist gleichzeitig Effekt und Ursache der Gut-Böse-Erzählung.
Die Strategie der Abschottung steht uns nicht offen, der Terrorismus des Spektakels durchwirkt uns. Seine doppelte Struktur, das von ihrer eigenen Wirkung erzeugte Wirken, verleiht ihm die totale Durchschlagkraft. Jede Erzählung heroischer Selbstbefreiung ist schon kontaminiert und dient der weiteren Ansteckung.
Wo es keinen Ausweg gibt, bleibt nur das sich Verzetteln in den Tiefen der inneren Strukturen. Um die Kurzsichtigkeit zu durchbrechen, die nicht über die erste Ebene der Dichotomien Innen/Außen, Freund/Feind, Gut/Böse hinausreicht, ist eine Durchdringung des Äußeren durch das Innere, die zugleich die Entäußerung des Inneren in alle Richtungen nachverfolgt, nötig. Die Auslösung der Spiralbewegung eines kritischen Denkens, Pendeln, Oszillieren, Teleportieren, Shapeshifting ... der Gefahr ausgesetzt, dass man sich niemals mehr in einem kohärenten Raum wiederfinden könnte. Wir sind verblendet durch die Hoffnung, dass irgendwann die ausreichende Quantität, der Siedepunkt erreicht ist, der Um-Schlag kommt und uns die Zentrifugalkräfte dem Bezugssystem entreißen.
Thousand-yard Stare – Overkill – Spannungsdurchschlag
Wer bleibt noch übrig als Lehrmeister, wenn das Bedürfnis nach Freiheit bereits eine Geisel des Apparats ist? Sie lässt uns im Kamikazeflug immer tiefer in das innere des Schlachtfelds vordringen. Wir folgen dem Weg des „Freedom Fighters“. Aber wir bleiben nicht stehen, wir verausgaben und verheizen uns mit ihm. Wir schlagen uns mit ihm durch bis zum Punkt ins unerträgliche gesteigerter Erschöpfung, bis alle Pathospotenz aufgebraucht ist, und der Zustand völliger Überreizung eintritt. Wir verzocken schlaflose Nächte vor den Bildschirmen bis die Bilder vor unseren blutunterlaufenen Augen zu flimmern beginnen. Bis die Aufmerksamkeit angesichts des Daueralarms resigniert und die niemals abgeschaltete Sirene uns taub werden lässt. Wir konfrontieren den Apparat mit dem thousand-yard stare, dem in dauernder Überforderung ungläubig erstarrten Blick des traumatisierten Kriegsheimkehrers. Wir lassen uns anstecken von der Paranoia, die hinter jedem Zivilisten einen schlafenden Agenten des Bösen vermutet, die bei jedem Knall zusammenzuckt und richten sie auf den Monitor. Wir verstärken die verhängnisvolle Logik der Prävention und des Verdachts, die man uns eingepflanzt hat, bis sie sich selbst verdächtig wird.
Unser Denken funktioniert nicht mehr als vernünftige und souveräne Kalkulation eines erfahrenen Strategen, sondern als Besiegtes. Sowohl die Stellungen des Feindes, als auch die Strategie zu seiner Bekämpfung sind an den Narben und Wucherungen, an der Verstümmelung unseres Denkens, an den Lichtern, die uns blenden, abzulesen. Wer nach dem Feind fragt, kriegt den Stumpf zu sehen, die Leere, die das gefräßige Phantom des Bösen hinterlassen hat. Eine solche Lektüre durch den thousand-yard stare verlässt die Position der Unschuld. Sie versucht die Wege nachzuvollziehen, die die Logik des Terrors durch unser Inneres nimmt. Sie akzeptiert die Porosität unserer Hülle, die von vornherein kontaminierte Position, die immer schon vorausgegangene Unterwanderung, Verblendung, die Abrichtung, die Uniformierung. Gegen die erhebende Identifikation mit dem Rächer unschuldiger Opfer, steht das Verschmelzen mit dem Hintergrund, mit derjenigen Landschaft und geschichtlichen Konstellation, deren Effekt der spezifische Kriegszustand ist. Sie akzeptiert nicht nur, sie benutzt, verstärkt, verheizt. Sie nährt sich von der Ambivalenz, wie sich die Terror-Ordnung vom Bedürfnis nach Reinheit und Unschuld nährt. Sie desertiert nicht, sie wird kriegsuntauglich.
Die von vornherein kontaminierte Perspektive weiß um ihre Verwandtschaften im Anderen/Bösen – in Gesicht und Gebaren des Terrors entdeckt sie die Komplizenschaft der Symptome.
Wechselkurse
Wie sie in der Ökonomie des Krieges als Tote getauscht werden, so werden sie in der Ökonomie der Terror-Medien-Massen-Apparatur als Likes, Liker und GeLikte, als Tweets, Twitterer und Retweets getauscht. Der Thausend-yard-stare weiß um die Leere seines Gegenübers, er fragt nicht mehr, wer der Gegner ist oder woran er glaubt, sondern wo und wieviele er ist. Aufklärung: die Stellung, die Truppenstärke, die Versorgungslage. Das sind die Faktoren, die die eine große, alle in Geiselhaft nehmende Kriegsmaschine bestimmen. Der Besiegte weiß auch, dass die Maschine des Terrors eine andere ist. Er weiß es als Untauglicher. Weder Kriegslogik noch die Logik der Menschenrechte geben den übergeordneter Rahmen und die Währung vor, sondern die Gesetzmäßigkeiten der PR-Maschine: erfolgreiches Branding und die komplexen Mechanismen der Akquise von Likes, Followern, Publicity.
In Jihadi John erkennt er den talentierten Schauspieler, der dem neuen Format der Enthauptungsvideos ein besonders effektives Gesicht gibt. Der wie Plot und Location zum Markenzeichen geworden ist, deren Wiedererkennungswert die Vielzahl der Views generiert. In den Aufnahmen der Leichenberge des Holocausts, der Leichen Che Guevaras und Holger Meins’, der Toten auf den Folterbildern Abu-Ghuraibs, der Leiche Bin Ladens und der Todesschüsse auf Kennedy haben sich die Zirkulationskraft und die Wirkung des ambivalenten Wahrheitswerts dieses Bildgenres gezeigt. Dem erstarrten demoralisierten Blick zeigt sich die viel umfassendere Geiselnahme, die weit über den Getöteten hinausreicht. Und die Wirkung wurde im Dienst des Wachstums noch gesteigert: Im neusten Isis-Hinrichtungsvideo tötet ein Zehnjähriger eine Geisel per Kopfschuss. Der aufwendige Schnitt und die Zeitlupe erzeugen die surreale Ästhetik von Computerspielen und Martial-Arts-Filmen. Einerseits erleichtert es Schurken und solchen, die es werden wollen, die Identifikation mit dem Avatar, weil sie die Übertragung quasi in einem gewohnten Umfeld vornehmen können, andererseits stellt es seine Realität offensiv selbst in Frage und erzeugt damit eine Spannung die eine noch stärkere virale Wirkung hervorruft. #ISIS ist seit Monaten unter den trending Twitterthemen gelistet und auf Youtube wird dazu aufgerufen, sich an den Spekulationen über die Echtheit der Tat zu beteiligen. Dort konkurriert die Hinrichtung mit Schminktipps und Obamas 10 gemeinsten Tweets um Views. Gleichzeitig bemühen sich auch Neonazis um Hashtag-Freundlichkeit im Branding und kommen dabei auf windschnittige Abkürzungen wie HoGeSa (Hooligans gegen Salafisten) und Pegida.
Musterung
Auch die Frage der Rekrutierung für den Produktionskreislaufs stellt sich vor dem Marketing-Hintergrund nochmal neu. In einer Welt, in der Gut und Böse so wunderbar ausgestaltete Figurenkonzepte darstellen, und man gewohnt ist, seine Freiheit mit der Auswahl zwischen einer schwarzen und einer weißen iPhone-Hülle gleichzusetzten, verwundert es nicht, dass der Mechanismus auch im Real-Life-Rollenspiel ISIS gegen den Westen funktioniert. Die Folge einer Aussage wie: „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns!“ ist zwangsläufig, dass sich der eine oder andere für die schwarze iPhone-Hülle entscheidet, schließlich folgt er damit noch immer der Idee der Selbstverwirklichung durch Konsumentscheidungen. Ist die Entscheidung erst mal getroffen, folgt das Casting: wer seine Rolle besonders gut spielt, das heißt, wer den Teufel teuflischer als der Teufel performen kann, kommt in die nächste Runde und schafft es vielleicht sogar ins Video. Wichtig ist dabei, dass die Quote stimmt, der Terrordiskurs also möglichst regelgetreu bedient wird. Anders als bei Casting-Shows im Fernsehen, gehören ein schönes Lächeln und ein offener Blick hier nicht zu den Strategien, die einen weiterbringen. Deswegen sind Jihadi John und seine Mitbewerber auch keine afghanischen Bauernsöhne, sondern kommen aus den Ecken der Welt, wo eine gute Medienperformance und medial vermittelte Selbstverwirklichung vom Kindesalter an gelernt wird. Bei jedem ISIS-Video schwingt die Unsicherheit mit: könnte nicht alles nur ein Film sein und ist der Terrorist nicht auch ein erfolgreicher Popstar? Nicht von ungefähr wimmelt Youtube von Videos über Jihadisten, die bereits auf eine Karriere als Rapper zurückblicken.
Das Experiment wäre, statt ein Bilderverbot auszusprechen, auf das Trauma des terrorisierend/terrorisierten Blicks zu setzen. Die Demoralisierung kann erst eintreten, wenn uns unsere Pathospotenz verlässt, wenn wir nicht mehr dazu taugen, #JesuisCharlie zu retweeten, weil wir in unsere juckenden Narben vertieft sind und unter Zwangsvorstellungen leiden: Wenn jemand Freiheit ruft, denken wir Stockholmsyndrom.

Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
--
¹Jean Baudrillard.The Spirit of Terrorism. London, 2002, S. 30.
²George W. Bush: http://en.wikiquote.org/wiki/Wikiquote:Transwiki/Terrorism_(disambiguation)/Evil_Doers
Guillaume Paoli hatte mich am 3. Februar zu seiner Diskussionsreihe »Im Reich des kleineren Übels« eingeladen. »Zombies auf der linken Standspur« hatte er unseren Abend angemessen kryptisch übertitelt und folgenden Einladungstext hinterher geschoben:
»Die Anästhesie hat Methode. In der Mitte wird endlos die große liberale Versöhnung zelebriert. Am Rand zeichnet sich stumpfreaktionäres Gebaren ab, das den elitären Konsens umso mehr verfestigt. Währenddessen schwebt die Linke im welthistorischen Orkus. Eigentlich eine gute Gelegenheit, um sich mit grundsätzlichen Fragen zu befassen. Angefangen mit: Wie kam es dazu? Felix Klopotek wirft Thesen in die Runde, von Guillaume Paoli unterbrochen und kommentiert. Oder anders herum.«
So war es dann auch: Wir einigten uns, keine ausformulierten Texte vorzutragen, sondern uns an einigen Vorlagen entlang zu hangeln. Guillaume ließ sich ein paar Themen einfallen, ich durchforstete einige meiner Texte nach den gewünschten Thesen. Wir mailten uns, wähnten uns gut vorbereitet und haben on stage aber was ganz anderes gemacht. So laufen halt Improvisationen, auch wenn sie in streng aufklärerischer Absicht exerziert werden.
Hier das Prequel (das es so nie gegeben hat):
1) Die Linke ist die Partei des globalisierten Kapitals. Im Schatten der Weltwirtschaftskrise tritt hierzulande wieder mal eine Linke an, den Kapitalismus zu retten, die Monopole in die Schranken zu verweisen, die Märkte zu regulieren, die Harmonie in den Betrieben wieder herzustellen.
Vor vierzig Jahren stellten französische Linksradikale die These auf, dass in seiner höchsten Vollendung oder – man war sich da nicht so sicher – schon im Übergang zur Dekadenz der Kapitalismus die Form des Sozialismus imitiere oder auf perverse Weise sogar verwirkliche: Produktion und Distribution scheinen immer mehr vergesellschaftet, in den USA sind Pensionsfonds, also private Rentenkassen, in denen die Lohnabhängigen einer jeweiligen Firma eingezahlt haben, Mehrheitseigner der Multis, in Deutschland ist es noch gar nicht so lange her, dass die Telekom-Aktie als ein Stück Volksvermögen angepriesen wurde (verdienen an der eigenen Enteignung und Wegrationalisierung). Und kein normaler Mensch kommt mehr auf die Idee, in Facebook oder Google privatwirtschaftlich organisierte Mega-Unternehmen zu sehen, scheinen sie doch real Gesellschaftlichkeit sans phrase zu repräsentieren. Es sind diese sozialen Elemente, die den Radikalen einst als Horrorzustände galten, weil sie darauf hindeuten, dass der Kapitalismus sich von seiner jahrhundertelang gültigen Repräsentationsformen – Privateigentum, der Kapitalist als relevante gesellschaftliche Figur, parlamentarische Demokratie, aber auch notorischer Hang zum Bonapartismus in Krisenzeiten – emanzipieren kann. Der vollständig vergesellschaftete Kapitalismus ist die vollständig kapitalisierte Gesellschaft, Staatskapitalismus die Unterwerfung des Staates unter das Kapital.
2) Liberale Freiheiten müssen gegen die Mehrheit durchgesetzt werden
»Man muß sich nur nicht die bornierte Vorstellung machen, als wenn das Kleinbürgertum prinzipiell ein egoistisches Klasseninteresse durchsetzen wolle. Es glaubt vielmehr, daß die besonderen Bedingungen seiner Befreiung die allgemeinen Bedingungen sind, innerhalb deren allein die moderne Gesellschaft gerettet und der Klassenkampf vermieden werden kann.« (Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 1852)
Die kleinbürgerliche Befreiung heute: Noch mehr Lernen, sich noch mehr Qualifikationen draufschaffen und noch auswegloser ins Einzelkämpferschicksal fügen: Die Anpassung an diese Normen und Imperative erfolgt aber nicht in Form einen Massen-Konformismus, nicht durch Graumäusigkeit, sondern in immer neuen Ausdifferenzierungen unüberschaubarer Lifestyles. Der Kapitalismus macht seine Jugend eben nicht immer dümmer, sondern klüger, dabei auch eitler und narzisstischer.
3) »Die Idee, man könnte dem Terror nur mit rechtsstaatlichen Mitteln beikommen, übersteigt die Grenze zum Irrealen. Es ist, als ob man die Feuerwehr auffordern würde, sich bei ihren Einsätzen an die Straßenverkehrsordnung zu halten.« (Henryk M. Broder, 2006)
Um die Demokratie zu retten, muss sie bisweilen außer Kraft gesetzt werden: das ist der harte Kern des liberaldemokratischen Weltbildes, das sich antisubstantialistisch geriert und ganz auf Verfahrensregeln abhebt, die Moral wird minimiert, verschwindet aber nicht und nimmt im Moment der Krise monströse Ausmaße an: Wer, etwa imKampf gegen den Terror, mit dem einen Gedankenschritt zuvor noch für das Strukturprinzip der westlichen Freiheit gefeierten Verfahrensregeln argumentierte, sabotiert nun den Kampf gegen den Terror, verhält sich amoralisch (legalistisch, aber nicht mehr der Legitimität verpflichtet). So die herrschende Logik. Der Ausnahmezustand der moralischen Unbedingtheit gilt jederzeit – es ist die permanente Wachsamkeit der Demokratie gegenüber ihren »Feinden«.
4) Freiheit heute ist die Verwirklichung der allgemeinen Konkurrenz
Man müsste entgegnen, dass in einer Gesellschaft der Gleichen es gerade nicht auf Chancen- oder Ergebnisgleichheit ankäme, weil die Ungleichheit – korrekter: Unterschiedlichkeit – etwa der Arbeitsergebnisse kein Mittel der Konkurrenz mehr ist, nicht mehr dafür eingesetzt werden kann, um andere in Abhängigkeiten zu bringen, in denen sie effektiver unter Druck gesetzt und ausgebeutet werden können. Der Sinn der Gleichheit liegt nicht in der Gleichmacherei, sondern darin, sich von ihr zu emanzipieren. Gleichmacherei gibt es nur in einer Gesellschaft, in der die Menschen sich misstrauisch als Schranke bei der Verwirklichung ihrer Bedürfnisse betrachten.
5) »In der Zeit des Verrats / Sind die Landschaften schön« (Heiner Müller, »Motiv bei A.S.«)
Seit etwa 200 Jahren – sagen wir: unmittelbar nachdem Hegel die Notwendigkeit der sozialen Existenz des Pöbels für die bürgerliche Gesellschaft konstatiert hatte – verfällt das Bürgertum unaufhörlich. Es hat sich dabei erstaunlich jung und frisch gehalten.
6) Nur eine linke Regierung ist imstande, rechte Maßnahmen durchzusetzen.
»Das Comeback der Staatsmacht.« Analyse von Axel Hansen auf Zeit online (24.2.):
… Es steckt noch ein wenig von den Wahlversprechen in der Aufstellung. Sie finden sich im vierten von vier Punkten, ganz am Ende der sieben Seiten langen Reformliste. Dort steht, dass die neue griechische Regierung gegen die himmelschreiende soziale Not im Land vorgehen will und die ganz Armen mit Strom und Gas versorgen wird. Sie sollen wieder in den Krankenhäusern behandelt werden dürfen und Essensmarken erhalten. (…)
Unmittelbar darauf folgt ein entscheidender Satz, es ist die letzte Zeile im Dokument: »Wir stellen sicher, dass der Kampf gegen die humanitäre Krise keinen negativen fiskalischen Effekt hat.«
Man muss sich diesen Satz einmal vor Augen halten. Da versetzt eine linksradikale Partei monatelang jeden Haushaltspolitiker Europas in Angst und Schrecken, weil sie Milliardenausgaben verspricht, obwohl das klamme Griechenland noch nicht einmal mehr eigenes Geld hat, um die Polizisten und Lehrer zu bezahlen. Mindestlohn rauf auf 751 Euro! Weihnachtsbonus für arme Rentner! Steuerfreibetrag rauf auf 12.000 Euro! All das wird versprochen. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, wenn konkret regiert werden soll, dann bleibt: Wir helfen den Bitterärmsten – solange das keinen negativen fiskalischen Effekt hat.
7) »Die entehrten Mittelklassen der heutigen stinkenden Gesellschaft öffnen sich, wie wir schon mehrmals gesehen haben, nur nach rechts, und wer sich ihnen nähert oder sie an sich zieht, ist nur ein Handlanger der Konterrevolution.« (Amadeo Bordiga, 1956)
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Vorwort
Es ist gut, zu wissen, wer Ähnlichkeit mit einem hat, ein ungefähr gleiches Leben geführt hat. Ich fand mein Double in Dylan Thomas. Ich bin in den letzten Jahren einige Male nach Wales gereist, mich dort in der Figur Dylan Thomas zu finden. Und nebenbei Leute kennenlernen, Landschaft anschauen. Ich hatte Spaß daran, mich dort zu bewegen, wo mein Idol Dylan Thomas einst lebte. Ich besuchte die Pubs von Dylan. Ich trank am Tresen stehend wie er. Ich dachte viel darüber nach, wie es bei mir so zu dieser Zuneigung kam, warum er und ich Schreiberling und Säufer wurden, und auch zwei identische Seelen, ach, in einer Brust wohnten? Uns verbinden Neigungen, die da sind. Neigung für Bücher. Neigung in Büchern zu lesen. Neigung zum Suff. Neigung manierlich zu saufen. Unser Dilemma: Der Trinkzwang und der Schreibimpuls liegen bei uns im Dauerclinch. Man sitzt am Schreibtisch wie in einer irischen Trinkerzelle. Man muss sich ewig entscheiden, wo man lieber weilt und schafft Klarheit darüber nicht. Dylan Thomas meinte saufend, er könne mit dem Trinken jederzeit aufhören und bekam schreibend immer wieder einen fruchtbaren Durst. Und beide wissen wir: Man gewöhnt sich ans Saufen einfach so, ans Schreiben aber muss man herangeführt werden wie einem Kind Handschuhe und Schal im Winter aufgedrängt werden. Seit ich in Wales war und mich auf die Spuren Dylan Thomas begab, kann ich den Alkoholgehalt der Bücher bestimmen, die im Rauschzustand geschrieben wurden. Ich kann aus meinen Augen eine Zunge machen und mit ihr herausfinden, wie tief der Autor ins Glas geschaut und mit welchem Fusel als Tinte er den Text gekritzelt hat. Das schafft nur, wer selbst ein guter Säufer ist. Ich weiß, seit ich in Wales war, ich werde im Leben nicht mehr so ein berühmter Säufer wie Dylan Thomas sein. Was uns unterscheidet? Nun ja, er hat sich trinkend, ich habe mich schreibend ins Abseits befördert. Und eins ist wodkaklar: Wer sich zwischen Saufen und Schreiben zu entscheiden sucht, verliert allemal, wenn er sich nur für eins von beiden entscheidet. Und dabei denke ich, wie Patti Smith um solche speziellen Dinge weiß. Denn sie war wenige Tage vor mir in der Kapelle auf dem Friedhof, wo Dylan begraben liegt. Wir standen zusammen vor seinem Grab, dem weißen Kreuz, auf dem vorne sein Name, hinten der seiner Frau geschrieben steht. Patti hat für dich gesungen. Ich habe einen Text auf englisch für dich geschrieben und vorgetragen. Einen langen Text (dreißig Seiten) über mich und Dylan, über uns, die wir Dylan genug sind. Und Patti hat sich alles geduldig angehört. Denn Patti gehört zu Dylan und zu mir und mitten hinein in unser beider Geschichte gestellt. Wir sind Geschwister. Ich habe den Text dann in ein Buch umgewandelt. In ihm rede ich ausschließlich davon, dass ich zu dir reise, mich besser zu verstehen, indem ich mich aufklärte, wer du heute sein könntest. Und dabei kam ich mir auf die Schliche. Und nun rede ich neuerdings von Dylan Thomas, wenn ich von mir rede. Und manchmal habe ich das Gefühl, mir gehen Dinge durch den Sinn, die in Dylans Kopf auch herumgegeistert sind. Und dann ist mir nach Schnaps und einer Schreibmaschine zugleich.
As if there weren’t decades between your birth and mine. As if I had to hurry to finish this text on time for your hundredth birthday, I’m writing down all my thoughts. I was fourteen years old and lived on the coast of the Baltic Sea and one day I heard your voice on the radio. My first auditory experience. Spoken rock ’n’ roll in English, which I understood immediately. With my heart. With my brain. The voice spoke into me and from out of me to me. I always saw pictures. Usually heads and grimaces. Garish colors. Yellow. Red, black. And school blackboard green. Wales is grown over with green. Wales has such very intimate and utterly romantic nooks and niches. You can go for a walk in Wales and think about trees that, here centuries, ago put down roots. No blue. Blue is not your color. The colors that I saw, the heads, the forms and faces, replaced mother and father for me. They consoled me for my parentless being. I listened to you. I heard myself speaking with your voice. I wanted to become a poet and recite texts like you. And I painted pictures in your colors. I inhaled your voice. I imitated your voice. And soon my voice spoke to me from the distant future. The sea soughs with your voice. The wind blows with your voice. Your voice undulates, howls, whispers, chortles, and whistles:
Though they be mad and dead as nails,
Heads of the characters hammer through daisies;
Break in the sun till the sun breaks down,
And death shall have no dominion.
I am you.
You are me.
You dwell in me.
I dwell in you.
Brother. I am thus
your rebirth.
Friends say I’m your spitting image, that I have your nose, your chin, your receding forehead, your eyes, your cheeks, your stature, and also a tendency to dress like you. I-Dylan-I, that’s a word now, too: Idylani. There is no difference between you and me. Differences unite us. We are as inseparable as parrots. I am, because you exist; you enliven me. We speak of a wind when we speak of passing clouds and birds. You are my older brother, Brother. You are a life born before my life, died a year before my birth. I tell you, that doesn’t matter, really it doesn’t. The year that you died before me makes us identical. The courses of our lives resemble each other. We were once two athletic boys. You win the mile race, a straight-out, start-to-finish victory. I run through the beech forest, ahead of all the other runners. You can be seen the next day in a photo in the newspaper; I was mentioned by name.
In my wallet, I carry the newspaper picture that shows you as a young boy after the race, on the day of your running success. It’s a lovely picture, Dylan. A lad looking into the future, it’s not a child avoiding looking into the camera.
My teachers are your parents, my parents your teachers. We don’t want to become like them, we want to be artists: paint, write, play music.
I like to talk as much as you do. I’m animated when I drink. When I’m tipsy, I dare to approach women. I compliment them. I am – until I’m drunk – a jokester like you, and when I am, then I’m suddenly not anymore. My character changes. I get on people’s nerves. I exaggerate. I get thrown out.
I think the way you must have thought.
In Wales, I am never alone; I’m always on my way to you and me with friends. Stuck on my own, I could overlook too much. Four eyes hear more than two ears will ever see. Together we are strong was the sentence written on my schoolbook.
Swansea is Rostock is Laugharne is Berlin. I travel to Wales, visit our sites. Dylan, I journey to me, journey to you. Your early death hinders you from being able to journey to me. We will not meet each other in this life; I have to show myself your places myself. Your sites become my sites. Your country, your time and space are left you. Your people are left you. Our countries are one country and a poetry dwells in it. My Baltic Sea is your Irish Sea. We live at the water’s edge. The sea doesn’t lie between us. The sea lies at our feet. The sea welds us together. It’s a coming and going at ebb and flood. We need the roaring and sounding of the sea every day and at full volume. Without the wild elements, we would be poor in our souls. We owe our creative power to the sea. A wind murmurs stories in our ears. A wind gives us melodies to our lines. We write poetry, simple things. We write life and compose poems like nature’s marionettes:
No more may gulls cry at their ears
Or waves break loud on the seashores;
Where blew a flower may a flower no more
Lift its head to the blows of the rain.
On my first visit, I’m on the way to Swansea with a friend. Porthcrawl was the name of the first town on my journey in Wales. A small town with a broad avenue. In the middle stands an old box clock. Not far from it, a clockmaker has his shop. He displays old gramophones in it. The man himself is one of a kind. We spoke a while about you. At our parting, the man gave me a cigarette, the kind you are supposed to have smoked. He said it was from the time when you were still alive.
We approached from Bristol and had an appointment with Anne. Anne, Dylan, this smart, kindhearted, wonderful person, this good female spirit in your house, this angel in person – I have to get to know her for you. Through her, I know everything about you and me, and she tells me lots of old, new funny-comical stories that are your stories and that seem to me as if they just happened recently. The woman, Brother, who has restored your birth house with so much love – through her, almost everything is as you described it in your books again.
Your time still dwells in your house.
You can move back in, any time.
I live in your birth house. I animate Cwmdonkin 5.
Everyone should live in your house once in his life.
We push curtains aside. Something in common grips me and never lets go of us again. A hand reaches for me and guides me. I open doors, closets, and drawers as if they were grab bags. Anne has stocked the drawers with all kinds of surprises. A comb, a handkerchief, a wallet, a deck of cards. We take a look at it all. We are everywhere in the house, in all its nooks and corners. You and I. You, as the older of two brothers. I sleep in your room, I see me, I see you, Dylan as the child that both of us are in my imagination. I observe the child as it spends your and my childhood. I end up, again and again, in the middle of your time. I see myself sitting underneath the stairs, hiding in the dark. You must have drilled the little hole to look through, I think. And prevailing in the house is a stillness more profound than one will ever experience anywhere else on earth.
The weather is completely atypical for Wales. On all my visits, the weather is always wonderful. As if the sun were happy to see you and me in one person. As if the sun wanted to accompany all our explorations in a joyful mood, to brighten the paths, illuminate all the corners.
A light breeze pushes me forward,
blows me sideward, gives us wings.
On my second visit, I’m in your house with my girlfriend. We leave the light on in the corridor. We would like to see it if the ghost of the little Dylan haunts this house. Death shall have no dominion over life. We wake up after the night. We take a bath in your tub. We clothe ourselves. And then are in your kitchen. My girlfriend and I, clothed like you and Caitlin as they can be seen breakfasting in old pictures. It’s great fun to reenact the photos like scenes in a play. My girlfriend wears her hair the way your Caitlin wore hers. I stand, clothed like you, in your pantry, noshing the jam. We bought the clothes for this in a second-hand store. You wore the pullover I’m wearing, or one like it. The strange jacket, too. I sit at the table and hold the newspaper the way you held it when reading. Nothing about this seems odd, much less alien, to me. I sit like you at your desk and in front of the fireplace. I take a book from the bookcase, leaf through the encyclopedia. I stand in front of the books that you looked at so often and happily. My girlfriend comes in through the door and calls me: Dylan.
[…]
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Complete available as:
Peter Wawerzinek / Schoko Casana Rosso
I DYL AN I
Prosatext, mit 8 zweifarbigen und 2 einfarbigen Linolschnitten
von SCR, 32 Seiten, übersetzt von Mitch Cohen
ISBN 978-3-942280-31-0
20,00 €
at:
Corvinus Presse
Hendrik Liersch
Brandenburgische Straße 122
15566 Schöneiche
„Unsere ganze Zivilisation ist vom Handelnwollen durchdrungen.“1
Junkies
Schon seit einer Weile gibt es eine neue Generation von Heldinnen und Helden im US-amerikanischen Fernsehen, die von den alten Stereotypen deutlich abweichen. Die Figuren sind komplexer geworden, zerrissener, vermeintlich „realistischer“ - selbst James Bond stößt sich inzwischen andauernd das Knie. Der falsche Schein ist weg, so die Suggestion, die eindeutige Zeichnung, und darunter kommt der „echte Mensch“ zum Vorschein. Dieser echte Mensch ist einsam, meist verzweifelt, oft psychisch instabil, manchmal auch suchtkrank. Aber egal, wie gebrochen die Helden sind, wie sinnlos ihnen alles vorkommt, sie opfern alles für die Arbeit: Gesundheit, Beziehungen, Freundschaften, ihr Leben. Es sind Heroinen und Heroen ohne idealistischen Überbau, fatalistische Fanatiker, die wissen, dass der Kampf vergeblich ist und trotzdem weitermachen, Junkies, vollständig der Droge Arbeit verfallen; selbst wenn sie wissen, dass sie alles verlieren werden, machen sie weiter. Sie können nicht anders.
Hikikomori
Am anderen Ende der Welt, in Japan, gibt es eine Massenbewegung junger Menschen, die sich nahezu vollständig aus der Gesellschaft zurückziehen. Die sogenannten Hikikomori gehen nicht mehr zur Schule, schmeißen das Studium oder den Job, ziehen sich in ihre Zimmer zurück - meist sind es die Kinderzimmer - und leben dort in völliger Isolation, finanziert von verzweifelten Eltern. Etwa eine Million Hikikomori soll es in Japan geben (bei ca. 127 Millionen Einwohnern), aus China und Südkorea werden erste Fälle gemeldet. Die Ursache sehen Psychologen im Wandel der japanischen Gesellschaft nach dem Wirtschaftsboom: die alte Ordnung zerfällt, Lebenszeitstellen werden rar, die harte Disziplin in Schule und Universität ist kein Garant mehr für finanzielle Sicherheit, der Erfolgsdruck wächst bei schwindenden Erfolgsaussichten.
Interessant ist dieses Phänomen auch deshalb, weil die Hikikomori - global betrachtet - einer protest- und ausdrucksfreudigen Generation angehören. Während sie den Rückzug antreten, gibt es weltweit vornehmlich „junge“ Widerstandsbewegungen, die auf die Straßen drängen - Studenten in Spanien und Portugal, Aufstände in Nordafrika, die Occupy-Wall Street-Bewegung in den USA und ihre eher überschaubaren Ableger in Europa. Occupy Wallstreet hatte eine literarische Figur zu ihrem Schutzpatron erkoren, die viel mit den Hikikomori gemeinsam hat: Melvilles tragischer Verneinungskünstler Bartleby, ein Kanzleischreiber, der irgendwann anfängt, jede ihm aufgetragene Tätigkeit mit der unschlagbaren Formel „I would prefer not to“ zurückzuweisen. Im Lauf der Novelle verweigert Bartleby Schritt für Schritt die elementarsten Dinge: Er möchte lieber nicht mehr arbeiten, lieber nicht nach einer neuen Stelle suchen, lieber nicht mehr rausgehen - und vor allem will er nicht begründen, warum er sich so verhält. Schließlich landet er im Gefängnis, wo er auch noch die Nahrungsaufnahme verweigert und stirbt.
Diese Radikalnegation aller gesellschaftlichen Konventionen, die Lebensweigerung des Helden, hat beim Lesen einen erstaunlich positiven Effekt. Ein schlichter, höflicher Satz genügt, um unser Weltbild ins Wanken zu bringen und die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten als das zu enttarnen, was sie sind: Optionen, Verabredungen. Ein Spiel, an dem man sich beteiligen kann, aber eben nicht muss. Auch die Unterlassung ist eine Möglichkeit.
Abendländischer Wahn
In Roland Barthes’ Vorlesungsnotizen zu Das Neutrum findet sich ein Abschnitt mit der Überschrift Der abendländische Wahn. Er beginnt mit folgender Beobachtung: „In makroideologischem Maßstab betrachtet, ist das Abendland auf Arroganz geradezu spezialisiert: hohe Wertschätzung des Willens; Überhöhung aller Anstrengungen, die auf Zerstörung, Veränderung, Konservierung usw. zielen; überall dogmatisch eingreifen.“2 Das moderne Denken, die moderne Philosophie sind von einer Verherrlichung des Wollens durchdrungen, von einer Idealisierung des Strebens, einer „männlich-überheblichen Wertschätzung für das Schwierige.“3
In Dantes Göttlicher Komödie durchläuft der Ich-Erzähler die christlichen Jenseitswelten, getrieben von der Sehnsucht nach seiner verstorbenen Geliebten und einem unstillbaren Wille zum Wissen. Sein Führer, Vergil, entschlüsselt ihm das göttliche System der Strafen und Belohnungen. Am Fuß des Läuterungsberges wird ihr Aufstieg von einer Stimme aufgehalten, die über den Wissenseifer spottet, über all die Fragerei - im Schatten, die Arme um die Knie geschlungen wie ein Embryo, den Kopf gesenkt, hockt ein alter Bekannter Dantes, der Florentiner Lautenmacher Belacqua. Diese historisch verbürge Gestalt, die stadtbekannt für ihre Faulheit war, soll Dante auf einen entsprechenden Vorwurf mit einem Aristoteles-Zitat geantwortet haben: „sedendo et quiescendo anima efficitur prudens“ (sitzend und ruhend wird die Seele weise). Da er sich zu spät zum Glauben bekannt hat muss Belacqua seine Lebenszeit noch einmal absitzen, bis er ins Fegefeuer, zur Läuterung, zugelassen wird. Doch scheint ihn seine Lage nicht weiter zu bedrücken, er sitzt mit einer gewissen, heiteren Indifferenz seine Zeit vor der Buße ab. „Bruder, was soll das Steigen?“ fragt er den Erzähler, der sich bereits anschickt, seine Entdeckungsreise fortzusetzen.
Vergebliches Verlangen
Belacqua wird zu einer zentralen Figur im Werk Becketts, er taucht in seiner ersten Erzählung auf und bleibt thematisch bis zum Schluss präsent. Es ist die Gegenfigur zu Dantes Jenseitswanderer, das Gegenstück zu allem Faustischen, zum abendländischen Eroberungs- und Erkenntniswillen. Es ist ein Held der Passivität, der Unterlassung, ein kontemplativer Gegenpol zu allem Aktivismus.
Becketts gesamtes Werk ist von einer Rückzugsbewegung geprägt, einer steten Reduktion der sprachlichen Mittel, einer Auflösung der konkreten Räume und Körper. In einem späten Stück (Not I) ist nichts geblieben als ein sprechender Mund, der sich drei Meter über dem Bühnenboden befindet. Die Sehnsucht danach, zu verlöschen, der Welt und dem Bewusstsein abhanden zu kommen, zurückzukehren in einen pränatalen Zustand, ein friedliches Nichts, ist ein zentrales Motiv der Erzählungen und Stücke. Die tragische Paradoxie, dass sich auch die Sehnsucht danach, nicht zu sein, noch eine Sehnsucht ist, bleibt bis zum Schluss bestehen: „Und noch immer verlangend. Noch immer schwach verlangend. Nach noch schwächerem. Schwächstem. Schwach vergeblich verlangend nach dem mindesten Verlangen. Unminderbar mindesten Verlangen. Noch immer unstillbar vergeblich mindesten Verlangen. Verlangend daß alles vergehe. Trübe vergehe. Leere vergehe. Verlangen vergehe. Vergebliches Verlangen daß vergebliches Verlangen vergehe.“4
Utopien
Wir befinden uns zur Zeit in mehreren, teilweise recht zählebigen Krisen, wirtschaftlich, geopolitisch, sozial und ethnisch. Die Krise ist der Normalzustand geworden, und mit ihr das Gebot vom schnellen Handeln. Auf alles muss es umgehend eine klare Antwort geben, pragmatische Vorschläge sind gefragt, kein philosophisches Gewäsch. Das Denken wird auf die Frage reduziert, ob es denn nützlich sei. Es soll sich an konkreten Problemen orientieren und Lösungsvorschläge machen; die ganze Bologna-Reform ist diesem Geist geschuldet. Slavoj Žižek weist zurecht darauf hin, dass damit eine wesentliche Errungenschaft der europäischen Geistesgeschichte zerstört wird: der freie Diskurs, dem sein Zweck nicht schon eingeschrieben ist. Eine seiner Forderungen: „We need useless education.“
Unter diesem Gesichtspunkt scheinen mir die Positionen der Unterlassung, des Nicht-Handelns so wertvoll. Es geht darum, dem „abendländischen Wahn“ etwas entgegen zu setzen. Boris Groys spricht von der Notwendigkeit, die kontemplative Seite zu stärken angesichts der überbordenden Aktivität der Welt und fordert eine „Pflege der Meinungslosigkeit“5. Schlegel fordert in der Lucinde, den Müßiggang zu Religion zu erheben und die Pflanze, das reine Vegetieren, zum Ideal - „je göttlicher ein Mensch oder ein Werk des Menschen ist, je ähnlicher werden sie der Pflanze.“6 John Cage, Marcel Duchamps, Beckett und Bartleby gehören in diesen Umkreis, Oblomow und der Taugenichts, die Müßiggänger der Romantik, die östliche Philosophie und Spiritualität. Sie brechen auf erhellende Weise mit unseren Denk- und Handlungsroutinen.
Dass diese Positionen nicht dazu taugen, konkret politisch aktiv zu werden, ist klar. Die Occupy-Bewegung ist daran gescheitert, eine derartige Geisteshaltung in die Realität zu überführen. Nichtsdestotrotz bleiben diese Positionen wichtig, solange sie richtig verstanden werden - als strategische Interventionen, Provokationen, als der Versuch, Zonen außerhalb des Getriebes zu erobern, Denkräume zu schaffen. Barthes schreibt über Pyrrhon: „Indem er also seine Müdigkeit akzeptierte - die Rede der anderen als exzessiv, als erdrückend -, schuf er etwas: Ich sage nicht was, denn eigentlich war es weder eine Philosophie noch ein System; ich könnte sagen: Er schuf das Neutrum.“7 Und erst aus diesem Neutrum kann, so Barthes, etwas Neues entstehen.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
-------------------------
1 Roland Barthes: Wie zusammen leben. Simulationen einiger alltäglichen Räume im Roman. Vorlesung am Collège de France 1976 – 1977. Hrsg. von Éric Marty. Frankfurt am Main, 2007, S. 149.
2 Roland Barthes: Das Neutrum. Vorlesungen am Collège de France 1977 - 1978. Hrsg. von Eric Marty. Frankfurt am Main, 2005, S. 256.
3 Ebenda, S. 257.
4 Samuel Beckett: Worstward Ho. Aufs Schlimmste zu. Frankfurt a. M., 1989, S. 47
5 Boris Groys: Wenn es einem die Sprache verschlägt. In: Metanoia. Über das Denken hinaus. Hrsg von: Staatsoper unter den Linden. Berlin, 2010, S. 87.
6 Friedrich Schlegel: Lucinde . Frankfurt am Main, 1985, S. 47 f.
7 Barthes: Das Neutrum. S. 55
„Und mit den Körpern wird´s zugrunde gehn.“
Der nackte Körper meiner Mutter war mir vertraut. Seidige, gelbliche, gesunde Haut überall, manchmal ein wenig bräunlich, helle, feine Härchen, kaum Achselhaar, schöne Beine, ein glatter Leib, den das Alter etwas rundete, nie verformte, er war nie drall gedrechselt oder gekerbt an Hüften, Taille oder Bauch, er war länglich geschwungen. Die Biegung des Nackens war besonders schön.
Den nackten Körper meines Vaters musste ich mir erfinden. Bevor ich ihn bewusst erlebte, war er tot. Ich konnte ihn nur auf Fotos sehen, nie ganz nackt. Er trug, auf einem steinigen Strand stehend, eine schwarze Badehose und weiße Turnschuhe. Sein großer Leib, älter schon, war weiß, unbehaart, die hohen Beine schlank, er hatte schmale Schenkel und fein gegliederte Knie, lange Arme und einen weichen Bauch, wie ihn viele Intellektuelle damals hatten. Keine Spuren von Sport oder körperlicher Arbeit. Er stand da nicht ohne eine gewisse Eleganz. Mehr so wie ein alter, verwöhnter Römer. Dann sah ich ihn auf einem anderen Foto einen ledernen Boxsack bearbeiten mit vor gerecktem Kinn und ganz entschlossen. Er hat sich doch das Kämpfen antrainieren wollen, dachte ich.
Ich kenne kein Foto, auf dem er nicht ein wenig dick ist, außer einem, das in Russland entstand. Dr. med. Richard Schmincke läuft lachend im Sonnenlicht mit den Jugendlichen der Gorki-Kolonie in ihren weißen Hemden und schwarzen Turnhosen über einen sandigen Weg. Beweglich, hemdsärmelig, fröhlich, frech der nach hinten geschobene Hut, der die Glatze verdeckt. Richards weiches, dunkles Haar war längst gewichen, als er mit 53 Jahren begann, mit Änne, meiner Mutter, zu leben.
Fotos von seinen Reisen als Komintern-Kurier nach Russland und China aus den Jahren 24/25 zeigen ihn mit breitem Hut und in einem dunklen Mantel, der wegen der Körperfülle und wegen der vielen wärmenden Schichten, die er darunter trug, ein wenig absteht, ein deutsches Glasmännlein aus dem deutschen Tannenwald im Kampf gegen den Holländermichel, dem er die menschlichen Herzen wieder abjagen will. Er passte im wahrsten Sinne des Wortes schon wegen seines Körpers nie recht ins Bild. Mit gutmütigem Lächeln auf dem breiten, nackten Gesicht steht er 1924 unbeholfen neben chinesischen Bauern und Kulis in Schanghai. Wie er mit sechs anderen Ärzten als siebenter, vorgestellt als der „politische Freund“ Sun Yat Sens, an dessen Krankenlager steht, davon habe ich kein Foto. Berichte darüber hebt das Auswärtige Amt auf. Sein erschrockenes und aufmerksames Gesicht auf einer Sitzung des Volkskommissariats für Gesundheit in der jungen Sowjetunion, die Einsamkeit seines Blicks über die Köpfe hinweg, vor denen er eine Rede hält, erstaunen mich.
Neben vielen kleinen, fixen, russisch-jüdischen Genossen und Genossinnen in Odessa, die alle fröhlich, selbstbewusst und kritisch in die Linse sehn, wirken sein ausladender Leib und seine Zufriedenheit fast naiv. Mit der deutschen Ärztedelegation steigt er die berühmte Treppe mit weitem Schritt hinauf. Er überragt um Kopfeslänge eine Ansammlung von Arbeitern, ein Riese als Zwerg. Brüderlich legt er die langen Arme um die Schultern der beiden Brüder von Karl Liebknecht bei einem Treffen im Grunewald, auf einem Bild, das meine Mutter 1936 aufgenommen hat.
Wie lagen sie zusammen, die Körper von Richard, auf die Welt gekommen 1875, und Änne, geboren 1909, in den weißen Betten mit den niedrigen emaillierten Metallbögen, in denen sie schliefen, eines war größer als das andere, unter den grünen seidenen Daunensteppdecken in den Bezügen aus Stangenleinen? Was war mit ihnen nach den langen Trennungen, zu denen sie sich selbst und zu denen die Kämpfe und die Verfolgungen sie zwangen, was machten dann ihre Körper, blieben sie aufeinander gerichtet oder nicht? Nüchtern und nichts sagend sind Bemerkungen wie: „Sie trennten sich“, oder „Er ist gestorben.“ Was heißt das für die Körper? Wie ist es weitergegangen mit ihnen, wie sind sie zu denen geworden, die ich mir lange nach ihrem Tod aus Erinnerungen und Fotos geschaffen habe. Was ist das für ein Körpergedächtnis, das zu mir nur aus einer zweidimensionalen Schwarzweißfotografie spricht? Wieviel hat ein erinnerter geliebter Körper noch gemein mit dem tatsächlichen, längst nicht mehr existenten? Eine Frage, die mir mit dem Zerfall des eigenen Körpers, der meinen Kindern, meinen Enkeln in Erinnerung bleiben wird, „zu Leibe“ rückt.
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
Lieber Marcus,
als Du im Dezember in Deiner Reihe „Überstürztes Denken“ über Inkonsistenzen sprachst, kam mir Brechts Theatertheorie in den Sinn. Verwunderlich, denn eigentlich habe ich die Beschäftigung damit vor Jahren aufgegeben und das Konstrukt in irgendeiner Rumpelkammer meines Geistes abgestellt, wo es seitdem unbeachtet Staub ansetzen konnte. Bis zu diesem Dienstagabend im Dezember jedenfalls, da drängte sich der Zusammenhang regelrecht auf.
Wie Du Dich nach der Inkonsistenz der Realität fragst, hat sich Brecht diesem Thema im Modus der mimetischen Operation gestellt und das epische Theater um die Frage zentriert, wie die Realität auf der Bühne als veränderbare dargestellt werden kann. Er geht davon aus, dass es sich bei dem Illusionstheater von Stanislawski bis Hollywood, um eine instruktive Ästhetik der Narkose handelt, mit dem Ziel die Fiktion der Konsistenz zu zementieren. Vor diesem Horizont einer Weltherrschaft „der Rauschgiftkartelle“ (original) kommt er zu dem Schluss, dass es nicht darum gehen kann, den Zuschauer in der richtigen Weise zu „hypnotisieren“ (Lieblingsausdruck von BB) sondern dazu zu animieren, im Akt des Denkens selbst Verflüssigungen des auf der Bühne Gezeigten und damit der Realität herzustellen. Er begreift sein Dispositiv, wo das Entscheidende nicht auf der Bühne sondern zwischen Bühne und Zuschauerraum stattfindet, von daher als philosophisches Theater. Alles was das Denken stört, wie dramatische Intensität, sensationelle Emotionen, suggestive Spielweise etc. fällt unter das Betäubungsmittelgesetz und darf nur in kleinen Dosen (Unterhaltungswert) verabreicht werden. Aus dieser Perspektive fällt zum Beispiel der sowjetische Klassiker „Panzerkreuzer Potemkin“ von Sergej Eisenstein durch den Rost, weil die Erschütterungen, die der Film intendiert, mit dem suggestiven Gestus arbeiten. Der Film macht glauben, vermasst das singuläre Bewußtsein und beruhigt es mit einem weiteren Konsistenzversprechen: dem Scheinen der Sonne des Guten ohne Unterlass.
Das rief die linke Orthodoxie (Lukàcs) auf den Plan, die Brecht wegen seiner Konsequenz angriff, dass Identitätsflächen im wachen Spiel nichts zu suchen haben. Der Rezipient muß vom passiven Opfer zum aktiven Täter mutieren und sich selbst ein Bild machen. Konrad Wolf beispielsweise argumentierte angesichts von „Mutter Courage“, dass es keine einzige Figur gäbe, an der sich das Publikum orientieren könne. Brecht parierte den Vorstoß mit der Wendung, dass er nicht die Figur sehend machen wolle sondern den Zuschauer. Also Denken ohne Geländer. Brechts Differenz zu Lukàcs/Stanislawski besteht darin, dass er nicht ein kapitalistisches gegen ein sozialistisches Konsistenzgefüge austauschen will, sondern das Inkonsistente der Realität bildet selbst den Sog des „Denkraums“ Theaters. By the way, die konservative Kritik rezipierte „Mutter Courage“ tatsächlich als Tragödie, d.h. als Präsentation der Konsistenz, als Schicksal, in dass es sich zu fügen galt oder gilt.
„Der denkende Zuschauer“ (noch eine von Brechts Lieblingsvokabeln) braucht nicht nur Distanz, sondern um zu erkennen, dass die vorgestellten Relationen und Beziehungen auch anders möglich wären, einen „fremden“ oder „ethnologischen“ Blick, den das Theater stimulieren muss. Diese Installation ist notwendig – so das anthropologische Argument –, weil das Kind die Realität als unbeeinflussbar, also als Konsistenz erfährt und fortan das Gegebene als das Selbstverständliche gar nicht in den Fokus der Inkonsistenz bekommt. Erst dem wachen Bewußtsein zeigt sich die Gewordenheit der Realitätsordnungen, die aus geronnener Geschichte bestehen. Das ist mit Heidegger kompatibel, das heißt wir bekommen die Phänomene nicht unverborgen bzw. als solche in den Blick, sondern stets nur in ihrer geschichtlichen und temporären Erscheinung. Dabei verdeckt die Fata Morgana aus permanent wuchernden Tatsachen, dass sich hinter dem Auf und Ab der Oberfläche durchaus konsistente, aber veränderbare Zwänge und Steuerungsmechanismen der gesellschaftlichen Motoren verbergen. Um diese Entbergung, die sich im Denken des Zuschauers abspielt, zu initiieren, bringt Brecht den V-Effekt, den Kunstgriff der Verfremdung ins Spiel. Er soll erst Staunen und damit – der platonische Klassiker – Denken auslösen. Erst als verfremdete zeigen sich dem Staunenden die Dinge in ihrer wahren, d.h. inkonsistenten Gestalt. Daher auch Brechts Vorliebe für Rauch, Wasser, Wind, das Biegsame gegenüber dem Harten, Unnachgiebigen etc.: Daß das weiche Wasser in Bewegung / Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. / Du verstehst das Harte unterliegt.
Die Müller Variante lautet: Wer hat bessre Zähne / Das Blut oder der Stein. Henry Jameson attestiert Brecht wegen dieser Affinität gegenüber dem Inkonsistenten, er hätte das Tao in den Marxismus eingebracht oder zumindest dem Marxismus angeboten. Das Tao, so habe ich es in einem dieser kleinen Merve-Bändchen bei Francois Julien gelesen, ist stets vorhanden. Es ist jener Punkt einer Situation, den man fast absichtslos berühren muß, wo ein Spiel mit Nuancen ohne übermäßige Kraftaufwendung aufgezogen wird, bis das Ganze in Bewegung kommt und die Ausgangslage sich in ihr Gegenteil verkehrt. Das ist zudem der Grundgedanke der martial arts: „Sei Wasser, mein Freund!“ (Bruce Lee). Der Meister, in der Regel ein älterer Herr mit einem kleinen Bäuchlein, das allerdings keinen Speckgürtel sondern Bauchmuskeln repräsentiert, beherrscht die Technik, die Energie auf den instabilen Punkt seines Gegenübers zu lenken. Schon geringe Mengen bringen die Körperarchitektur gut trainierter Kraftpakete zum Einsturz. Genau um diesen inkonsistenten Punkt des Realitätsgewebes geht es Dir auch. Oder Brecht. An diesem Punkt bin ich vor ein paar Jahren eingeknickt und habe den Rasenmäher Brecht, oder wie wir diese über faule Kredite finanzierte Glücksmaschine – „Die höchste aller Künste ist die Lebenskunst!“ – nennen wollen, in die Garage gestellt, bis Du mit Deinem Begriffsschlüssel diese kleine Epiphanie bei mir ausgelöst hast.
In diesem Kontext sollte Hans Peter Duerr, der Physiker mit dem alternativen Nobelpreis nicht unerwähnt bleiben. Sein Interesse gilt dem Pendel, dass sich auf dem höchsten Punkt entscheiden muss, ob es nach rechts oder nach links fällt. Das ist der Punkt der Instabilität, der Inkonsistenz, der Freiheit und damit der Zukunft. Dass ich gegenüber Gumbrecht und seiner Präsenzästhetik skeptisch bin, hat mit dieser Affirmation der Stauung der Gegenwart, der über unendliche Verschuldung erkauften Stabilität zu tun. Die Gegenwart verbreitert sich doch nur, weil Zukunft blockiert oder verschlossen ist und permanent Ressourcen aus der Zukunft in die Gegenwart gepumpt werden. Inkonsistenz dagegen bedeutet Veränderung, bedeutet Zukunft, bedeutet Fluss. Du plädierst – jetzt brechtisch formuliert – mit Deinem Lob der Inkonsistenz für eine Strategie der Zukunftsöffnung. Das gefällt mir. Nicht weil ich mit der teleologischen Geschichtsschreibung meine, dass der Fluss der Zeit ethisch konnotiert ist, also dem entspricht, was die Sonne des Guten im Raum ist, die ja auch nur eine Fiktion darstellt um die Überlegenheit der begrifflichen Erkenntnis gegenüber den Formulierungen der trunkenen Dichtung zu sichern sondern als Sympathisant der Mimesis, des Poetischen, der Dichtung. Der deutsche Titel des Textes von Jameson lautet übrigens: „Lust und Schrecken der unaufhörlichen Verwandlung aller Dinge: Brecht und die Zukunft“. Jetzt müssten wir über Metamorphose sprechen, das Herz des Theaters, und das platonische Verdikt gegen die Mimesis. Das der Anti-Aristoteliker Brecht im Übrigen teilt, ist er doch vor allem Platoniker. Im epischen Theater sollen die Höhlenbewohner die sozialen Motoren und die Gesetzmäßigkeiten hinter dem wirren Auf und Ab der flackernden Erscheinungen gewahren. Das ist natürlich Platons Ideenlehre. (Mehr dazu würde jetzt und hier das Format der „Denkzeichen“ sprengen.)
Zum Abschluß noch ein Zitat, von dem ich dachte, es ist von Brecht und das ebenfalls mit dem Tao und/oder Heraklit durchsetzt ist, aber von Mao Tse-Tung stammt. „Wälder leben länger als Menschen, aber sogar sie dauern nur ein paar tausend Jahre. Die Menschheit wird schließlich auch untergehen. Wir sollten stets neue Dinge hervorbringen. Wozu sind wir sonst da? Warum wollen wir Nachfahren? Neue Dinge sind in der Realität zu finden, wir müssen die Realität begreifen.“ Oder doch lieber Brecht? : „Nicht eins mit sich sein, sich in Krisen drängen, kleine Änderungen in große verwandeln und so weiter, das kann man nicht alles nur beobachten sondern auch machen. Man kann mit mehr oder weniger Vermittlungen, in mehr oder weniger Zusammenhängen leben.“
Dir das Beste
Frank
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
Ragt sie wie ein Schiff entgegen? Ist es der Bug eines Kriegsschiffs, das denen erscheint, die von der Münzstraße in die Rosa-Luxemburg-Straße einbiegen? Es ragt etwas stolz Beflaggtes, etwas unmissverständlich Spektakuläres und zugleich Unförmiges vom anderen Ende der Straße entgegen. Es erscheint trotz seiner Symmetrie verwachsen, als seien Materialien und Absichten aus diversen Zeitzonen und Absichten verbaut, zerbombt, und wieder zusammengetragen und verfugt worden unter Einhaltung einer Pflicht zur Form, die sich nicht sinnvoll mitteilen kann. Dieses Äußere teilt die Volksbühne mit den Schlachtschiffen, den schwimmenden monströsen Festungen aus der Flotte des wilhelminischen Kaiserreichs. Einer besonderen Flotte. Sie bleibt im entscheidenden Moment in den Häfen, erzwingt das Kriegsende, weil das Volk, die Soldaten auf den Schiffen sich weigern, Mensch und Material zu vernichten.
Der Kaiser versteht das nicht, kann nicht fassen, dass die Flotte – sie ist sein „liebstes Kind“ – nicht als Wunderwaffe einsetzbar ist. Für die fatale Flottenpolitik des letzten herrschenden Hohenzollern hatte Großvater Wilhelm I. eigens eine Stadt gegründet; sein Enkel, Kaiser Wilhelm II., hatte im heimischen Schlachtflottenbau, allein dass die Flotte vorhanden war, die „höchste Befriedigung“ gefunden. Die Flotte betrachtete W II. als „Instrument“, das nicht von „vornherein zum Kampf bestimmt war“. Sie war Ausdruck des Großmachtgefühls. Ihre Verwendung behielt sich der Hohenzoller persönlich vor. Das Volk konnte in den Kriegsjahren in der Schlacht von Skagerrak (31.5./1.6. 1916) erfahren, wie dieses Instrument zur Vernichtung von Mensch und Material einsetzbar war. Die Leichen der englischen und deutschen Marinesoldaten schwemmten noch Monate nach der Seeschlacht an den Küsten an, die Aale waren in diesen Jahren dick gefressen. 1918 verweigerten die Soldaten der kaiserlichen Marine die Befehle zum Einsatz und Auslauf der Flotte. Es heißt im Marinelexikon von Hans Jürgen Witthöft: „Mit der Revolution zerstörte die Kaiserliche Marine sich selbst.“ Die Lieblingswaffe des Kaisers, der diese bei einem Friedensschluss „als noch intaktes Machinstrument ausspielen“ wollte, war also nicht mehr brauchbar.
Unbrauchbar geworden, überlebt, ausgelebt ist die militaristische Denkfigur des Kaisers jedoch nicht. Sie ist motiviert von einer Aufwertung der Kriegsmaschine gegenüber humanistischen Ideen. Diese stabilisierte sich in der Sekt- und Champagnerlaune der preußischen Militärcasinos gegen die Drangsalierung durch eine rigide irrende humanistische Erziehung, die den Kaiser, dessen instabiler Charakter schon früh auffiel, justieren sollte.
Die Ablehnung von überlieferten unreflektierten humanistischen Idealen ist auch als ein Movens der Dirigenten des Raumschiffs der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz identifizierbar. Ihre Frontstellung gegen oberflächlich Humanistisches ist ein Aspekt der Bewirtschaftung der Ruinen des kaiserlichen Großmachtsgefühls, die aber mit einer verkehrten, gegenüber dem Großmachtgefühl verqueren Insistenz operiert, und zwar der Insistenz der Fragestellung: Wie steht es um Mensch und Material? Müssen Steine, Erze, Maschinen wortlos gegenüber Menschen bleiben? Es sind Varianten der Frage: Was ist der Mensch und wie differenziert er sich mittels des Anderen?
Es ist eine Fragestellung, die Kulturtechnik schon bei den Tieren, Pflanzen und Steinen, den Materialien beginnen lässt, mit denen gebaut wird, und das ist auch ein Interesse am Humanen, als einem Etwas, das sich entwickeln kann, seitdem es Instrumente und Gerätschäften gibt, seit denn einfache Instrumente wie der Stock oder das Rad, der artikulierte Laut und seine Formgebung in Versen oder Reden, das Faszinosum eines Binnenbereichs, der Seele genannt werden kann, verhandelbar werden lassen, seitdem Material und Mensch einander bedingend gedacht werden können.
Mit materiellen Artefakten, Gerätschaften ist eine Ausdifferenzierung von Tieren, die Menschen genannt werden können, und anderen, dem Anderen, möglich, zugleich aber auch – und das ist das besonders Menschliche daran – ist eine Auf- und Abwertung von Menschen und Nicht-Menschlichen möglich. Die Diskurse, die an der Volksbühne kuratiert, gepflegt werden, sind solche, die absoluten Aufwertungen des spezifisch Menschlichen widersprechen. Sie bestreiten diese Absolutheiten und erkunden stattdessen relative Bestimmungen: Was den Mensch werden lässt? Und zwar im Verhältnis zu Institutionen, zu Staatsorganen, Gebäuden, Monstern, aber auch schlicht gegenüber den Tieren, die er frisst, den Pflanzen, die er verschlingt, und den Steinen und Ölen, die er verwendet beim Bau von Theatern oder verschwendet beim Bau von Schlachtschiffen, die erst ein Volk brauchen, das ihren Unsinn erkennt. Das ersetzt „Großmacht“ durch „Ohnmacht“, „Absolutes“ durch „Relatives“, Dünkel und Marotten der Macht durch Präzisierungen, mittels Spekulationen, die durch kein Herrscherwort terminierbar sind
Noch einmal zum Kaiser, der seine Persönlichkeit als Herrscher mittels des Militärs und insbesondere der Flotte stabilisierte. John Röhl schildert die Zurichtungen des verkrüppelt geborenen Infanten durch medizinische Korrekturapparaturen und durch einen besonders dichten Lehrplan am Kasseler Gymnasium. Die Begeisterung des Hohenzollern-Kaisers für das Militär wird vor diesem Hintergrund als Leben für eine Wunschmaschine denkbar, bei der das Humanistische einen ungünstigen Stand hat. Die Wunschmaschine, die Materialströme, die das Flottenbagprogramm der Hohenzollern in die Zechen des Ruhrgebiets und in die Schiffswerften von Wilhelmshaven lenkte, hat ihre Begierden in konkreten Gebäuden, Straßenzügen, Hafenanlagen, Schrottbergen und in kommunikativen Mustern materialisiert, die eine Feier und Würdigung der „Normalität“, die Bazon Brock in der Sonntagszeitung anregte, noch für lange Zeit als utopisch erscheinen lassen. Die Steine, die Brocken, die die Wunschmaschine dieses Militarismus in Europa, besonders in Deutschland hinterlassen hat, müssen noch immer auf dem Prüfstand bleiben. Zu untersuchen bleibt, ob und wie absolute monarchische Setzungen, was der Mensch zu sein hat, was menschliche Kultur sein soll, wie diese durch relative Bestimmungen und Differenzierungen abgelöst und produktiv gemacht werden können. Insofern ist der Bug, den die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, der Stadt entgegen richtet, ein Prüfmal. Noch ein Grund für einen Steintag.
Nils Röller: lebt und arbeitet in Zürich. Zuletzt kuratierte er mit Judith Albert, Babara Ellmerer, Yves Netzhammer und Marina Sawall den Steintag des Journals für Kunst, Sex und Mathematik.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
1
Bernhard R.
(Cockfosters, den 16.10. 1944)
mir war befohlen,/ ich soll mich bei Hermann Göring melden,/ und jetzt komme ich da an – / wer nicht da ist, ist der Reichsmarschall/ („Wo ist er denn?“ – „In Karinhall.)/ Karinhall, das ist das Prachtschloß, das größte deutsche Kunstmuseum, das es zur Zeit gibt,/ das liegt in der Schorfheide,/ dort komme ich 12 Uhr hin,/ doch von Brauchitsch, sein Adjutant, sagt mir,/ am Tag vorher wäre eine stürmische Sitzung gewesen übe das Jägertum,/ und auf dieser Sitzung wäre die Milch sauer geworden,/ Milch, das ist der Feldmarschall Ehrhard Milch, der Generalinspekteur der Luftwaffe,/ dessen Stellung wäre erschüttert worden,/ die Sitzung soll fünf Stunden gedauert haben,/ Hermann hätte getobt und gewütet,/ infolgedessen hätte er um 12 Uhr mittags noch nicht ausgeschlafen,/ meine Audienz, die würde man auf fünf Uhr nachmittags verschieben,/ infolgedessen bin ich also durch den diesen wunderschönen Wald gegangen, / habe mir da alles angesehen,/ auch die ganze 2-cm-Flak-Kompanie, die da zum Schutz aufgebaut war,/ und die Bunker, die da überall in den Wald gebaut waren, / und die jungen Soldaten, die da auf den Asphalttrassen das Laub wegfegten,/ habe dann in einem Waldkasino ein gutes Mittagessen gegessen,/ das war an so einem kleinen See gebaut,/ war also ganz nett,/ ein kleines Kasino für den Luftwaffenbaustab, der Karinhall aufgebaut hat, / kurz und gut, schließlich bin ich um fünf Uhr wieder da,/ kriege im Vorzimmer von von Brauchitsch Tee und kleine Schnittchen,/ inzwischen ist es gegen sieben und es heißt , / Sie kommen später dran, die Kunstexperten sind da,/ die Kunstexperten, die ihm,/ aus allen Ecken und Ende irgendwie einen neuen Gobelin,/ ein neues Bild,/ eine neue Plastik oder ein neues Ölgemälde zusammengesucht haben, / die den ganzen Tag , morgens, mittags, abends/ und ihm alles vorführen,/ also hatte ich eine Stinkwut,/ ich war ja mit meiner Fallschirmbuchse feldmäßig angezogen, / doch nun endlich werde ich gebeten,/und das war so,/ ich kam da so herein und da war ein langer Bibliothekssaal,/ vielleicht 18 m lang,/ und an den Seiten hin alles voll Tisch, da eine Sitzecke, da eine Leseecke,/ da wieder Bücherstände,/ da wieder so ein riesengroßes Ölbild,/ während ich also da hereinkomme, kommt durch die andere Tür ganz leise, ganz vorsichtig wie ein Diener – Loerzer, /Loerzer, der so dumm ist, daß ihn die Gänse beißen./ Loerzer, der jetzt „Chef für die personelle Aufrüstung und nationale Erziehung der Luftwaffe“ ist, mit dem Rang eines Generaloberst,/ im übrigen ist der zu faul, seinen eigenen Namen zu schreiben,/ und dann kucke ich und da spielen zwei Mädchen, die Karin und ihre Freundin,/ und dann sehe ich da eine erleuchtete Lampe und einen Sitz,/ und da sitzt dann jemand und ich melde:“/ „Generalleutnant Ramcke, Kommandeur der zweiten Fallschirmjägerdivision/ meldet sich gehorsamst zur Stelle und wieder zum Dienst!“/ und da erhebt sich unter der etwas rosig abgeschirmten Lampe eine Gestalt,/ kommt mit einem Lesebuch, einem Brevier, so in rotem Samt gebunden,/ mit Goldschnitt und einem wunderschönen Ex Libris, das da hereingelegt war,/ kommt vom Sessel aus auf mich zu und ich denke:/“ Ist das nun Nero II. oder ein chinesischer Mandarin?“/ Hermann steht da in einem Mantel, der ihm bis zu den Knöcheln reicht,/ ein weiter, fülliger Mantel aus seidenen Plüschgrün mit aufgedruckten Goldemblemen,/ an den Ärmeln mit vielen Falten gerafft,/ und zusammengebunden mit einem goldenen Gürtel,/ und überall hingen an ihm goldenen Quasten herunter,/ die Füße in seidenen Strümpfen und in Lackpumps/ das Haar onduliert, in Wellen schräg über die Glatze,/ also die Fingerabdrücke vom Friseur konnte man da noch deutlich sehen,/ das Gesicht rosig, voller Öl/ an jeder Hand mindestens zwei, wenn nicht gar drei Ringe,/ und es strömte einem der Wohlgeruch des ganzen Orients und Occidents entgegen,/ „Na, Ramcke, wie geht’s?“/ und damit sackte er wieder zurück in seinen großen Sessel,/ nimmt nun nochmals mit so müder, lässiger, nonchalanter Handbewegung da das kleine Buch,/ guckt noch mal hinein, wie weit er gelesen hat,/ ich nehme indessen Platz in einem der Sessel,/ Loerser, der sich inzwischen auch gesetzt hatte,/ sitzt die ganze Zeit, also ungefähr eine Stunde, nur auf der Stuhlkante,/ doch nun geht s los, nun gucke ich mir ihn noch einmal näher an und denke:/ „Mensch, Hermann, dieser Mantel kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Den habe ich doch zu Hause auf der Stehlampe.“/ das war es – und da mußte ich natürlich doch grinsen:/ „Mensch, Hermann, ich weiß genau,/ wo du diesen Seidenmantel herhast!“/ das war in Taormin,/ da hatte das Fliegerkorps und anschließend die Luftflotte 2, Loerzer, ihr Quartier aufgeschlagen,/ dieses Taormin ist eine alte Burg aus der Hohenstaufenzeit, ursprünglich,/ das ehemalige Kloster dort, das noch imstande ist, war umgewandelt worden zu einem erstklassigen Fremdenindustriehotel, Hotel Domenico,/ und dieses Hotel war einmal das beliebteste Ausflugsziel von allen Amerikanern,/ die sich dort in der Sonne europäischer Kultur usw. baden wollten,/ und dort wurden sie von geschäftstüchtigen Italienern mit neuesten Garderoben alteuropäischen Stils usw. versehen,/ diese Konjunktur ausnutzend hatte sich dort in diesem äh...äh...äh...Taormin auch ein Arschfickerpaar ansiedlich gemacht,/ ein deutsches, der eine war so ein Kunstmaler,/ der anderes so ein Kostümentwerfer,/ und die hatten in der Stadt so ein Geschäft,/ und dort habe ich mir einen Lampenschirm erworben,/ der ist so auf Seide aufgedruckt, /dann auf eine Art Pergament aufgeklebt,/ wenn dann Licht durchleuchtet, sieht das sehr hübsch aus,/ hier sind Schiffe drauf,/ dann ist da rundherum ein stilisierter Baum,/ dann ein Kaiser oder König, hoch zu Roß,/ auf der Hand den Falken,/ dann noch ein Falkner,/ drumherum ein paar Edelfrauen,/ und das wiederholt sich immer wieder,/ und dieses Ensemble,/ das ich zu Hause auf der Lampe habe,/ das hatte Hermann bis unter herunter...
2
Heinz Eugen E.
(Cockfosters, den 28.8. 1944)
an dem einen Abend sprach ich mal mit Himmler,/ er hatte einen Vortrag gehalten und setzte sich abends zu uns an den Tisch,/ da habe ich ihm gesagt,/ ich könne nicht verstehen, daß man gegen die Juden generell/ in so unmenschlicher Weise vorgeht,/ das war etwas riskant, aber Himmler konnte man so etwas sagen,/ er hat erwidert, ich solle mir doch einmal vergegenwärtigen, / wie die Situation wäre, säßen heute bei den Bombardierung/ in allen großen Städten noch die Juden,/ es wäre doch ganz klar, daß durch Ausstreuen von Gerüchten, durch Hetze gegen die Regierung,/ die jetzige anständige Haltung der Bevölkerung mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr da wäre,/ das mußte ich zu einem gewissen Grad gelten lassen...
3
Henry H.
(Mogilew, den 12.10. 1941)
eigentlich scheint es noch ganz hell zu sein,/ doch guckt man genauer hin, da sieht man sie,/ die Dämmerung (wie sie aus den Poren dieser etwas übertriebenen Helligkeit strömt,/ sich über dem Weiß der Landschaft ausbreitet),/ am Stadtrand (dort wo die Straße hinausgeht zu den Äckern und Dörfern),/ sammeln sich die Gespanne und kleineren Kutschen,/ ich sitze auf einer Kutsche auf dem Bock,/ es geht los, wir rollen,/ neben mir auf dem Bock ein Pole mit einer hohen Pelzmütze,/ da tauchen rechts auf einem der grauen Hügel zwei schwarze gleitende Striche auf,/ folgen unserem Wagen,/ jetzt sieht sie auch der Kutscher und dreht sich immer wieder beunruhigt um,/ die Striche kommen näher,/ (ein dritter, ein vierter tauchen auf)/ gleiten, springen,/ und auch das Pferd wird jetzt immer schneller,/ (es herrscht nun fast völlige Dunkelheit),/ unsere unheimlichen Gäste,/ jetzt sind sie ganz dicht,/ (große Hunde, die unser Fuhrwerk umkreisen),/ wie rasend treibt der Pole jetzt die Pferde an,/ da stößt einer der Schatten ein kurzes, röchelndes Bellen aus,/ (das bald übergeht in Jaulen),/ das sind keine Hunde, das sind …,/ da schüttelt der Wagen, das Pferd strauchelt,/ (einer der Schatten hatte einen Sprung gewagt,/war aber zurückgefallen),/ schon wieder schnellt ein Wolf in die Flanken des Pferde,/ ich sehe nun überhaupt nichts mehr,/ fasse nach meinem Seitengewehr,/ wie ich es herausreiße, schwankt der Wagen,/ macht Sprünge, wird durchgeschüttelt,/ das Pferd, (halbtoll) hatte die Straße verlassen,/ stürmt nun über gefrorene Saat zu auf die Eisfläche des großen Sees,/ den Wagen hinter sich herschleifend,/ der schleudert, springt, stürzt,/ wird fortgerissen....
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
Prinzipiell bin ich es gewohnt, zu schreiben, um zu leben. Eine nicht gerade „unterhaltende Gewohnheit“. Außerdem nicht neu, weder originär noch originell. Und dennoch nichts weniger als der existentielle, divers in sich selbst verknotete Maßstab meines Seins. Dazu gehört unter anderem, der weithin feuilletonistisch geschmähten ausschließlich biografischen Literatur ein Denkmal zu setzen. Ich empfinde jede ausgedachte Geschichte als sinnlos. Stehe vor jedem vehikulären Plot wie die Kuh vorm grünen Tor: Lesbar aber ungenießbar – für die Kuh. Für mich unerlebbar. Und da ist er wieder, der Maßstab: die Erlebbarkeit. Dem eigenen Überleben entgegen. Die intellektuelle Ausflucht, sich nur unter der Prämisse des absoluten Jetzt auf autobiografisches einlassen zu können, halte ich für eine Ausrede, um der Geschichte eine Mixtur aus perspektivischem Surrealismus, schönfärberischem Schlussfirnis und über Wasser haltender Distanz anzutun.
Ein Beispiel weit jenseits aller „Peters meines Lebens“: Vom absoluten Jetzt aus, vom Gedenk-Termin des 25. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer aus gesehen, ist es nachvollziehbar das Ekkehard Maaß (siehe: www.ekkemaass.de) behauptet, er habe 1980 in seiner Küche, im Vorderhaus der Schönfließerstr. 21 am Arnimplatz, jenen literarischen Salon ins Leben gerufen, der nun in aller Munde jedes nur erdenklichen Gedenkens und datenwütigen Dokumentierens des Unrechtsstaates DDR, als die Keimzelle des literarischen Untergrunds plakatiert wird. Kein Problem. Denn es dreht sich ja um das Überleben des Ekkehard Maaß als Was-auch-immer plus Bundesverdienstkreuz welcher Klasse auch immer.
Die Geschichte aber ist die: Der literarische Untergrund der Endsiebziger- und Achtzigerjahre der DDR fand in der Lottumstr. 23, in der Wohnung von Frank Wolf Matthies (www.frankwolfmatthies.de) und seiner Frau Pat (der einzigen Petra meines Lebens) statt. Als ich zu einer der Lesungen Ekkehard Maaß mitbrachte, wurde er von meinem zwar zu recht aber dennoch etwas übertrieben paranoischen Freund Frank als IM-verdächtig abgewiesen, was Maaß schwer getroffen und mich keineswegs nur belustigt hat. Der klandestine Geist der 1970er Jahre führte noch zu offen ausgetragenen Scharmützeln zwischen Gleichgesinnten. Wie auch immer, das Ergebnis war mein Vorschlag, einen demgegenüber „offenen“ Salon mit von meinen Dresdener Malerfreunden gestalteten Einladungskarten zu installieren. Ekkehard Maaß’ Küchenlesungen sind demzufolge definitiv die Reaktion auf eine ihn verletzt habende Ablehnung. Ja, das waren noch Zeiten. Und diverse Räume, die schneller als gedacht vorübergingen.
Zwei Jahre später, schwankte eines späten Vormittags Peter der Letzte (meines Lebens) in Wilfriedes und meine Werkstattwohnung im Hinterhaus der Schönfließerstr. 21 (nicht zu verwechseln mit dem Vorderhaus), nannte sich Chappi (geschrieben: Schappy) und verlangte kategorisch, wie es nur gewohnheitsmäßige Mutantrinker vermögen, ich solle ihn und MBH, seinen langen Hallenser Freund, den er eifersüchtig an langer Leine vorführte, in der von mir produzierten Künstlerbuchedition veröffentlichen. Mein Nein traf ihn schwer (siehe oben), aber das Geld, das ich ihn für die Produktion einer eigenen Edition anbot, nahm er gern und versenkte es tief im kurzen Gedächtnis des verletzten Hechts im Elefantenteich.
Und trotz alledem und allem, was Peter Wawerzinek in der Hybris seiner spätpubertären Grenzüberschreitungen, im Brummkreisel seiner biografischen Selbstüberschreibungen und in der Infantilität seiner Ideen über ihn ausschließende Konspirations-Konzeptionen im Prenzlauer Berg der 1980er-Jahre zum Besten gibt, wird mich nichts davon abhalten, ihm zuzustimmen, dass es außer dem unverhältnismäßig eigenen Leben nichts gibt, das einen Absturz in die Kunst rechtfertigen sollte. Denn erst dieser macht auch jenen aus der Kunst möglich.
Bei mir begann es völlig unspektakulär. Im frühesten Frühjahr 1971 standen Peter „Cäsar“ Gläser und ich nach einem Konzert der Klaus Renft Combo nebeneinander vor einer Pissrinne. Nach ein paar ausgedehnt dahintröpfelnden Sekunden hatte ich, nicht mehr ganz nüchtern (siehe: Peter der Letzte), dem nicht mehr ganz nüchternen Gitarristen und Sänger eingebläut, dass ich en masse Gedichte und selbstverständlich auch Liedtexte schriebe.
In den dreißig Jahren bis zum März 2001, als wir uns während der Leipziger Buchmesse ein letztes Mal trafen, haben wir uns noch genau zweimal, und nie ausführlicher als beim ersten Mal, über die Länge von Männerschwänzen ausgetauscht.
Erstens: als wir Ende 1972, ich hatte mich für ein Regiestudium beworben und für das vorbereitende Volontariat bei der DEFA in Babelsberg vorgestellt, den in Leipzig praktizierenden Arzt und Liedermacher Demmler aufsuchten. Ob er zu jener Zeit schon in Berlin lebte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren wir bei einer Adresse in der Nähe des Treptower Parks verabredet, um ihm für einige meiner Texte ein für ihn finanziell attraktives Strohmann-Modell vorzuschlagen. Ich klingelte und Peter, der hinter der Tür gewartet haben musste, öffnete mir. Ich betrat eine unüberschaubar große Wohnung, in der eine Gruppe Minderjähriger Mädchen in als offene Jacken über Nichts getragenen FDJ-Blusen das feierte, was man seit den 1980ern Party nennt und bis dahin eine Fete genannt hatte.
Wir besprachen das Geschäft in der Küche und verpflichteten uns unter Peters breitem Grinsen, das wie immer gleichzeitig eine vierzeilige Staunens-Strophe tiefer Furchen auf seine Stirn schrieb, wechselseitigen Schweigens. Ich notierte in eine Art Tagebuch, das ich seither als Stichwortverzeichnis führte, „realsozialistische Dekadenz“. Was allerdings in keiner Weise mit dem von meinem ältesten Dichterfreund Matthies (siehe oben) schon 1973 geprägten DaDaeR konkurrieren konnte und eigentlich als Gedächtnisprotokoll bezeichnet gehört hätte. Das Wort Päderastie war mir damals ebenso unbekannt wie der Text des Horst-Wessel-Liedes, für dessen Absummen auf der Heimfahrt von der Kartoffelernte ich, Alexander Peter Anderson, der ich, des Englischen unkundig, meine verklemmte Stimme der barocken Melodie von How Great Thou Art geliehen hatte, noch 1968 wieder einmal die Schule hatte wechseln dürfen. Am 10. Januar 1973 gab mein Vater auch meinem Bruder den Namen Peter. Obwohl ich nichts von einer Umkehrung der Verhältnisse in der Zeit halte, müsste ich ihn, meinen Bruder, fragen, ob er einen zweiten Namen hat, und wenn, dann, ob der mein erster ist.
Zweitens: Jahre später, während eines Badeausflugs in den Südosten Berlins, an die Mündung der Dame in den Dolgensee, in dessen unmittelbarer Nähe eine der älteren Schwestern meiner ersten wirklichen Liebe Wilfriede ihre Keramikwerkstatt betrieb, standen wir nackt und steifgefroren im Vollmond und sprachen, bevor wir ins Wärmer-als-die-Luft-Wasser tauchten, noch kurz über Weich- oder Hartholz, darüber, welches für Blockflöten am geeignetsten wäre. Zu jener Zeit hatte ich schon über ein Dutzend Texte für Peter geschrieben und die, die er auf den DDR-Bühnen nicht singen durfte, sang ich derweil unter eigenem Namen in meiner eigenen Band Fabrik. Zwei Jahre später ging ich als ich (und unter dem Decknamen PETERS als „Kundschafter des Friedens“) und Anfang 1989 Cäsar als Peter Gläser in den Westen.
Intermezzo aus den Notizbüchern 1987/1: [thomas brasch liest mir aus’m tagesspiegel die story vor, wo eine 23-jährige kellnerin eines eissalons ihren geliebten, den besitzer, mit einer armbrust erschossen hat. in düsseldorf. paul gratzik erzählt, wie er immer berichte für die stasi schreiben musste, auch über mich, in dresden, und er hat es freiwillig getan, und er spricht von der gerechtigkeit. brasch ist jude und gratzik ein verfluchter protestant, dem keiner glaubt, was er wirklich getan hat. gert neumann hat beim exmatrikulationsverfahren an der lit.-schule in leipzig für den ausschluss von paul, der mit decknamen, sagt er, PETER hiess (vielleicht heisst er in deren akten und papieren noch so), gestimmt. reiner kunze war dozent und hat helga novak attestiert, dass ihre literatur, vielleicht auch ihre gedichte, voller trauer, ein klotz am bein der sozialistischen gesellschaft sind. damals. und die russen, was hatten die mit gerechtigkeit zu tun, wenn der weg von moskau bis berlin 2000 km war, und der scheisswitz mit dem wasserhahn, den man nur in die wand schrauben muss, damit das wasser fließt, wirklichkeit wird. brasch bietet mir einen job in seinem film an und will für mich einen brief an honecker über hermlin leiten, dass ich meine kinder sehen kann. zum schluss, als ich paul/peter zum bhf.-zoo fahre, verrät er mir, dass er sich mal an eine freundin von mir, die ich verlassen hätte, rangemacht hat.]
Noch im Februar 1971 aber war ich, gemeinsam mit dem ein wenig in mich verliebten Maler Peter Glomp, dem ich regelmäßig in seinem HfBK-Atelier auf der Brühlschen Terrasse Dresdens und später, bis eine Woche vor seinem Selbstmord, in der Görlitzer Berliner Straße Modell stand, nach Berlin gereist. Wir hatten, nachdem wir aus einem Schrebergarten bei Birkenwerder (siehe: Festival-Gastfamilie) vor einem Männergeburtstag unter dem Motto „Alle tragen Muttis Mini“ geflüchtet waren, keine Übernachtung gefunden und waren im Hotel International am Alexanderplatz gestrandet. Draußen im Sturm nur Restschnee und Matsch. Ich aber, den meine Großmutter – nicht mein Vater – nach Peter I. benannt hatte, war nach ein paar Wodka-Klub-Kola-seligen Nächten im Haus der Jungen Talente oder im Klub des Oktoberklubs und einer eine halbe Hotelnacht kurzen Affaire mit der polnischen Sängerin Rodowicz herzschmerzkrank weiter und vor einem Nord-West-Tief her weiter und weiter, den keine zweihundert Kilometer langen Weg zurück in die sächsische Heimat geflohen, in der ich, dem Neustädter Bahnhof gegenüber, mich als Aushilfe bei einem Antiquar verdingt hatte, um mich bei vollstem Bewusstsein und vollständigem Unverständnis den Texten des Romantikers Novalis (selbstverständlich den Hymnen an die Nacht) hinzugeben.
Ich war noch nicht achtzehn. Und auch wenn ich als Knabe vor meinem Fremdbild im Spiegel nicht eben Luftgitarre gespielt hatte, wusste ich doch, dass mein unerreichbares Ziel eine Stimme war, die ich nicht hatte. Und weil das Renft-Konzert im Auditorium Maximum des Barckhausenbaus der Technischen Universität Dresden in irgendeinem Zusammenhang mit der tourneeartigen, von der Songgruppe der TU organisierten Nachbereitung des zweiten Festivals des politischen Liedes stand, hatte ich zwar weiterhin keine Stimme, wusste jetzt aber wenigstens, welche.
Kann sein, dass der Paragraph 175 (in der DDR 151), der die Schwulen illegalisierte, 1971 noch einige, weiß nicht welche, Lasur-techniken zeitigte, jedenfalls gingen meine Einsichten in die Kunst der Musik, mir nichts dir nichts, dem drei Doppelstunden dauernden Stimmbildungs-Angebot eines nächsten Peters, diesmal hieß er Zacher, auf den Leim. Der frisch vom Weißen Hirsch herüber in meine unmittelbare Nähe an den Naußlitzer Hang im Westen Dresdens übergesiedelte Musikwissenschaftler (?) legte mir die linke Hand auf den Rücken, die rechte streichelte mir stimmstützend Zwerchfell und Bauch, und ich verliebte mich in die prüfenden Blicke seiner streng kurzhaarigen, wie er kettenrauchenden Gattin, bei der ich, noch las ich nicht zwischen den Zeilen, sondern glaubte jedem einzelnen Wort (war sie vielleicht Dolmetscherin?), zu gern Englisch gelernt hätte. Eines schönen Freitags stahl ich ihm (oder ihr?) eine Schachtel filterloser Zigaretten und verzog mich mit meinem schlechten Gewissen für immer und auf Nimmerwiedersehen um die Ecke (Pesterwitz, Rote Häuser 1) und so weiter und so weiter.
1983 lernte ich über den, wie so viele und drei Jahre zuvor auch ich, nach Ostberlin umgezogenen Philosophen Schulze die in der Leipziger Lindenstraße die Etage über Peter „Cäsar“ Gläser belebende Psychologin Annelie kennen. Sie war, wie unter anderen der Maler Ebersbach, der mir erlaubte, eines seiner Bilder, die am Boden lagen, zu begehen, Mitglied der Aktionsgruppe 37,2. Ich erzählte ihr einen Traum, in dem mir, der ich in einem achteckigen Raum stehe, zwischen meiner zeltweiten, ledernen Thälmannjacke und meinem (nackten?) Rücken – ich erinnere mich nicht mehr wie viele – Gabeln steckten. Selben Jahres gründete Peter Cäsars Rockband, und für ein erstes Repertoire mussten Texte her, die etwas deutlicher waren, als die von Demmler für Karussell, Peters zweite Band, verschlüsselten Anspielungen. Diesmal arbeitete ich unter dem Mädchennamen von Peters dritter Ehefrau Elisabeth. Ich wusste zwar inzwischen eine Menge von mir, aber ich wusste nicht, wie es Peters ältestem Sohn gelang, die Gitarre linkshändig zu spielen, ohne die Saiten andersherum aufzuziehen. Ich habe lange drüber nachgedacht, um dann doch nur, ein klein wenig nach Konstantin Simonow und gleich auf dem sogenannten Örtchen vor Ort den Song Spiegelbild zu schreiben.
Ich bin selten mit zu Cäsars Konzerten gefahren. Vielleicht zehn Mal in all den Jahren. Wenn die Texte geschrieben waren (manchmal bat er mich, obwohl ich auf seine Melodie geschrieben hatte, sie ihm vorzusingen), war es nicht mehr meine Fallhöhe, sondern die der Band. Auch wenn ich damit Probleme hatte. Ich sah mich, während ich meine Texte hörte, auf der sicheren Seite eines Publikums stehen – eingebettet in Stimmung, bestimmt von einem, wie ich es empfand, rein physischen Hin-und-Her. Alles aber, was zwischen Peter und mir war, hatte damit nichts, absolut nichts zu tun. Er lieh mir seine Stimme, ich ihm meinen Text. Aber ich sang nicht und er schrieb keine Texte. Vielleicht haben ich wie er allein deshalb unsere zeitweisen und jeweils unprofessionellen Ausflüge ins Metier des anderen unternommen? Vielleicht habe ich mich belogen, als ich sagte, ich stünde als Sänger mit einer Band auf der Bühne, nur um die Texte zu singen, die jene, für die ich sie geschrieben hatte, in der DDR nicht singen durften. Ich erzähle das, weil es leicht war mit Cäsar. Federleicht. Allem Männerbündlerischen abhold, gab es nichts, absolut nichts, worüber man nicht mit ihm sprechen konnte. Er ist, völlig abgelöst von seiner eigenen Geschichte mit der Staatssicherheit, der gewesen, dem ich meine Geschichte nach einem Konzert vor seinem Fanclub in Wernigerode anvertraut habe. Warum nicht einfach auch, dass ich seine Stimme brauchte. Nichts als seine Stimme. Unabhängig von meinem oder von irgendeinem Text. Hätte ich ihn, nein, hätte ich irgendwen verloren oder nicht für mich, für mein Leben ohne Peter oder Irgendwen nicht gewonnen, wenn ich mich meiner Stimme, dieser permanent textenden Unstimme versagt hätte?
Zurück. Ziemlich weit zurück. Als (in den 1970ern) Peter Hacks Der Dichter dem Schwanze verglichen „Er wird die Gesetze / der Welt nicht sprengen. / Erst darf er stehen, / dann muss er hängen.“ veröffentlichte, war mir sofort klar: Es dreht sich erstens nicht um Verschlüsselung und zweitens mit Sicherheit darum, nicht als Schrödingers Katze zu enden, sondern als Dichter, der erstens nicht über sich selbst spricht und zweitens nur noch aus sich selbst heraus. Und als mich Peter 1998 anrief und fragte, ob ich für Cäsar & die Spieler, seine letzte Band, nach dem fünfundzwanzig Jahre zuvor veröffentlichten Lied Wandersmann unter nun eigenem Namen neue Texte für eine ganze CD unter selbem Titel schreiben wolle, mietete ich mich, wie so oft seit 1993, und diesmal für einen ganzen Spätsommer im alten Kurhaus Masserberg am Rennsteig ein. (Dieses Hotel war eine perfekt gewachsene Mischung aus Art déco und soz. Realismus. Jetzt ist es eine Ruine. Für 79.000 Euro zu haben, Stand: November 2014. Meine Utopie ist, dass es jemand kauft, wie es ist, um es stehen zu lassen, wie es ist – und natürlich auch die Pfropfung von Hain- und Purpurbuche im Garten mit ihrem spektakulär blutkonturierten, lichtgrünen Blatt).
Ich übersetzte Peters vernuschelte Anglizismen ins Deutsche, sammelte Heidelbeeren, die Hertha Machold, die fast neunzigjährige Wirtin (im Haus seit 1926 und, wie ich, am 24. August geboren) auf einem ihrer Kuchenbleche zu einem ihrer weltberühmten Gedeckten verarbeitete, trank aus ihrem behüteten Hotelsilber ihren handgefilterten schwärzesten Kaffee, zählte meine Peters zusammen, kam auf 5 (plus -1 mal 2), meine Lieblingszahl, und ahnte: Dies muss das Ende einer jener ersten Geschichten sein, aus der sich alle anderen wie von selbst schreiben.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
Ganz frisch habe ich angefangen, mich der schwedischen Sprache zu widmen. Und ein Detail das mich dabei von Beginn an besonders fesselte, waren die sogenannten „Empfohlenen Redewendungen“ für jene Alltagssituationen in denen man eigentlich „Nein“ sagen muss. „Das dürfte schwierig werden!“ – „Meinst du?“ – „Möglicherweise …“ All diese Phrasen sind laut schwedischem Wörterbuch einem 100%igen „Nein“ gleichzustellen.
In der Tat: gut zu wissen als Auswärtiger.
Für die Schweden ist es nicht unüblich die Rolle ihrer berühmten Toleranz hervorzuheben, ihre Fähigkeit, Probleme auf friedliebendem Wege zu lösen. Zumindest war es so, bis die ultrarechte “Sverige Demokraterna” Partei während der Parlamentswahl vor etwa einem Monat 13% der Stimmen bekommen hat. Was folgte, war eine Welle der Selbstgeißelung in den Medien. Ich werde jetzt nicht auf der Politik rumhacken, mich interessiert hier besonders der erkenntnistheoretische Aspekt, Problemen aus dem Weg zu gehen. Während meiner zwei Jahre in Skandinavien kann ich mich an keine einzige wirklich hitzige Diskussion erinnern, selbst in Situationen, in denen ich sie bewusst provoziert habe. Susan Sontag sinnierte bereits in den 60ern über diese Fähigkeit der Skandinavier: Ihrer Meinung nach war Stockholm tatsächlich die sicherste Großstadt, die sie je besucht hat. Sie fühlte das sowohl als Frau als auch als Homosexuelle – diese 0%ige Wahrscheinlichkeit während eines Spaziergangs durchs Stadtzentrum zur Rush Hour auf aggressive Art angegangen zu werden. Auch in jeder anderen Hinsicht. Stattdessen wurde sie häufig gestoßen oder angerempelt – die eilenden Schweden schienen sich ganz und gar auf das schmale Fleckchen Asphalt, das unter ihren Füßen mitlief, zu konzentrieren.
Der schmale Grat zwischen Toleranz und Ignoranz. Sozialleistungen schwingen ihren sanften Einfluss durch alle Aspekte des Alltags eines Landes – insbesondere, wenn es um die Kinderbetreuung geht, die ein nervtötendes Thema für den einen oder anderen sein kann. Ist das nicht nur ein Maß an extra Sicherheit in einer sozialen Landschaft, in der es gut möglich ist, dass keiner deiner Nachbarn im Notfall einen Krankenwagen rufen wird? Es gibt einen Haufen Garagen- und Flohmärkte in und um die Stadt – doch hört man nie etwas vom Feilschen, wenn man sie durchkreuzt. Das Feilschen ist insofern kein seriöses Konzept, als dass beide Handelspartner die 100%ige Sicherheit bräuchten, wirklich einen guten Deal zu machen. In bestimmten Ländern mit einer ausgeprägten Feilschkultur könnte es einfach auch ein Weg des subtilen Fragens, ein „Wie geht es dir?“ sein.
Das Feilschen als künstlicher Semi-Konflikt, der einen Dialog heraufbeschwört. Die “Sverige Demokraterna” wurde von den Medien in den vergangenen Jahren mit einer Null-Toleranz-Attitüde angegangen – und nun müssen genau diese Medien mit gut und gerne 30 Vertretern der Partei im Parlament auskommen. „Dialog schützt vor Konflikt“, das wurde uns von klein auf eingeflößt – aber ist es ein wahrlich Buberianischer Dialog, der gemeint war?
Im letzten Jahrhundert hat sich Europa weniger mit Feilschen als mit dem „Einander-aus-dem-Weg-gehen“ beschäftigt – also weit entfernt von dem, was da von Kindesbeinen an gepredigt wurde. Was heißt das für die nächsten Jahre? Da gibt es einige Verbesserungen, die es anzugehen gilt – wir müssen lernen, uns einzubringen. Das wortwörtliche „Tauchen“ in einen echten Dialog erfordert Leidenschaft, echten Glauben an die Sache, Engagement und Aufopferung.
Kontrovers an der Sache ist, dass es für einen echten Dialog manchmal auch des Hasses bedarf.
Aus dem Russischen ins Englische von Pjotr Silajew; aus dem Englischen ins Deutsche von Tariq Bajwa
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
von Marcus Steinweg
Es gibt Idioten, die behaupten, es gäbe keine Idioten. Deleuze wiederum sagt über Foucault, dass er „durch seine bloße Existenz die Unverschämtheit der Dummköpfe“ verhinderte. Foucault verbindet mit Deleuze der unbedingte Glaube in die Kraft der Intelligenz. Faschismus, Rassismus, Sexismus und Unterdrückung allgemein sind Produkte universaler Dummheit. Man wird sie nicht auf der Meinungsebene schlagen. Auf dem Plateau der Meinungen setzen sich die Diskussionen ins Unendliche fort, weil hier alles Denken, insofern es die Unterbrechung der Meinung darstellt, ausgeschlossen ist. Man müsste zu zeigen versuchen, dass Faschismus, Rassismus und Sexismus das Resultat aktiven Nicht-Denkens, statt Ausdruck persönlicher oder kollektiver Ansichten, sind. Es sind Denkfehler von Leuten, die nicht denken, während sie ihr Nicht-Denken in den Dienst einer Idiotie stellen, die in der Intelligenz ihre größte Bedrohung erfährt. Foucault hat – wie Deleuze, wie Derrida – aus seiner Intelligenz, die sich durch exzessive Infragestellung aller Dispostive und Register, Begriffe und Ideologeme etc. auszeichnet, eine tödliche Waffe gemacht. Paul Veyne hat in ihm zurecht einen Samurai erkannt. Seine Bücher seien nicht geschrieben, „um Leser jedweder Couleur wie um einen warmen Ofen zu scharen. Sie sind nicht kommunikativ und nicht geeignet, die Lebensgeister ihrer Leser zu beflügeln. Sie sind mit dem Schwert geschrieben, mit dem Säbel eines Samurai, eines durch und durch nüchternen und grenzenlos kaltblütigen und reservierten Mannes.“ Der Strukturalist, der kein Strukturalist sein wollte, als Samurai! Die Intelligenz, die sich der Idiotie widersetzt, muss gegen sich selbst gewendete Intelligenz sein. Unaufhörlich prüft sie ihre Instrumente und Mittel. Sie hört nicht auf sich selbst zu mißtrauen. Statt sich am warmen Ofen niederzulassen, entfernt sie sich von ihm. Das ist der Hyperboreismus des Denkens, von dem Deleuze mit Nietzsche spricht. Er impliziert das kalte Fieber kriegerischer Intelligenz. „Foucault“, sagt Deleuze, „erfüllte die von Nietzsche definierte Funktion der Philosophie: 'der Dummheit Schaden tun'.“ An anderer Stelle sagt er von ihm: „Er bebte vor Gewalt.“
1. Eine lange Geschichte – man kann sie die des Essentialismus nennen – will, dass das Mensch genannte Subjekt sich seiner Natur entsprechend verhält.
2. Was wir Humanismus nennen, fordert eben dies: Der Mensch soll menschlich sein.
3. Ist er es nicht, fällt er aus seinem Begriff.
4. Doch weiß jedes Kind, dass Unmenschlichkeit zu menschlichem Verhalten und damit zu seiner (faktisch inexistenten) „Natur“ (natura = essentia) gehört.
5. Die Berufung auf die Natur, gehört zu den ideologischen Stereotypen par excellence.
5. Es gibt keinen Faschismus, der kein Naturalismus wäre (so wie es keinen Rassismus gibt, der nicht sexistisch ist!).
6. Vielleicht ist die menschliche Sexualität von der animalischen durch ihren Anti-Essentialismus differenziert.
7. Bestimmte Weisen, „sich in den sexuellen Beziehungen außerhalb der Natur zu bewegen“, könnten Indizien eines nicht-humanistischen Humanismus sein.
8. Im Sex überschreitet das Subjekt seine natürliche Disposion.
9. Es erfindet Varianten der Nutzlosigkeit.
10. Zweifellos sind sie es, die seine faszinierende Widernatürlichkeit konstituieren.
11. Den Gebrauch des eigenen Körpers gegen sich selbst.
12. Die Erfindung erotischer Praktiken jenseits der Mechanik von Zeugung und Fortpflanzung.
13. Die Konstruktion einer metaphysischen Körperlichkeit, die die Phantasie, den Geist und sämtliche Sinne an der Grenze des Sinns (oder des kantischen Reichs der Zwecke) und sogar der Lust kooperieren läßt.
14. Die Kreativität menschlicher Sexualität überschreitet mühelos die Grenzen ihrer eigenen Ökonomie.
15. Sie ist verschwenderisch und anökonomisch, kontradiktorisch und kontingent.
16. So bezeugt sie ihren Austritt aus der Logik des Sinns und der Zwecke.
17. Man kann sie spielerisch nennen und streng.
18. Jedenfalls kommt in ihr zum Ausdruck, was kein anderes Tier als der Mensch vermag: Das Genießen seiner selbst und des anderen in der Erfahrung der Sinnlosigkeit und des Selbstverlusts.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
von Wolfgang Engler
1
„Die Ära des Kapitalismus geht ihrem Ende entgegen – nicht im Eiltempo, aber unvermeidlich.“ Mit diesem Satz beginnt das jüngste Buch von Jeremy Rifkin Die Null Grenzkosten Gesellschaft. Das Internet der Dinge, Kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus (Campus, Frankfurt am Main 2014, S. 9). Der deutsche Untertitel gibt die Intention des Autors missverständlich wieder. Eclipse of Capitalism heißt es im Original, und das bedeutet so viel wie „Verfinsterung“, „Verdunkelung“, nicht „Rückzug“, sondern „Zurückdrängung“ des Kapitalismus durch das Umsichgreifen einer anderen Art, zu leben und zu produzieren.
Rifkin ist weder der erste, der dem Kapitalismus die Totenglocken läutet, noch besitzt er ein Patent auf gerade diesen Sound. Vielmehr handelt es sich um eines von insgesamt drei Szenarien, dem Kapitalismus Grenzen aufzuzeigen.
2
Das erste formulierte am folgenreichsten Karl Marx in seinem Kapital. Das „Spiel der immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst“ verschärfe infolge des Wachstums der siegreichen Einzelkapitale sowie deren Fusion zu immer größeren Komplexen den Widerspruch zwischen ökonomischer Rationalität und gesamtgesellschaftlicher Anarchie, steigere das Ausmaß der Krisen sowie das Elend der produzierenden Masse bis zu einem „Punkt, wo die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit ( ... ) unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert.“i
Die Verwandlung von Privat- in Gemeineigentum ist das revolutionäre Finale der dem Kapitalverhältnis innewohnenden evolutionären Logik. Dieses FINALISIERUNGSSZENARIO fand Anhänger auch unter nichtmarxistischen Ökonomen. In Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie (1950, zuerst 1942) beklagte Joseph Schumpeter die Aushöhlung des klassischen Unternehmertums durch die nämlichen Konzentrations- und Zentralisationsprozesse des Kapitals samt der sie begleitenden Bürokratisierung der Unternehmen, und sah deren (gewaltfrei vonstatten gehender) Sozialisierung gefasst ins Auge.
3
In der realsozialistischen Praxis erwiesen sich die Klippen dieser Sozialisierung als überaus schroff und nur um den Preis von wirtschaftlicher Effizienz, politischer Demokratie und bürgerlichen Freiheiten zu meistern. Das Problem zeitgemäßer Kapitalismuskritik bestand darin, eine postkapitalistische Perspektive unter Aufgabe des Finalisierungstheorems zu entwickeln. Die Lösung erfolgte in Form jenes MARGINALISIERUNGSSZENARIOS, das zuerst André Gorz präsentierte.
Hochspezialisierte Fertigungsprozesse, gestützt auf komplizierte Technik und ausgefeilte Technologie, schrieb er in Abschied vom Proletariat, erlaubten weder eine gemeinschaftliche Inbesitznahme des produktiven Apparats durch die Arbeiterschaft noch unterstützten sie die Utopie des nicht entfremdeten Menschen. Herrschaftsverhältnisse durch Außerkraftsetzung der funktionalen Macht zu überwinden sei eine unlösbare Aufgabe. Es könne einzig darum gehen, die Auswirkungen dieser Macht auf das Leben der Menschen einzudämmen. „Die technologische Evolution verläuft in Richtung nicht einer möglichen Aneignung der Produktion durch die Produzenten, sondern, unter dem Zugriff der Umwälzung der Informatik, vielmehr einer Ausgrenzung der Produzenten, einer Marginalisierung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit.“ii - Die Erweiterung des Spielraums für die Verwirklichung selbstgesetzter Zwecke würde die Bedürfnisse der Menschen mehr und mehr in eben diese Richtung lenken und sie gemeinsam auf eine immer weitergehende Reduktion der der Erwerbsarbeit gewidmeten Lebenszeit drängen lassen. Dabei böten dieselben Technologien, die in den großen Apparate-Komplexen zum Einsatz gelangten, den Individuen die Mittel dar, um etwas zu tun oder zu erzeugen, das Kunst- oder Gebrauchswert genau dadurch gewinnt, dass man es selber tut: „Reparatur- und Eigenproduktionswerkstätten in Wohnhäusern, Stadtvierteln oder Gemeinden, wo jeder nach seiner Phantasie schalten und erfinden kann; Bibliotheken, Musik- und Videosäle; ‚wilde’ Rundfunk- und Fernsehstationen; freie Verkehrs-, Kommunikations- und Austauschräume“.iii
4
Ist das nicht ein wahrlich kühner Vorgriff auf die Infrastrukturen, die Praktiken und Verkehrsformen jener „kollaborativen Commons“, von denen Jeremy Rifkin schwärmt? Ja und nein.
Ja, insofern beide ihr Reich postkapitalistischer Produktions- und Lebensweisen auf einer schrumpfenden Basis kapitalistischer Erwerbsarbeit errichten. Anders als bei Gorz schrumpft diese Basis bei Rifkin auf beinahe nichts zusammen. „Informationstechnologien und Internet ( ... ) schaffen die menschliche Arbeit ab“, heißt es wiederholtiv und apodiktisch; gelegentlich räumt der Autor den Fortbestand kleiner Spezialistenstäbe ein, die die verbleibenden Enklaven renditeorientierter Güterproduktion am Laufen halten. Die weitaus meisten nützlichen und angenehmen Dinge stellen mittels 3-D-Druckern die PROSUMENTEN her, Produzenten und Konsumenten in einer Person, oder erwerben sie im Tausch mit anderen Commons. Sie können das aufgrund der fortgesetzt sinkenden Vorlaufkosten für die dazu benötigten intelligenten Werkzeuge, die im Verein mit dezentral verfügbarer „grüner“ Energie den Aufwand für jede zusätzlich produzierte Einheit gegen Null treiben. So leben sie gesellig, glücklich und im Überfluss; Verbundmenschen, die die Sorge um ihre Privatheit nicht länger umtreibt:
„Das Internet der Dinge (IdD) wird eines Tages alles und jeden verbinden, und das in einem integrierten, weltumspannenden Netz. Natürliche Ressourcen, Produktionsstraßen, Stromübertragungs- und logistische Netze, Recyclingströme, Wohnräume, Büros, Geschäfte, Fahrzeuge, ja selbst Menschen werden mit Sensoren versehen, und die so gewonnenen Informationen werden als Big Data in ein globales neurales IdD-Netz eingespeist.“v
In seinem kürzlich auf deutsch erschienenen Roman The Circle entwirft der US-amerikanische Autors Dave Eggers denselben Vernetzungs- und Transparenzfuror als schwarze Utopie der nahen Zukunft. Wer sich weigert, gleichgültig, ob Normalbürger oder politischer Repräsentant, „transparent zu werden“, mit einer kleinen, allzeit online gestellten mobilen Kamera herumzulaufen, wird gemobbt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder in den Tod getrieben.
5
Was Rifkin grundsätzlich von Gorz trennt, ist die argumentative Lücke, die inmitten seiner, Rifkins, Erzählung der Marginalisierung klafft. Seine Prämissen sind triftig, die Schlussfolgerungen hängen in der Luft.
Alle verfügbaren Fakten sprechen zugunsten eines neuen, kräftigen Schubs rechnergestützter Automatisierung und Roboterisierung.vi Steigende Rechenleistung der Computer, Fortschritte auf dem Gebiet der Sensorik, dezentrales Programmieren, Informationsaustausch zwischen elektronischen Systemen, die voneinander lernen, geben der dritten technologischen Revolution neuen Auftrieb – und das quer durch alle wirtschaftlichen Felder, Zweige und Berufe, Landwirtschaft, Lagerhaltung, Transport, Maschinenbau, Verwaltung, geistige Tätigkeiten gleichermaßen umfassend. Dabei entsteht, vornehmlich in der Forschung, der Konstruktion, der Softwareentwicklung, fraglos neue, höherwertige Arbeit. Die menschliche Intuition, die Fähigkeit, mit Unvorhergesehenem umzugehen, wird ihren Platz behaupten. Qualitätssicherung, die Zurechnung nomineller Verantwortung verlangen gerade bei durchgehend automatisierten Abläufen Personal, das dafür einsteht.
Auch wenn man dies und anderes, den Umbau der gesamten energetischen Basis oder die professionelle Zuwendung zu Menschen in alternden Gesellschaften mit in die Betrachtung einbezieht, muss man die Möglichkeit ins Auge fassen, dass per Saldo und in absehbarer Zeit eine erhebliche Freisetzung an lebendiger Arbeit eintritt, und zwar global gesehen.
Wirft das für die außer Funktion Gesetzten nicht ernsthafte Probleme auf?
6
Bei Rifkin sind sie bester Dinge. Sie produzieren materielle Güter in eigener Regie, erwerben ideelle Güter zu stark herabgesetzten Kosten via Internet, wenden sich ab vom Besitz, teilen Autos, Wohnungen, selbst Kleidung, und tauschen, was sie noch benötigen, miteinander aus; Endspiel der Lohnarbeitsgesellschaft, Endspiel der kapitalistischen Marktwirtschaft.
Nur geht die schöne Rechnung nicht auf, selbst dann nicht, wenn man Rifkin auf seinem Weg folgt. Gesetzt, der Kapitalismus würde durch kollektive Eigenproduktion weitreichend substituiert, so wäre diese Produktion von den Anschaffungskosten für die 3-D-Alleskönner einmal abgesehen, recht aufwändig. Was unten wächst muss oben reingegeben, zuvor am Markt erworben werden, zu desto höheren Preisen, je kleiner die Lose der Gegenstände sind, die da Schicht um Schicht entstehen. Die kommoden Prosumenten werden des weiteren essen, trinken, wohnen, mobil sein müssen, verreisen wollen auch in der realen Welt. Geselligkeit jenseits des Bildschirms, außer Haus, mit Freunden in der Kneipe, im Restaurant, das kostet Geld wie der Kulturkonsum im öffentlichen Raum, desgleichen Kinder, die man großzieht.
Woher nehmen die aus der kapitalistischen Marktwirtschaft Vertriebenen bzw. Ausgewanderten die Mittel zu all dem? Kein Wort dazu. Die dazu komplementären Frage, „was passiert, wenn so wenige Menschen erwerbstätig sind, dass es nicht mehr genügend Käufer für all die Produkte und Dienstleistungen der Anbieter gibt?“vii, beantwortet sich für Rifkin von allein: dann müssen sich die Unternehmer eben mit einem „schwindenden Kundenstamm“ begnügen und auf die Produktion ausschließlich solcher Güter verlegen, die hohe Investitionen erfordern und genügend Rendite versprechen, und deren Umfang Zug um Zug zusammenschrumpft.viii
Die Naivität dieser Ansicht hindert Rifkin daran, ernstlich zu erwägen, dass das dominierende System kollabieren könnte, ehe hinreichend Ersatz geschaffen ist.
7
Zum besseren Verständnis dieser Problematik mag ein Blick auf das dritte Szenario zur Grenzbestimmung des Kapitalismus hilfreich sein – auf das ZUSAMMENBRUCHSSZENARIO. Sein Thema ist nicht die Emanzipation der Arbeiterschaft vom Kapital, sondern umgekehrt die Emanzipation des Kapitals von der Erwerbsarbeit. Wie weit kann dieser Ablösungsprozess gehen, ohne die Fundamente kapitalistischer Reichtumsproduktion zu untergraben? Bis zu welchem Punkt ist das Ideal des Einzelkapitals – möglichst wenig Produzenten, möglichst viele Konsumenten – vereinbar mit den Verwertungsbedürfnissen des Gesamtkapitals? Gibt es so etwas wie eine Grenzproduktivität des Kapitals dergestalt, dass jede darüber hinausgehende Produktivitätssteigerung die Realisierungschancen des erzeugbaren Mehrprodukts am Markt im Maße dieser Steigerung vermindert?
Auf dem Weg zu seinem Hauptwerk sah Marx den Kapitalismus der Zukunft an sich selber scheitern: „Es ist nicht mehr der Arbeiter, der modifizierten Naturgegenstand als Mittelglied zwischen das Objekt und sich einschiebt; sondern den Naturprozeß, den er in einen industriellen umwandelt, schiebt er zwischen sich und die unorganische Natur, deren er sich bemeistert [...] Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muß aufhören die Arbeitszeit das Maß zu sein und daher der Tauschwert [das Maß] des Gebrauchswerts [...] Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhnde Produktion zusammen, und der unmittelbare materielle Produktionsprozeß erhält selbst die Form der Notdürftigkeit und Gegensätzlichkeit abgestreift.“ix
Marx hat diesen Gedanken später wohl deshalb nicht weiterverfolgt, weil er zur Auffassung gelangt war, der Kapitalismus würde reif zur „Übernahme“ sein, bevor er dieses Stadium erreicht.
8
In Die Akkumulation des Kapitals, erschienen 1913, griff Rosa Luxemburg Marx’ ursprünglichen Gedanken auf und schuf eine eigenständige Version des Zusammenbruchs-szenarios. Im Prozess seines Fortschreitens würde der Kapitalismus ein Mehrprodukt anhäufen, das weder die Kapitaleigner noch das Heer der Proletarier zur Gänze konsumieren könnten. Um mit der Akkumulation fortzufahren, müsse sich das Kapital vor- bzw. nichtkapitalistische Milieus notfalls gewaltsam unterwerfen und an den Markt anschließen. Durch diese Hinwendung zum Imperialismus unterminiere der Kapitalismus jedoch gerade jene nichtmonetären Gemeinschafts- und Solidarbeziehungen, von denen er abhängig sei, und trudele also, immer übergriffiger, immer aggressiver werdend, seinem Untergang entgegen. Nur durch einen revolutionären Bruch mit der Kapitalherrschaft könne dieses katastrophale Finale abgewendet werden.
Der Erste Weltkrieg bestätigte Luxemburgs düstere Ahnungen, und dennoch wurde sie im Wesentlichen widerlegt. Was folgte, war der Übergang zum Fordismus, zum Teilhabekapitalismus, und der offerierte für Jahrzehnte eine Lösung des Akkumulationsproblems in Gestalt von Massenproduktion und Massenkonsumtion, steigenden Reallöhne, staatlicher Regulierung und sozialen Statusgarantien für die abhängig Beschäftigten.
An der Wende von den 1970er zu den 1980er Jahren geriet dieses Modell aus hier nicht darzustellenden Gründen von innen und von oben in die Krise.x Die Grenzen des auf dem fordistischen Entwicklungspfad langfristig erreichbaren Wachstums erwiesen sich als unüberwindlich.
9
Die Antwort der Unternehmer bestand in einer Doppelstrategie. Mit tatkräftiger Unterstützung der politischen Eliten wurden die Einkommen der Arbeitnehmer von der Produktivitätsentwicklung abgekoppelt; seither misst die Arbeit wieder mit kleinerem Scheffel als das Kapitalxi, das sich dank deregulierter Finanzmärkte neue Renditequellen erschloss; ein Vorgang, der die Ablösung des Kapitals von der Erwerbsarbeit enorm beschleunigte. Dieser Ablösungsprozess nimmt nun auch in der produktiven Sphäre wieder kräftig Fahrt auf. In je höherem Grade das ökonomische Mehrprodukt aus Finanzmitteln besteht, die den Investitionsbedarf der sogenannten Realwirtschaft um ein Vielfaches übersteigen, je weniger die Arbeit Leistenden von dem Überschuss absorbieren können, desto rasanter muss der Finanzsektor expandieren, um den maßlos gewordenen Renditeerwartungen zu genügen, desto steiler gestaltet sich der Anstieg der Nachfrage (und der Preise) für Firmenübernahmen und immobiles Eigentum. Die Zwangslogik umstandsloser, körperloser Verwertung tendiert zu einer sozialen Aushöhlung des Kapitalverhältnisses: das Kommando über Menschen tritt hinter das Kommando über Sachen resp. Geld zurück. Die Chicagoer Consulting-Firma Cox & Cox prophezeiht eine „Revolution im Management ( ... ) Das Management von Maschinen statt des Managements von Menschen“, die Unternehmensberatung Arthur D. Little „die Emanzipation des Managements von der Arbeiterschaft“.xii
Sollte es dazu kommen: Warum das von der Arbeit abgelöste und von seinen Wucherungen befreite Kapital dann nicht als die neue Allmende betrachten, als gesellschaftlichen Fonds, der von Beauftragten des Gemeinwesens so rationell wie möglich verwaltet wird? Unter gründlich veränderten Voraussetzungen kehrte das Finalisierungsszenario auf die politische Tagesordnung zurück. Das Geld wäre, was es immer und zu allererst war, ein Vergleichsmaßstab, eine Verrechnungseinheit, und fungierte zusätzlich als Anweisung auf Teilhabe am materiellen wie immateriellen Reichtum zu Händen jener Vielen, die nun ausspannen können.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
-------------------------
iK. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Berlin 1977, S. 791.
iiA. Gorz, Abschied vom Proletariat. Jenseits des Sozialismus, Frankfurt am Main 1980, S. 66.
iiiEbd., S. 80.
ivJ. Rifkin, Die Null Grenzkosten Gesellschaft, S. 179.
vEbd., S. 25.
viHierzu im Detail: C. Kurz, F. Rieger, Arbeitsfrei. Eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen, München 2013.
viiRifkin, a..a.O., S. 195
viiiEbd., S. 15, S. 41
ixK. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (1857-1858), Berlin 1974, S. 592f.
xWolfgang Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Frankfurt am Main 2013. Ulrich Busch, Rainer Land, Der Teilhabekapitalismus und sein Ende, Ms. Berlin 2009.
xiEine Rückkehr zur „Normalität“, folgt man Thomas Pickety. Die deutsche Übersetzung seines Bestsellers erscheint unter dem Titel „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ im Oktober 2014 bei C. H. Beck.
xiiZitiert bei Rifkin, a.a.O., S. 182.
von Peter Wawerzinek
Es ist traurig, aber ich weine deswegen nicht. Ich kann so herzlich wenig zu Anderson sagen. Die paar Begegnungen sind Flugasche. Als ich nach Berlin kam, war Anderson schon da. Ich sah ihn im Wiener Café (kurz WC genannt) umringt von weiblichen Groupies. Er trug die Haare zu kleinen Zöpfen geflochten. Man sprach, wenn man über Anderson sprach von Underground und dem inneren Zirkel, zu dem man gehören müsse, um dann zu den besonderen Lesungen in private Wohnungen eingeladen zu werden. Das Boot war echt wohl schon voll, als Matthias Baader Holst und ich künstlerisch in die Stadt einritten. Ich denke, man nahm uns wahr, aber wir wurden nicht hinzugezählt. Man stempelte uns als nichtrelevant ab. Nichtrelevant war nach Underground auch so ein Wort, das ich erst im Duden nachschlagen musste, es zu kapieren. Wir wurden nicht zum Kunststamm gerechnet und sind deswegen auch auf keinem Gruppenfoto zu sehen, das später alle Untergrundkünstler vereint um Anderson zeigte. Irgendwie juckte mich die Ablehnung herzlich wenig. Baader dagegen ballte oft die Faust, wenn er den Namen Anderson aussprach. Er redete davon, dass wir ihn kriegen werden. Dieses „Wir kriegen dich“ galt im Westen für Vergewaltiger. Ich fand den Vergleich unpassend, musste aber dennoch über die Assoziation schmunzeln. Mehr aber auch nicht. Ich fand es auf der anderen Seite sehr bedauerlich, dass Baader sich in diesen albernen Mann so festbiss. Ich habe das Buch mit dem Satelliten, der einen Killersatelliten haben soll, gelesen. Ich konnte mit den Gedichten absolut nichts anfangen. Ich hielt Anderson deswegen für einen Blender und überschätzt. Und wunderte mich, wie wichtig er zum Beispiel von Adolf Endler, dessen bizarre Gedichte ich liebte, genommen wurde. Ich war auch einmal auf einer Lesung von ihm. Das war glaube ich bei den Poppes. Und habe von der Lesung zumindest eine Orange im Kopf behalten. Eine Orange, die auf irgendeinem Tuch oder Teppich lag. Ich weiß noch, dass ich dann, als es eben ganz frisch bekannt war, wie sehr Anderson nebenbei eine bezahlte Plaudertasche war, vorm Café Kiryl mit Penk und Papenfuß in einem Auto saß. Es ging um den Fall Anderson. Penk sprach davon, dass man ihn ja nicht erschießen könne oder so. Der Meinung war ich auch. Ich bekam damals auch die sehr innige Freundschaft zwischen den Künstlern im Auto zu Anderson mit. Da passte kein Papier dazwischen. Er muss dem Penk zum Beispiel früher einmal seelisch sehr geholfen haben. Und Penk war ihm deswegen dann lebenslang sehr verbunden. Es war auch davon die Rede, Anderson bei seinen Lesungen zur Seite zu stehen. Ich staunte nicht schlecht, dass man mich dazu einlud. Gott sei Dank war ich eben Vater einer Tochter geworden. Ich konnte mich mit ihr brav herausreden. Einmal hat Anderson mich zu ein paar Gedichten von mir belehrt. Ganz nachvollziehen konnte ich seine Schulung nicht. Ich stehe für ein anderes Schreiben. Ich habe nicht groß über seine Kommentare nachgedacht, die Gedichte belassen wie ich sie aufgeschrieben hatte. Mehr ist zwischen uns nicht geschehen. Oh nein. Vor ein paar Tagen grüsste er mich im Vorbeigehen mit einem Hund an der Leine. Oh, dachte ich, der Anderson, jetzt hat er also einen Hund dabei.
von Thomas Martin
Ein Sündenbock ersetzt noch immer die Mühsal, sich mit der Herde zu befassen. Zweitens: mit Moral kommst du der Kunst nicht bei, siehe Sascha Anderson. Künstler mit geheimdienstlicher Zweitaktivität leistet sich seit der Oligarchie des ersten Athen jedes System. Die Gründe mögen für den jeweiligen unterschiedlich sein: der Drang zur Macht, die Überzeugungstat, Erpressungstatbestände usw., am Ende ist sich, muß sich jeder selbst der Nächste sein, wenn es ums Dichten geht, Kunst kennt kein Pardon. Für Anderson, der exemplarisch herhalten muß für ein System und einen Berufszweig dazu, sind die Gründe für die Kooperation mit der Macht nur im gesellschaftlichen Kontext der späten DDR und der ihr immanenten Politisierung der Künste zu greifen. Mit jedem Anschiß Andersons, jedem neoanalytischen Anlauf, wird die Gewißheit deutlicher, daß die von Späteren geschriebene Literaturgeschichte ihn nicht als Verfasser von Gedichten, sondern von Spitzelberichten führen wird. Ein Schreibwerkzeug in den Händen der überforderten Macht, und Poesie wird Pseudonym. Jetzt bis Ende Zukunft sind die Exegeten an der Reihe.
Andersons Anstellung als Agent der Macht hat ihm den Weg zum Markt geöffnet, immerhin. Einfluß durch Anpassung, nicht durch Druck, der Markt vom Osten aus gesehen war der Westen, Westen ist derzeit überall, auch der Islam hat seinen. Die subversive, politische Kraft der nicht staatlich sanktionierten Kunst im Kostüm des Pop, des Absurden, des Unpolitischen konnte erst im Druckverband der ideologisierten Republik Ost 1949-89 entstehen. Die Geste des Entpolitisierten, poetisch Abstrakten, schlug um in die politische, schon Enthaltung war Protest. Der ostdeutsche Untergrund, ob Jena, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Berlin, Prenzlauer Berg, Dunckerstraße 23 vierter Stock oder sonstwo, war eine Kunstrichtung, die dadadank Anderson und Satelliten mehr Politikverweigerung etablierte als politischen Widerstand. Die Farce ersetzte die Tragödie, die Codierung der Texte unterm Radar der Zensoren gebar die Groteske. Weniger die Aktion, die Reaktion kam politisiert daher. (Ein Apropos zum Lyriker: die Frage, ob der Stasijob den Literaten ins Interesse rückt oder die Lyrik den Agenten, ist in Andersons Fall egal geworden – ein Gewinn.)
Nichts gegen die Schulmedizin, aber daß ein Charakter, den Novalis als vollkommen gebildeten Willen bezeichnet, in solcher Mann-Macht-Kunst-Verquickung schleichender Depravation unterliegt, wird sich im Gedicht eher als in der Krankenakte lesen lassen. Wenn wir von Kunst reden, reden wir von Politik: Die Erotik des Verrats, die unser Leben so anziehend, so verführerisch macht erzeugt permanent Traumatisierte und zahlende Betrachter. Freund und Feind, Sieger und Besiegter sind hier schwerer zu benennen als in der Liebe. Der IM als kleinstbürgerliche Verräterfigur mag ausgedient haben, die Akten, in denen die Verräter der Gegenwart gelistet sind, verwehn als digitaler Staub. Der Kontakt des Künstlers mit der Macht kann Überzeugung sein und Korruption bedeuten. Andersons literarische Arbeit, die er unentwegt und nachwievor betreibt, ist nicht auf Posten ausgerichtet, nur auf Verdienst. Sein DOPPELLEBEN hat er nicht geschrieben, vielleicht kann er es nicht, jedenfalls ihm solche Arbeit zu verweigern, hieße Sippenhaft in Personalunion, und wer hat das Recht, hier Berufsverbot zu verhängen. Die Aufgabe des Experiments, einen literarischen Betrieb zu stören, der das lyrische Programm letztlich mit der Steuer abschreibt, hieße sich dem Markt ergeben. Anderson hatte die Fähigkeit, sich dagegen zu behaupten, vielleicht hat er sie noch. Seine und aller Vergleichbaren „inoffizielle Mitarbeitertätigkeit mit Feindberührung“ sind in einer historischen Situation entstanden, in der ein anderes Koordinatensystem von Gewissen und Verantwortung galt als heute, wo der Kunst jede politische Äußerung zugebilligt wird und jede politische Äußerung als Kunstaktion verstanden werden kann.
„Was er mit dem Arsch gebaut hat, riß er mit den Händen wieder ein“; sicher scheint: den Schaden hat der Text. Die Literatur diskreditiert bis auf die Knochen, wo das Werk als Instrument genötigt wird, nicht jede gesellschaftliche Konstellation bringt einen Majakowski ans Licht (und um). Das Verbrechen ist nicht die Instrumentalisierung des Autors: Wer schreibt der bleibt, heißt eine Regel im Spiel, das mit Farben, Zahlen und nach festen Regeln ausgetragen wird. Das Regelwerk der Kunst hängt wie ein Mobile im Alltag und Berufsverkehr, befestigt am metaphysischen Punkt, der keine Umkehr möglich macht. Der Autor lügt immer, das Werk kann nicht lügen, nicht betrogen werden, nur interpretiert. Mit Volker Braun gesagt: wäre er ehrlich gewesen, wäre er nicht er geworden.
Alle Rechte am Text liegen bei den Autoren.
horst madde jensen hat sich in seinem schweinestall erhängt. seine frau sagt, er habe den gestank nicht erträglich gefunden, aber zu keinem anderen lebensunterhalt den mut gehabt. dorfpfarrer unseldt betont, das sei kein grund, sich umzubringen.
unser neuzugezogener künstler und neo-landwirt, der schlagersänger jens niemeier, hat am bach eine reihe hutweiden gepflanzt.
johanna meier hat einen neuen traktor.
probleme mit den bienen. sie schwärmen aus und bauen wilde nester in den autos des anliegers joseph anzengruber, der diese zwar nicht benutzt, aber doch, so seine aussage gegenüber der redaktion, gerne jederzeit benutzen können würde.
Sent from my iPad
by Enzo Firenze
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.