

In einem chinesischen Krankenhaus, so konnte man auf YouTube sehen, verließ eine Seele den Körper einer toten Frau. Diese Seele rührte mich zutiefst in ihrer Menschlichkeit, mit der sie zögerlich aus dem Körper kroch, dann einen Moment über ihrer ehemaligen Wohnstätte verharrte, so als wolle sie Abschied nehmen, um sich schließlich mit einem Ruck loszureißen und immer schneller und schneller nach hinten in dem dunklen und ungastlichen Krankenhausflur zu entschwinden.
Die Diskussion der Betrachter entzündete sich an der Frage, ob es sich bei diesen Aufnahmen um eine Fälschung handelt oder nicht, aber ich fragte mich, ob das die wirklich entscheidende Frage ist, denn was wäre gewonnen, wenn man herausfände, dass jemand diesen Film entsprechend präpariert hat oder mehr noch, dass er authentisch ist, so lange es nicht gelingt, die viel entscheidendere Frage zu beantworten, welche Sehnsucht nämlich hinter dem Wunsch steht, eine Seele, das heißt das Wesen eines Menschen, zu erkennen?
Ist es nicht eigenartig, dass der Kampf um Wahrheit und Fälschung, um Beeinflussung und Unabhängigkeit aufs Neue und in zuvor kaum geahnter Stärke entbrannt ist, jedoch beinahe unabhängig, vielleicht sogar ganz bewusst losgelöst von der Frage, welche Bedeutung Wahrheit für den Einzelnen hat? Wahrheit, und das macht sie verdächtig, wird in diesem Kampf als Machtinstrument verstanden und interpretiert, womit nicht ihr Wahrheitsgehalt, sondern vielmehr ihre Zweckmäßigkeit im Vordergrund steht.
Adenauer nahm eine Dreiteilung der Wahrheit vor, in einfach, rein und lauter und sprach an anderer Stelle davon, dass es eine Wahrheit für das Volk, eine für die Regierenden und eine gebe, die er selbst nicht kenne. Zu dieser Zeit schien die Machtstruktur noch in Takt, das heißt fest mit der Wahrheit verknüpft, die gleichzeitig eine spezifische Struktur der Gesellschaft entwarf: Dort das unwissende Volk, hier der wissende Herrscher und über und in direktem Kontakt zu ihm Gott, mit seiner eigenen und unergründlichen Wahrheit. Als Lothar de Maiziere sich nach einem Attentat ganz im Sinne Adenauers äußerte, nämlich dass er im Besitz einer Wahrheit sei, deren Preisgabe das Volk jedoch ängstigen würde, musste er merken, dass der Wahrheitsbegriff der Adenauer Ära nicht mehr so ohne weiteres hingenommen wird.
Geglaubt wird er von weiten Teilen der Bevölkerung allerdings immer noch. Allerdings anders bewertet, denn es heißt jetzt: Es gibt eine von der Regierung für das Volk ausgeteilte Wahrheit, die keine Wahrheit ist, sondern das Gegenteil, nämlich eine Fälschung. Weiter gibt es eine Wahrheit für die Regierenden, das ist bestenfalls eine Halbwahrheit und schließlich die wirkliche unergründliche Wahrheit, von der nur einige Auserwählte im Hintergrund wissen.
Da man von alledem nichts beweisen kann, hat sich der Wahrheitsbegriff verlagert, Wahrheit definiert sich hier ex negativo und bedeutet: Ich weiß, dass alle mir verkündeten Wahrheiten nicht wahr sind, es aber eine Wahrheit hinter alldem gibt, den ich jedoch selbst nicht in der Lage bin zu erkennen. Dieser Wahrheitsbegriff ist folglich ein religiöser.
Man hat beim Betrachten der oft verzweifelt brüllenden und sich jeglicher Diskussionen entziehenden Menschen nicht den Eindruck, dass ihre Wahrheit, so wie es die Bibel verheißt, sie frei gemacht hätte. Es scheint ihnen nicht zu genügen, selbst im Besitz der Wahrheit, genauer des Wissens um eine hinter allen Unwahrheiten existierende Wahrheit, zu sein. Ihre Wahrheit scheint nur dann als Wahrheit existent, wenn alle anderen sie auch anerkennen: Eine Wahrheit, die keinen Widerspruch und keine andere Wahrheit neben sich duldet. Damit teilen diese Demonstranten ihren Wahrheitsbegriff mit den Terroristen, die sich auf den Islam berufen.
Wenn man sich einmal das griechische Wort für Wahrheit anschaut, Aletheia, so ist das Interessante an dem Begriff die Negation am Wortanfang, das a privativum. Wahrheit ist den Griechen demnach das Nicht-Verborgene oder das Unverborgene, wie Heidegger sagen würde. Beharren die Demonstranten auf den Straßen, die als rechts eingeordnet und die Blogger und YouTuber, die als Verschwörungstheoretiker abgetan werden, aber nicht auf einer verborgenen Wahrheit, einer Wahrheit, die versteckt hinter allem liegt? Sie lehnen das Konzept der Wahrheit als einem Prozess der Enthüllung ab, denn allein die verborgene Wahrheit rechtfertigt ihre Intoleranz allem Fremden gegenüber und ihre Wut und legitimiert die Abschottung und Abkapselung innerhalb einer geschlossenen Ideologie. Ihre Wahrheit ist eine Wahrheit, die unfrei macht. Sie haben eine Unfreiheit mit einer anderen vertauscht und wundern sich, dass ihre Wut nicht nachlässt. Ihre Wut soll auch nicht nachlassen. Ihre Wut soll zu keinem Ende kommen. Genau das garantiert ihnen diese verborgene Wahrheit. Diese verborgene Wahrheit, an die sie wie ein Dogma glauben, stattet sie mit dem Recht aus, andere Menschen zu diffamieren und auszugrenzen. Um mehr geht es nicht. Hier ist eine Ideologie der Unterdrückung am Werk, die sich über Fesseln beklagt, doch nicht bereit ist, diese Fesseln abzulegen.
Der Ruf "Lügenpresse" erscheint wie die westliche Variante des "Gott ist groß", das kein Attentäter zu schreien vergisst, bevor er sich und andere in die Luft sprengt. Warum muss Gott eigentlich immer groß sein? Was ist mit seiner Allmacht, wenn sie immer an eine Größe gekoppelt ist? Und warum kann dieser Gott beleidigt werden? Durch wen? Einen Menschen? Einen Ungläubigen sogar? Dann wäre dieser Mensch größer als der zu beleidigende Gott. Es stimmt etwas mit diesem Wahrheitsbegriff und auch mit diesem Gottesbegriff nicht.
Vielmehr scheint es, dass die alten Normen nicht mehr greifen, neue Fragen aber nicht formuliert werden können. Deshalb hält man fest an einer sich durch einen falschen Wahrheitsbegriff perpetuierenden Unterdrückung, hält fest an einer sich durch einen falschen Gottesbegriff als Destruktion manifestierenden Ideologie. Denn die Wahrheit der Wahrheit ist, dass sie in der Regel schmerzhaft ist, bevor sie frei macht.
Deshalb hatte das Bild der Seele, die aus dem toten Körper fährt, etwas Tröstliches, denn diese Seele brauchte nicht die Anerkennung des anderen in ihrer Wahrheit, sondern verschwand einfach im Dunkel des Krankenhausflurs, so wie wir alle eines Tages.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
50 Termini
1. PHILOSOPHIE
Philosophie ist eine Operation am offenen Herzen.
2. SELBSTEINMAUERUNG
Denken heißt der Tendenz zur Selbsteinmauerung widerstehen.
3. WAHRHEIT
Es gibt keine erträgliche Wahrheit.
4. BEREITSCHAFT
Denken beinhaltet die Bereitschaft, sich beim Denken verloren zu gehen.
5. HYSTERIE
Zur Hysterie des Subjekts gehört die Weigerung, eines zu sein.
6. WISSEN
Nur das Wissen zählt, das sich im Medium des Nichtwissens bewegt.
7. REALISMUS
Der Realismus der Kunst wagt zu träumen, ohne Träumereien zu verfallen.
8. TAUMEL
Vielleicht müssen wir Denken nennen, was sich dem Taumel nicht verschließt.
9. SÄTZE
Es gibt Sätze, die durch Wissensverweigerung zur Wissenserweiterung führen.
10. DUMMHEIT
Verlässlichstes Indiz der Dummheit: Unfähigkeit zur Differenzierung.
11. INSZENIERUNG
Statt Konfirmation der Existenz Gottes zu sein, ist Hegels Philosophie protonietzscheanische Inszenierung seiner Inexistenz.
12. WIDERSTAND
Kunst ist widerständig zunächst sich selbst gegenüber, insofern sie sich als problematisch anerkennt.
13. SCHWEIGEN
Das Schweigen ist der Schrei der Kontingenz.
14. VERNUNFT
Vernunftgebrauch ist Vernunftmissbrauch.
15. LESEN
Es gibt keine unschuldigen Leser.
16. ANALYTIKER
Nie hat Gott deutlichere Worte gefunden als im Verstummen des Analytikers, der den wimmernden Narzissten der Wüste des Realen überlässt.
17. REAKTION
Nichts erträgt die politische Reaktion weniger, als die Unmöglichkeit, sich ins Richtige zu retten, das als Ergebnis weltanschaulicher Vereinfachung erscheint.
18. LOCH
Der Andere markiert das Loch meiner Konsistenzen, ihre Brüchigkeit und Labilität.
19. KUNSTWERK
Jedes Kunstwerk weist eine Lücke auf, weil es auf die Lücke im Wirklichen verweist.
20. WAHNSINN
Was wir Denken nennen, ist die Konfrontation eines Wahnsinns mit einem anderen.
21. LÖSUNG
Die Lösung besteht darin, von der Erlösung abzusehen.
22. SCHREIBEN
Schreiben heißt, den geschriebenen Text auflösen, wie es Penelope nachts mit ihrem Gewebe tut.
23. REZIPIENT
Oft fehlt dem Rezipienten die Erfahrung des kreativen Akts.
24. VERRÜCKT
Die Freiheit, verrückt zu sein, gehört zur Normalität des Subjekts.
25. IDEOLOGEM
Nur das Denken, das sich auf der Höhe der Widersprüchlichkeit der Welt bewegt, entschärft sich nicht zum Ideologem.
26. KUSS
Die Berührung, die der Kuss darstellt, evoziert in der Nähe deren Entzug.
27. GUTES GEWISSEN
Das gute Gewissen assistiert der Selbstlüge, die dem Subjekt einredet, es sei intakt.
28. RELIGION
Religion ist Gottersatz.
29. DIFFERENZBEJAHUNG
Aufgeklärte Vernunft ist Vernunft, die um ihre Unvernunft weiß, weshalb zu ihrem Selbstverständnis Differenzbejahung gehört.
30. SINN
Es gibt unendlich viel Sinn und deshalb gibt es keinen.
31. DENKEN
Denken ist nur ein anderer Name für Mut unter den Bedingungen seiner Abwesenheit.
32. SEX
Das Genießen, das der Sex freisetzt, ist Produkt einer Berührung, die noch im Akt gezielter Besitzergreifung (und womöglich vor allem hier), leer ausgeht.
33. ARCHÄOLOGIE
Keine Archäologie, die nicht anarchistisch wäre.
34. GOTT
Wer an Gott glaubt, bekennt sich zu dessen Inexistenz.
35. SUCHT
Nichts Langweiligeres und Konventionelleres als die Sucht!
36. KATASTROPHE
Geboren werden ist schwierig, Subjekt sein gleicht einer Katastrophe, die unaufhörlich scheint.
37. KRITIK
Keine Kritik ohne Affirmation – wie umgekehrt!
38. WOLKE
Es gibt keinen Begriff, der keine Wolke wäre.
39. BODEN
Kein Denken, das nicht bodenlos wäre.
40. LINKS
Linkssein heißt nicht gut sein.
41. SOUVERÄNITÄT
Souverän ist, wer in faktischer Unfreiheit ein Minimum an Freiheit riskiert.
42. SYSTEM
Wer gebraucht wird, gehört zum System.
43. FAULHEIT
Statt Arbeitsverweigerung zu sein, ist Faulheit Existenzverweigerung.
44. HUMOR
Humor ist der Mut, sich durch Entmutigung nicht entmutigen zu lassen.
45. UNMÖGLICHKEIT
Das Subjekt unter den Bedingungen seiner Unmöglichkeit ist das einzige, das Subjekt genannt werden kann.
46. LIEBE
Es gibt Liebe nur als Gespensterliebe.
47. UNWISSEN
Denken heißt, kaum zu wissen, was man tut.
48. EVIDENZ
Keine Evidenz, die nicht auf Nichtevidenz geöffnet bliebe.
49. DOGMA
Künstlerisches Denken bedeutet, Löcher in die Dogmen zu bohren, ihre Hohlheit und Autorität zu demonstrieren.
50. LÜGE
Nicht jeder verdient es, mit gleicher Präzision belogen zu werden.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
Ich weiss nicht, wer so etwas sagte, egal, ich kennte Castorf sehr gut oder wir uns, er mich. Niemals. Nie kennt wer wen gut. Nicht die Spur. Ich habe dagegen nie etwas gesagt, ist mir gut bekommen, dass die Leute es angenommen haben. Was uns verbindet, ist diese Abneigung gegenüber diesem Szenegetue in Berlins Osten. Aber das ist dann auch schon die eine Übereinstimmung und mehr gibt es nicht. Diese Leute, die von sich dachten, sie wären Untergrund. Die störten uns beide, juckten mächtig gewaltig nachhaltig im Hirn. Deren Aktionen, Benehmen, Selbsterhöhung, Fehleinschätzungen und konspirative Lesungen sind mir heute noch Schluckauf, Sodbrennen. Und da war es herrlich, eingeladen worden zu sein, den Pratergarten neu zu bespielen. Die erste Freilichtlesung oder so, hieß das Ding. Ruedi Häusermann weiß ich noch, der schaukelte das Spektakel. Frank Castorf sagte damals dazu: Der Berliner Prater lag in letzter Zeit ein bisschen im Dornröschenschlaf – gegründet 1857, geschlossen 1990, nahe der Schönhauser Allee, tief im Prenzlauer Berg, früher lag das janz weit draußen, jwd. Wir haben den Prater wiedereröffnet mit einer literarisch-musikalischen Performance rund um Peter Wawerzineks Roman "Moppel Schappiks Tätowierungen" – hinter jedem Busch ein Geräusch, ein Schauspieler exklusiv für 70 Zuschauer, inszeniert vom Schweizer Ruedi Häusermann. Wir haben hier etwas ganz Neues gemacht, nämlich den Autor, mich, davon befreit, dass falsche Leute einer Lesung beiwohnen. Bei mir ist ein Wunsch wahr geworden, nämlich, dass meine potentiellen Zuhörer, weglaufen, vertrieben werden. Wawerzinek bedient die Sprache, wir bedienen den Garten und locken Leute mit allen Mitteln von der Lesung weg. Das ist uns gut gelungen. Hier gibt es reale Konkurrenz, kommentierte Ruedi das Ganze damals. Gemeinheit war unsere Gemeinsamkeit. Und da es mir um die Abrechnung mit dem Prenzlauer Berg ging, fühlte ich mich durch den Schweizer Häusermann animiert und bestens aufgehoben. Ich liebte alle Szenen, die mich als Deppen vorstellten. Ja. Ich war von lächerlich aufmerksamen Wächter in weißen Kitteln umgeben, der Irre, der Lesende, der Patient, von dem sie alle denken sollten, er wäre aus der Klapper hierher geführt worden, um mich für ein paar Momente im Prater als Schriftsteller aufzuführen. Es gab andere Weißkittler als die beiden, die mich bewachten, die alle Zuhörer konsequent davonjagten: Der Autor möchte niemanden sehen, schaut er einmal auf, sagten sie zur Entschuldigung. Und ich las beinahe dreißig Aufführungen wirklich achtzig Minuten immer den gleichen Text auf die Sekunde genau vor eben diesen vorzüglich leeren Stuhlreihen. Im Biergarten Prater, wo es an Besttagen laut ist und von Stimmen dröhnend voll zugeht! Was für eine kurze wahrhaft schöne kleine Erinnerung in diesem Zusammenhang, sage ich dir. Und mehr noch. Ich war Mitglied der Volksbühnenbande. Ich durfte Daniel Charms "Elizabeta Bam" inszenieren. Ich liebe diesen Mann. ich mag seine Stücke. Und Herbert Fritsch begann auch mit Charms seine Volksbühnenzeit. Also, was will man mehr. Ich durfte die fünf Schauspieler in eine Telefonzelle sperren und dafür Sorge tragen, dass die Scheiben so bald als möglich von Sprechtext beschlagen. Die Telefonzelle stellte ich eigens mit einem Kran in Brennnesseln, stattete mich als Kellner aus, der durch die brennenden Pflanzen muss, den Weg nehmend, den die Schauspieler auch gehen sollten. Und am Ende bewarf ich sie mit süßem Popkorn, sie verließen die Hütte unter starkem Beifall, mit warmherzigen Zuspruch und eben verunstaltet, verziert mit diesem Popzeugs, das sie alle irgendwie afrikanisch aussehen ließ. Das war mein Ziel. Und danach war ich zweimal Hausautor. Es gab Probleme. Die Schauspieler erkannten mich nicht so richtig an. Sie hielten mich für einen Mann, der nur auf Regie macht, also selber eine Rolle spielt. Sie ließen mich abblitzen. Aber das macht ja erst so richtig scharf. Ich ließ mir einen Trick einfallen. Ich sprach mit einem gewissen Raabe, der sollte mir sein Ohr leihen. Das ging dann so in etwa: Ich flüsterte ihm einen Schwachsinn zu, er übersetze diesen in: Der Schriftsteller Wawerzinek meint, er wollte den Schauspielern endlich einmal was antun, und läßt sich dafür etwas einfallen. Es war großartig. Groß wurden die Akteure dadurch und artig auch. Sie bestimmten einen aus ihrer Reihe, der mir dann sagen sollte, aufzuhören mit dem Theater. Sie würden nicht mehr motzen, sondern auftrumpfen. Ich sagte ihnen nun direkt ins Gesicht, wie ich das Spiel wünschte. Sie schmissen sich ins Zeug. Ich beließ sie trotzdem in der engen Zelle. Sie mussten dort zurechtkommen und damit leben, nur kurze Zeit ansonsten nur noch als Dunstbild zu sehen zu sein. Das war es dann aber auch. Nun dann ritt (im wahrsten Sinn des Wortes kam die Rois tatsächlich auf einem Esel, Maultier, Pferd, Pony, ich weiß nicht was es war, in den Prater) der Schlingensief in die Manege Volksbühne ein. Die Ratten, die vorher die Stars am Haus waren, wurden beiseite gedrängt und flüchteten vornehm vor dem Haufen um Christoph. Aus war es mit dem Sprung ins Bad Prater. Die lieben Gelder wurden umverteilt. Alles diente jetzt der Großkarriere des einen, jupidei. Ich wurde wieder Schreiberling. Ich war so gern in der Kantine der Bühne. Und wenn mein Radaufreund Shortie noch hinzu getorkelt kam, verwandelte sich dieser Ort in ein Irrenhaus, alles wurde irre und also normal. Früh um sechs Uhr sieben, acht, wurde sich auf den Heimweg gebracht. Und ehrlich, ich hatte während es geschah und noch am Laufen war und erst seinen Siedepunkt erreichen würde, schon dieses Grundgefühl, dass es nacheinander immer wieder so schön aus & vorbei sein wird, ehe es explodieren kann. Und das war der Kick, dass es allen klar war, allen gefiel, diesen Umstand zu wissen und zu verdrängen. Nun also ist es soweit, das Ende rückt näher, die Dinge, die längst vorbei sind und noch kommen, haben sich schwer reduziert. Die Namen aber bleiben, die hinter oder vor den Personen stehen, welche ich alle kennenlernen durfte, mir vorgestellt wurden oder vor mir auf der Flucht nicht flehen konnten, sondern ihre Hand reichen mussten. Und im Anflug von Wahn habe ich manches Mal so kurz vorm Einpennen oder Ausrasten gedacht, ich sollte Teil sein des großes Abschiednehmens vom Haus der Ära, den Personen und auftreten wie früher. Nur wäre das ja unglaublich naiv von mir. Es wäre Twin Peaks für Arme als Neueinstieg nach nunmehr auch bald 25 Jahren. Es wäre nicht im Sinne der Erfindung Volksbühne, nunmehr sentimental zu werden, irgendwem und irgendwas nachzutrauern. Und doch sollen so viele wie nur möglich sind, Nachrufe ausstoßen, dass alle, alle spüren wie wichtig die Zeiten waren und gemeinsam gestaltet wurden. Dass Frank Castorf mit dem Gefühl abtreten kann, etwas Großes, Historisches angestiftet und verursacht zu haben. Denn etwas geht ja weiter. Nichts endet, es vollendet sich nur. Obwohl, einen Ruf hätte ich prompt auf der Zunge: Kommt nie wieder ihr tollen Zeiten. Es gab euch doch!
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
3. Juni – 31. Juli 2017
Pavillon der Volksbühne
J. Michael Birn
Die Installation zeigt die Volksbühne im Maßstab 1:20, Teile davon als gebautes Modell, den Grundriß in Sprühkreide auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Im Zentrum der Installation stehen der Raucherhof, der Hintereingang und die Treppenhäuser zur Kantine. Diese Räume charakterisieren das Haus ebenso wie die Hauptfassade, das Foyer oder der Theatersaal, ermöglichen aber eine alternative Lesart der Geschichte des Ortes.
Alle Rechte an Text und Bild liegen beim Autor.
I.
Unter dem Begriff der Kreativität wird vereinheitlicht, was das philosophische Denken traditionell als Gegensätze fasst. Werbung und Kunst zum Beispiel. Für die ästhetische Logik handelt es sich um zweierlei. Die Reklame unterliegt einem Zweck, der darin besteht, Produkte an den Mann zu bringen und Mammon einzuheimsen. Das Kunstwerk aber ist keinem Zweck untergeordnet, vielmehr sieht Immanuel Kant dessen Wesen von einer „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ bestimmt. Sinnlichkeit und Denken werden zugleich stimuliert und ein freies Spiel dieser Kräfte eröffnet, ohne dass ein Zweck dazwischen funkt, der sagt: Kauf mich! Auf dieser Freiheit wird in der Epoche der Moderne die Autonomie der Kunst satteln. Dass diese Autonomie mit der zweckgebundenen Unfreiheit der nicht-künstlerischen Produkte schlichtweg unvereinbar ist, liegt auf der Hand.
Andreas Reckwitz beschreibt wie in unserer Gegenwart das Kreativitätsdispositiv zu einem bedeutenden Gravitationszentrum des globalen Kapitalismus wird. Das Wie der Waren wird im postindustriellen Zeitalter zum entscheidenden Faktor. Ihre attraktive Gestaltung verspricht höchste Gewinnmargen. Creative City lautet der Topos unter dem gegenwärtig die kulturelle Zukunft der globalisierten Städte als eine ökonomische geplant wird. Je mehr Geld im kreativen Sektor fließt, umso vermögender die Stadt.
US-amerikanischer Pragmatismus sortiert den ästhetischen Apparat eines subventionierten Theaters unter der Rubrik Entertainment ins Regal. Dort findet es sich verdattert neben anderen auf Wertschöpfung ausgerichteten Instrumenten wieder. Die von Kant beschriebene Dichotomie wird nicht aufgehoben sondern schlicht eingeebnet oder ignoriert. Unter der weiten Klammer Kreativität lassen sich Volkshochschulen neben Akteuren der verschiedensten Branchen listen, die jene Oberflächenreize triggern, die zum Kauf von diesem oder jenen animieren. Siehe: http://www.kreativkultur.berlin/de/. Wie aber hat man sich, über dieses Portal hinaus, das Feld vorzustellen, auf dem eine zuweilen ruppige politische Kunst mit kommerziell tickenden Akteuren verschaltet wird? Wie kommen Heiner Müllers geschichtsphilosophische Blutgrätschen mit touristischer Folklore zusammen? Konsens herrscht bezüglich des partizipativen Raums, in dem sich die vom Kapital angemahnte Zwangsheirat vollziehen soll. Er hat wohltemperiert zu sein. Freundlich. Soll er doch sozialen Kitt produzieren, wie der Vater der relationalen Kunst Nicolas Bourriaud behauptet, der die Aufgabe der Kunst darin erblickt, die Risse der Gesellschaft – ja was? – zu kitten. Ein glücklicher Raum, jedenfalls mit Gaston Bachelard gesprochen, wo zwischen das Ich und seiner Maske kein Groschen mehr passt. Künstler und Publikum werden wie Anbieter und Kunde durch einen Geist der Komplizenschaft miteinander verschworen. Wie sich auf dieser Fläche eine Ästhetik des Schreckens oder ein mit dem traditionellen Katharsisbegriff ausgestattetes Theater, das Furcht und Mitleid, oder Furcht und Lust erzeugen will, zum Zuge kommen kann, bleibt allerdings rätselhaft. Ausgemerzt werden soll eine Konfliktbereitschaft, die Heiner Müller noch für unabdingbar hielt, um den Kreis der künstlerischen Wahrheit auszuschreiten: “Jedem Autor passieren Texte, gegen die sich ‚die Feder sträubt‘; wer ihr nachgibt, um der Kollision mit dem Publikum auszuweichen, ist, wie schon Friedrich Schlegel bemerkt hat, ein ‚Hundsfott‘, opfert dem Erfolg die Wirkung, verurteilt seinen Text zum Tod durch Beifall.” Ob Künstler, die sich weigern, ihre Produkte als kreative Dienstleitungen zu labeln, langfristig in Creative City zur ersten Reihe zählen, darf bezweifelt werden.
II.
Mein letztes Gespräch mit Bert Neumann drehte sich um das Verhältnis von Theater, Kunst und Markt. Durch seinen plötzlichen Tod konnten wir den geplanten Dialog nicht fortsetzen. Unser Thema wäre gewesen, wann Kunst und Marketing derart ineinander verschränkt werden, das sie ununterscheidbar werden. Nach Aussagen mancher Theoretiker ist das bereits der Fall. Wenn ich Alexander Garcia Düttmann richtig verstehe, ist die Gegenwartskunst ökonomisch imprägniert. Auch Jacques Rancières These, dass die Gegenwartskunst darauf beruht, dass sie die Differenz zwischen Kritik und Affirmation durch ein sowohl als auch ersetzt hat, weist in diese Richtung.
III.
Besucher aus dem Zentrum der Milchstraße, die irgendwann einmal archäologische Feldforschungen auf dem hiesigen Terrain des Planeten durchführen, werden es kaum für einen Zufall halten, dass ausgerechnet ein Kulturstaatssekretär, der aus der Kreativindustrie kommt, das Ende der jetzigen Volksbühne herbeiführte. Entsorgt wird das weltweit bislang singuläre Modell eines vertikalen Theaters. Nicht weil es old school ist, wie die Akteure einer umfassenden Horizontalisierung propagieren, das wäre eher das Theater eines Claus Peymann, eines Peter Stein, einer Andrea Breth oder Alvis Hermanis, sondern weil der Bezug auf das Vergangene überhaupt der Globalisierungselite als überholt oder provinziell gilt. Die Chiffre OST auf dem Dach der Volksbühne tickt analog, so das überstürzte Urteil. Die Außerirdischen wird es kaum wundern, dass gerade an dieser exponierten Koordinate zwei wesensfremde Modelle von Kunst und Kultur aufeinander stoßen.
Was sich rhetorisch als globale Metropolenkunst inszeniert, weiß sich mit dem Geist der Zeit im Bunde. Denn im Gegensatz zu einer diachronen, auf verschiedenen Zeiteben zugleich agierenden Betrachtungsweise prägt der “affektive Präsentismus” oder die radikale Orientierung am Gegenwärtigen die digitale Medialität insgesamt und entsprechend die Subjekte“, so Andreas Reckwitz in seinem Vortrag auf dem Symposium "Endstation Zukunf t"am 08. 01. 2016 in Köln.
Die Verabsolutierung der Gegenwart definiert das herrschende Zeitregime. Dagegen generiert der Bezug auf das Gewesene, auf die Toten, Widerstand. Wo die Präsentation von Präsenz das dominierende Paradigma stellt, legt sich die Vertikale quer. Kunst/Theater wird Korrektiv, wird zu einer Gegenkraft, welche die Risse vergrößert statt schließt. Das Theater muss sich entscheiden, ob es sich auf eine Stimme im Chor der Kreativen reduzieren lassen will, auf einen jederzeit durch Installationen ersetzbaren Akteur im sprachlosen performativen Kanon, oder den Kampf gegen die Vormacht der unendlichen Gegenwart aufnimmt. Herauszufinden wie ein Zeitbegriff aussieht, der aus der Zukunft kommt – dazu ist die Bühne da. Das vertikale Theater ist weder linear noch museal. Im Gegenteil operiert die diachrone Betrachtungsweise parallel mit unterschiedlichen Zeitschichten, zeigt Verbindungen, wo zuvor keine waren, verwandelt das Gewesene in ein Möglichkeitsfeld verpasster, oder auch mutwillig zerstörter Gelegenheiten.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Täglich kurz vor 11 Uhr schlurfen entweder sie oder er, eine große Tasche aus Plaste in jeder Hand, die Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Torstraße hinauf. An der Ecke – der U-Bahneingang über die Straße – ist das Ziel erreicht: die runtergekommene Rückseite des Kiosks. Ware abstellen. Vorhängeschlösser entriegeln. Tür öffnen. Produkte einsortieren. Platz nehmen, die kleine Scheibe öffnen, erstarrt sitzen und warten, bis jemand von vorn in die Scheibe kriecht und eine Schachtel Zigaretten verlangt. Nachdem die Euros rübergewachsen sind, wird die Packung mit sparsamen Bewegungen auf den dafür vorgesehenen Platz gelegt. Das Wechselgeld wird mit geringster Regung der Arme und Hände ausbezahlt. Kein Lächeln. Kein Dank. Blick geradeaus.
Die beiden, die den Kiosk betreiben, offenbar ein Paar – vermutlich übriggebliebene Vietnamesen aus DDR-Zeiten? – erzählen mit ihren unbeweglichen Gesichtern, starren Körpern, schwerem Gang von einem entbehrungsreichen Leben.
Die beiden handeln mit allerhand Krimskrams, alles, was der vagabundierende Mensch braucht: Fahrradschlösser, Wecker, Tabak, Batterien, Zeitungen als Alibi – Alkohol fällt weniger ins Blickfeld, gibt es aber bestimmt. Nacht für Nacht versorgen die beiden Zuspätgekommene, Übriggebliebene, Einsame, Partygänger. Ein Durchlauferhitzer für Ruhelose. Selten bilden sich Grüppchen vor dem Kiosk, die sitzen zehn Meter weiter auf den Bänken. Praktisch.
Ich beispielsweise kaufte an diesem Kiosk meine batteriebetriebenen Wecker für 4 € das Stück. Die halten was aus! Ticken laut, leben lange, Knöpfe und Tasten sind nicht zu verwechseln. Ein Ausweichladen ist bis jetzt noch nicht gefunden, denn es ist seit ein paar Wochen vorbei. Eines Vormittags stand ein PKW neben dem Kiosk. Die Ware wurde verladen – Freunde halfen –, und am Nachmittag war der Kiosk weg und mit ihm das verschlossene Paar mit dem geraden Blick.
Auch wenn man nur daran vorbeigegangen ist, konnte man sich kaum dem stillen Charme dieses Quaders mit dem großen Flachdach entziehen und auch nicht dem standhaften und geraden Blick dieser Augen hinter der Scheibe und der Frage: sitzt da sie oder er?
Zu DDR-Zeiten als Zeitungskiosk für die Frühwerktätigen an der U-Bahn errichtet, führte er in den letzten Jahren vor allem ein Nachtkiosk-Dasein. Darauf haben die beiden gebaut, auf die Dunkelheit und ihre verlockenden Bedürfnisse. Schon älter, haben sie sich die Nächte um die Ohren geschlagen – sommers wie winters – zu unserem Vorteil und zur Sicherung ihres Lebens in Deutschland. Fleißige, stille Menschen, die das Klagen unterdrücken. Wo sind sie? Die Ware war weg, die beiden auch, und der Kiosk ist entkommen, wenigstens im Traum. Eine unbewohnte Insel im Hohen Norden gibt ihm Asyl. Die silbernen Wände des Quaders glitzern in der Sonne und schützen die ansässigen Tiere vor Wind, Eis und Schnee. Vielleicht ist es aber auch eine einsame Gegend im Süden, und Pflanzen überwuchern den Kiosk. Dann kämen die beiden vorbei, noch mit Gepäck beladen, einen kleinen Ziehwagen dabei. Keiner wollte die beiden haben. Sie erkennen sofort, dass unter den Schlingpflanzen ihr Kiosk steht. Jahrelang drin gesessen, warum nicht drin wohnen? Vorn ein Fenster, hinten eine Tür. Vier Wände, ein Dach, und ein Haustier vielleicht.
„Was soll sein?“ liest der Papagei die Gedanken der beiden und spricht sie endlos aus.
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
--
Er hat nie zum Ensemble der Volksbühne gehört, ist nie Mitglied des Marthaler-Ensembles gewesen, hat nie eine Marthaler-Viebrock-Aufführung gesehen, ist Christoph Marthaler nie und Friedrich Luft vielleicht begegnet, ist amtlich seit 55 Jahren tot, hieß Wilhelm Richter, soll hier vorübergehend wiederauferstehen, als Marthaler-Figur, als Volksbühnengänger, als der beinah perfekte Zuschauer, als Besessener des letzten Parketts:
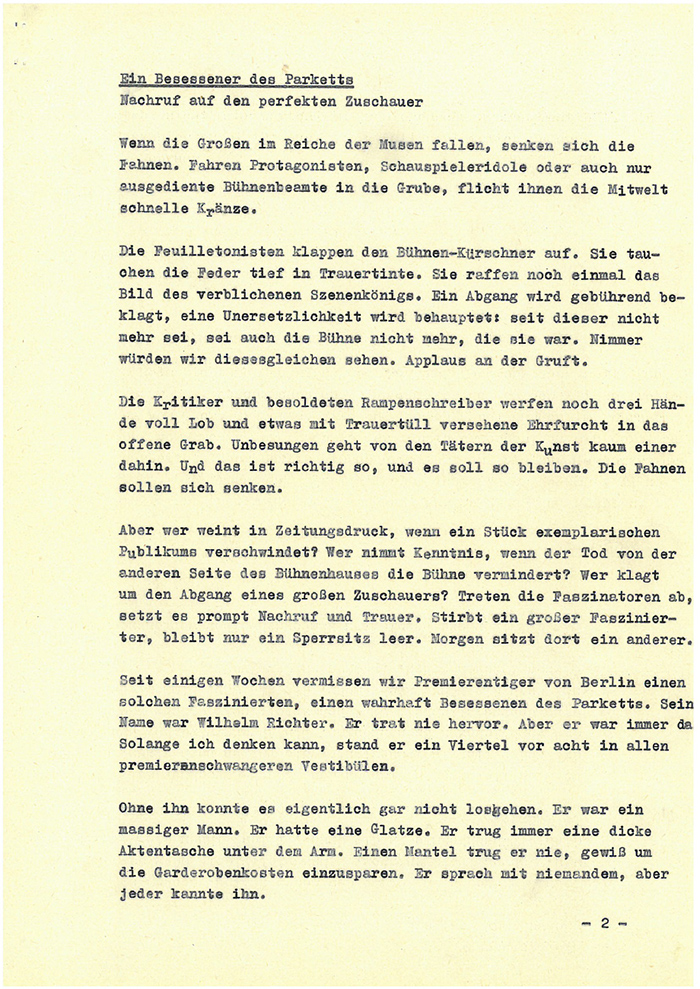
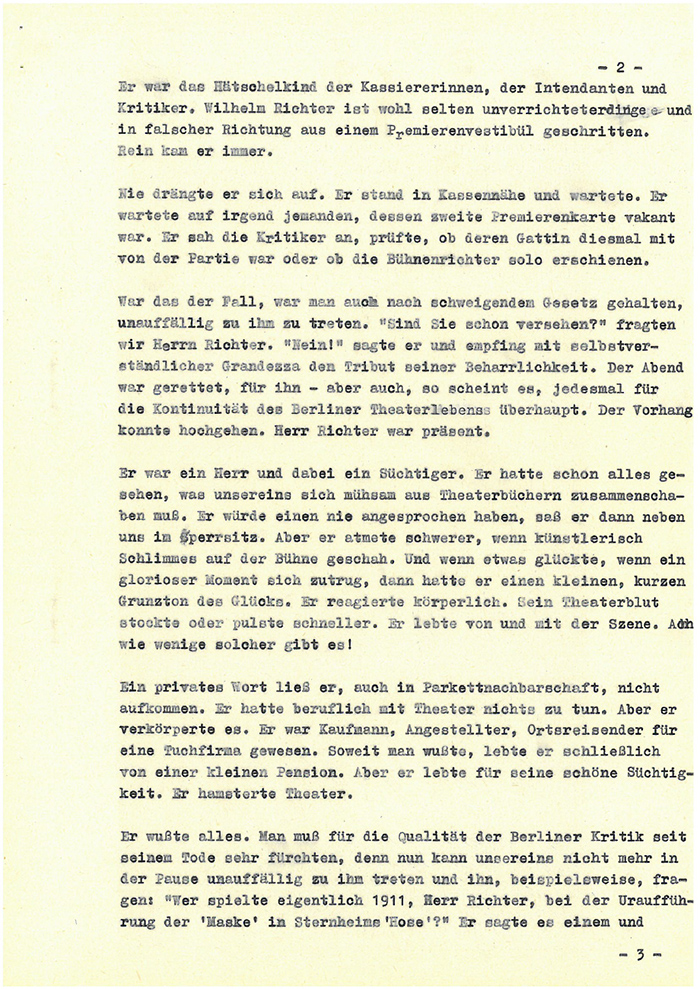
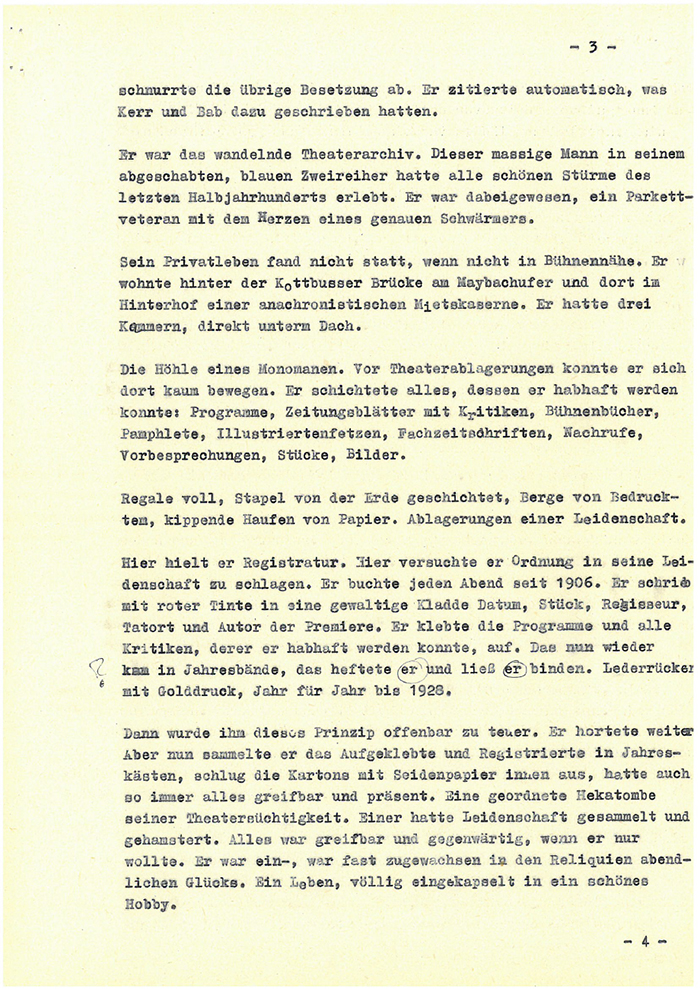
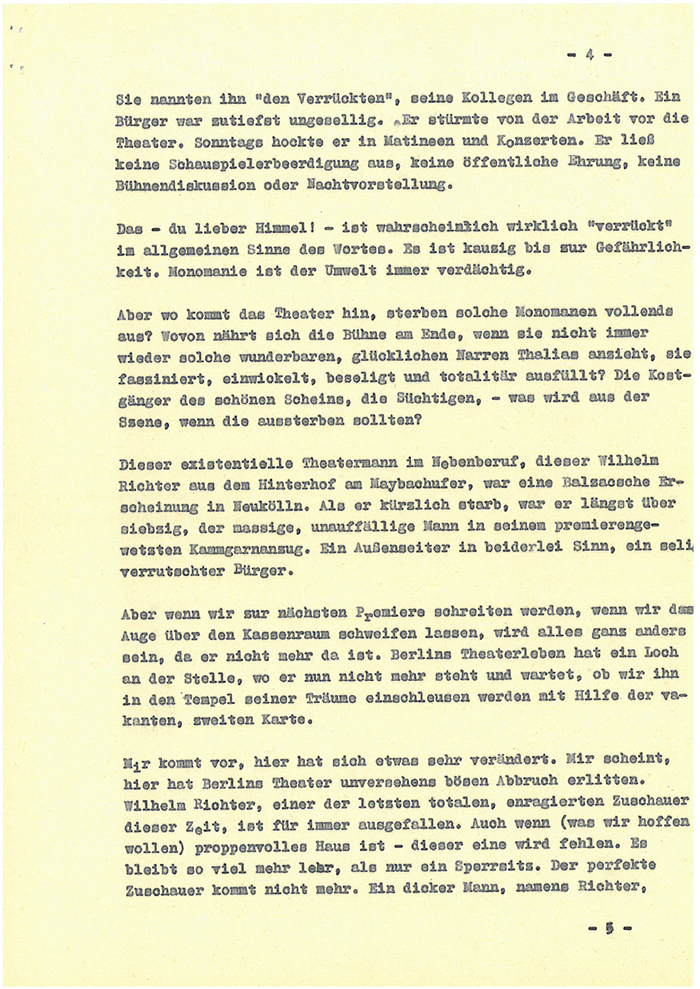
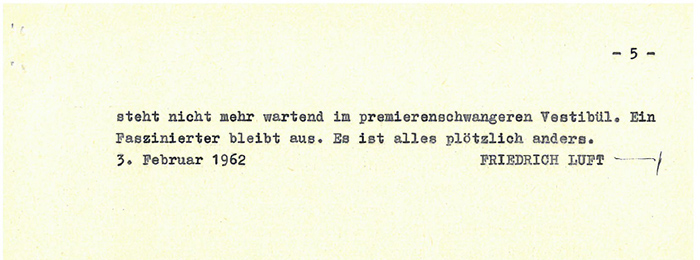
von Christoph Reinhardt
Gestatten Sie mir diese kurze Bemerkung: Sie sehen kaputt aus. Nun, es war ein langes Stück, aber die Nacht wird vielleicht noch viel länger. Denn die Erschöpfung ist gleich verschwunden, warten Sie nur. Ich kenne das. Hat Ihnen die Vorstellung gefallen? Ich kann Ihnen gleich sagen, dass Sie mindestens noch zweimal in dasselbe Stück gehen müssten. Sie werdens aber nicht tun, oder? Haben Sie sich auch über die Stühle aufgeregt? Das ist interessanterweise immer das erste worüber sich die Leute oben im Großen Haus auslassen, bevor die Vorstellung beginnt.
Gestatten Sie, ich heiße Aljoscha. Aus Spaß nenne ich mich so, obwohl ich anders heiße. Der Name gefällt mir. Seine Bedeutung ist mir egal, jedenfalls jene, die man in den Büchern finden kann. In erster Linie bin ich Querulant.
Nein, ich komme nicht von hier. Nein, vielmehr komme ich von hier und da. Wo mag das sein? Lassen Sie mich überlegen, ich bin nicht so schnell. Manche Antwort fällt mir erst Stunden später ein, manchmal brauche ich Tage dafür. Auch verwechsle ich gern Sachen. Einige Leute finden das amüsant. Vielleicht ist das so eine Art Krankheit. Es kann aber auch schlichtweg nur eine Form von Dummheit sein. Ich schweife ab. Nun also, ich sage im Scherz immer gern, es ist nicht der Arsch der Welt wo ich herkomme, aber es riecht so.
Sie haben ganz Recht, bestellen Sie sich erst einmal vorn an der Theke was zu trinken. Den Wein werden Sie nicht mehr vergessen, der brennt sich in Ihr Hirn, das Bier ist für Berlin-Mitte noch recht preiswert. Geben Sie dem Personal aber etwas Trinkgeld, glauben Sie mir, man hat es mehr als verdient.
Was ich hier treibe? Nun, diese Frage gestaltet sich ebenfalls schwierig. Ich hörte sie schon so oft, dass ich meine Antwort darauf schon nicht mehr hören kann. Eigentlich hasse ich Wiederholungen. Wenn es Sie langweilt, dann stehen Sie doch einfach auf, suchen Sie sich eine andere Ecke und quatschen Sie über die Vorstellung. Ich wäre nicht böse, weil ich mich dann weiter an meinem Text versuchen könnte. Es macht mir nichts aus. Nein, ich lese nichts daraus vor.
Ich bin früher nie ins Theater gegangen. Das Schreiben hat mich hergeführt. Die nackte Theorie. Daran ist nur dieser Müller schuld. Den treffen Sie hier immer noch an jeder Ecke. Der spukt draußen unterm Räuberrad rum. Andere auch noch, aber die kennen Sie eh nicht, die klingen für viele wie Gewächse, wie Unkraut, hab ich den Eindruck. Weil zumeist jeder sein Gesicht so merkwürdig verzieht, wenn ich die Namen erwähne. Hören Sie mal genau hin, hier im „Baumeister Solness“, zum Beispiel, tauchen die auf.
Also mir ist es egal, ob Sie an Geister glauben. Ich für meinen Teil tue es jedenfalls. Sonst könnte man das Theater auch gar nicht aushalten, nicht wahr? Das Ganze ist doch im Grunde eine große, subventionierte Geisterbahn. Die Toten, eine Gedächtnisstütze sind die, oder Abstandhalter, jaja.
Richtig so meine Herrschaften, trinken und rauchen Sie. Leben ist tödlich, heißt es so schön in einer Kulisse hier. Ich finde, das triffts. Auf ihr Wohl. Auf den Verfall!
Ich weiß nicht recht, ich glaube Smalltalk liegt mir gar nicht. Das Reden an sich. Den Mund zu halten ist ein großes Talent. Das ist nicht von mir, sondern … na sehn Sie doch selbst. Es dauert wahnsinnig lang bis ich mich mit Leuten unterhalte.
Aber da Sie jetzt nun einmal sitzen, will ich nicht zögern weiterzureden. Sie wollens doch so, das sehe ich. Nur habe ich nicht die leiseste Ahnung wieso.
Als ich hier ankam, sah ich allerlei Gesichter. Es klingt wie der Anfang einer fantastischen Geschichte, ich weiß. Ich kopiere andauernd meine Vorbilder, das nur am Rand. Ich sehe sie schon vor mir, diese Performer die meinen, das kenne man zur Genüge, das sei nicht authentisch. Wie ich dieses Pack hasse. Aber ich rege mich auf. Langweile ich Sie? Wo war ich? Also, je näher ich mich dem Zentrum der Stadt näherte, desto glatter wurden diese Gesichter. Es war ganz merkwürdig. Die waren so glatt und verschlossen; nichts, dachte ich, sollte an denen haften bleiben, nicht mal die Melancholie. Unter diesen Gesichtern gab es furchtbar schöne. So schön, dass ich sie am liebsten den halben Tag lang nur angestarrt hätte. Doch diese Leute sind immer so schnell wieder verschwunden, weil sie andauernd was werden müssen. Sie haben ganz Recht, das klingt ganz und gar verrückt. Ich schau mir gerne Menschen an. Obwohl ich ungerne, wirklich sehr ungerne, länger mit ihnen in Berührung bleibe. Das ist eine Hassliebe denke ich. Und dann, dann lande ich hier. Wo nur Menschen sind. Grotesk. Unterhalte mich doch mit ihnen. Grotesk, sage ich.
Und dann sehe ich auch noch solche Leute oben im Großen Haus sitzen. Die schauen sich um, blicken zu mir, suchen, immer suchen sie. Wenn die nach der Vorstellung sich hier her verirren und nichts finden, dann gehen sie. Meistens nach einer halben Stunde. Ich habe das immer wieder gesehen. Oder aber die bleiben und ihre Gesichter öffnen sich. Ich kann das nicht anders sagen. Sie öffnen sich weil sie hier unten angekommen sind. Dann quatschen die und quatschen die. Auf einmal ist da keine Spur mehr von ängstlicher Eile. Vielleicht kennen Sie das auch. Und zwar, denkt man heutzutage fast immer, man verpasse irgendwas. Hier ist das nicht nötig. Vielleicht passt die Allegorie der Insel dazu. Ja, ich glaube schon.
Ja, Sie haben ganz Recht, wenn sie von mir denken, ich sei ein Voyeur. Ich gebe ganz offen zu, dass ich das bin. Da muss man ehrlich sein. Jawohl. Ein Bekannter sagte mir zur späten Stunde, ich sei gefährlich. Dabei sitze ich doch bloß und stürze meine Sinne in das Stimmengewirr. Wenn ich Glück habe, bekomme ich ein paar Notizen zusammen. Ich erwische mich dann bei dem recht dummen Gedanken, dass es schön sei, endlich nicht mehr nur sich selbst beim Schreiben zu hören. Es ist so beruhigend. Je voller es hier ist, desto besser. Diese Scheißschreiberei, sage ich Ihnen. Auch Sie halten nur zu gerne Ausschau, nicht wahr? Aber, aber, gehen Sie nachher ruhig kurz rüber und gratulieren Sie den Schauspielern zur Vorstellung, wenn es Ihnen gefallen hat. Das Lob stirbt ja aus, habe ich den Eindruck. Es ist der Bewertung gewichen. Einer Sezierung irgendeines nicht bestimmbaren Tieres oder einer Gestalt. Warum sollte man Kunst anhand von Skalen bewerten? Entweder ich finde es gut oder nicht. Eine Freundin meinte neulich, wir sollten alle nach Wien gehen, weil dort Künstler noch geschätzt würden. Vielleicht hat sie Recht. Ich war noch nie in Wien. Sie?
Mal unter uns gesagt: diese Schauspieler haben mich schon so oft gerettet. Ich kenne die nicht, die sehen mich und wundern sich was ich hier immer mache, einige grüßen mich. Aber das ist in Ordnung, ich erfreue mich an ihrer Kunst. An dieser schönen, vergänglichsten Kunst überhaupt. Man kann es nur in Gedanken mitnehmen, es ist mit nichts mehr zu greifen, als mit Erinnerung.
Inwiefern die mich gerettet haben? Das ist natürlich schwer zu beantworten. Vor dem Draußen und dem Drinnen, vielleicht. Ja ich glaube das trifft es. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine das nicht sentimental. Nein, alle leisten sich auf einmal diese Sentimentalität. Wo kommt das denn her? Was halten Sie davon?
Ich finde Sentimentalität schrecklich. Die hat etwas Verlogenes an sich weil man sich selbst was vormacht, sie ist nicht so schön wie die wirkliche Traurigkeit. Kitsch ist das. Sie glauben mir nicht. Über Kitsch lachen sich die Leute hier kaputt. Das ist doch mal was anderes, das kann man gut finden. Die drehen sich weg und feixen sich ganz ungeniert in ihre zuckenden Fäuste. Ein richtig tiefes, dreckiges Lachen. Fünfundzwanzig Jahre drehen die sich schon weg hier. Irgend so ein Schmalhans hatte plötzlich die Faxen dicke. Diese Planer, immer das gleiche. Genug provoziert, was? Na wenn der wüsste. Gut dass wir noch rechtzeitig hergekommen sind, bevor das Ding geschliffen wird.
Denken Sie bloß nicht, die wären hier nicht traurig. Jedes Theater braucht eine gesunde Traurigkeit. Daraus kommt letztlich alles, damit lässt sich was machen. Sonst ist es Vitrinentheater. Dafür braucht es den Spaß an der Traurigkeit. Ein gefährlicher Spaß. Jaja, Sie schütteln mit dem Kopf, das klingt wieder so wirr. Gestehen Sie mir diesen Anflug an Pathos zu. Ich lese zu viel Kleist. Ob ich den Castorf schon mal hier unten gesehen habe? Das wird auch immer gerne gefragt. Einmal ja. Ich saß am Nebentisch und aß Wildgulasch, es hatte einen üblen Hautgout. Jedenfalls, jetzt kommen alle mit ihrer Sentimentalität an. Nee, dann lieber den Untergang genießen. Das Scheitern gleich mit. Ein Schauspieler sagte zu mir: „Jetzt erst recht, jetzt spielen wir nochmal richtig bis zur Erschöpfung und reißen die Bude ab. Immer weiter, immer weiter.“
Das ist ja eigentlich kein Ende. Das hört nicht auf. Oh ja, es geht immer weiter mit dem Theater. Jetzt braucht man damit nun auch nicht mehr aufzuhören. Wenn wir ehrlich sind, dann hat das Stadttheater ja so vieles nötig, Sentimentalitäten gehören ganz gewiss nicht dazu. Die gibt es im Fernsehen zuhauf, vom Kino will ich gar nicht erst anfangen. Ich hörte einmal draußen vor der Tür eine Frau sagen, das Kino sei tot, im Fernsehen liege die Kohle. Da müsse man hin. Mag sein. Trotzdem ist es langweilig, weil man dort immer alles begreifen soll. Aber das wissen Sie ohnehin.
Und, bitte, entschuldigen Sie mich jetzt. Ich habe genug von Ihnen und da drüben ist gerade ein Tischchen frei geworden. Seien Sie mir nicht böse wenn ich jetzt sage, dass Sie ganz schön besoffen aussehen. Aber die Müdigkeit ist verflogen, wie ich sagte. Kommen Sie gut durch die Nacht und sollte ich Sie mit meinem Gerede überfordert haben, seien Sie gewiss: es war meine volle Absicht.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
von Steffen Greiner
Ich habe wieder South Park gesehen. Es war merkwürdig und schön. P. C. Principal hat Principal Victoria als Schuldirektor abgelöst. Menschgewordene Werbung bezirzt die Boys in Person der neuen Schülerin Leslie, um die Welt zu gentrifizieren. Caitlyn Jenner ist, unter Mr. Herbert Garrison, Vizepräsidentin der USA, und dank allgemeinen Waffenbesitzes ist Friede auf Erden und unter den Menschen. Traurigerweise war ich heute auch bekiffter als früher, aber daran lag es nicht, dass ich einen harten Einstieg hatte. Ich verstand die wichtigste Fernsehsendung meiner Abiturzeit nicht mehr.
South Park war immer schon die völlig drübere Variante einer Mainstream-Comedy. Als mit George W. Bush in den USA ein wiedergeborener Christ im Weißen Haus saß, war Jesus in South Park eine tragende Figur, Saddam Hussein der manipulative Ex-Lover von Satan und die katholische Cartoon-Kirche in einen ernsthaften Missbrauchsskandal verwickelt. Dennoch war alles irgendwie nachvollziehbar. Alles ging seinen Gang, meistens mit der Machete in die traurige Realität geschlagen.
Als South Park anfing, endeten gerade die 90er Jahre. Die waren noch halbwegs nachvollziehbar. Dann kamen die schwarz-weißen frühen Nullerjahre, die eine Gegenwart einläuteten, die lange Zeit nicht als Ära charakterisierbar war. Mit der jetzigen Explosion der Realität hat sich scheinbar auch der anarchische Witz der South Park-Autoren noch weiter von jeder Struktur losgelöst.
Als schlugen die Episoden und Charaktere immer weiter gestreut, immer kräftiger aus, je ungreifbarer Publikum, Gesellschaft und Heute wurden. Als müsste man dem Wahnwitz immer ein Stück voraus sein.
Ich beneide die heutigen Abiturienten, die mit diesem South Park aufwachsen dürfen. Vielleicht sind sie viel natürlicher im Umgang mit dem, was ich und die Menschen mit Geburtsjahrgängen in den mittleren Achtzigern uns hart erarbeiten mussten: dem post-narrativen Erzählen. Denn dass ein streng durchkomponierter Plot nicht in der Lage ist, „die“ Wirklichkeit glaubhaft zu machen, das Chaos von Welt und Ich — das haben wir zwar gespürt, aber doch nie anders gekannt.
Das Verflüchtigen des Realen ins Digitale wurde von antik erzählten Epen begleitet. Wir sind die Generation Harry Potter, Kinoereignis: „Herr der Ringe“. Dass es ein Anderes gab, jenseits des erzählten Subjekts und des sinnhaften Spannungsbogens, mussten wir in Seminaren aufdröseln, genau wie die Generationen vor uns in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren es mussten: Barthes, Butler, Foucault, Deleuze hatten wir als erste Zeugen, mehr brauchten wir weißen Heten in diesem Land auch erst einmal nicht, um uns zu verunsichern.
Aber erst, als 2009 innerhalb weniger Monate zwei Werke in deutscher Übersetzung erschienen, die das alles auf einmal in Kunst packten, wurde klar, wie weit über die intellektuelle Übung hinaus es reichen konnte: David Foster Wallace wurde posthum mit dem fast schon zum autonomen Sprach-System gewordenen 1.500-Seiten-„Roman“ „Unendlicher Spaß“ zum Sprecher einer Generation, für die er nicht schrieb – das Original ist von 1996 – und Roberto Bolaños „2666“, ebenso posthum erschienen, zum Beweis, wie Leser die Bücher selbst in ihrem Lesen schreiben.
Dass es nach Auschwitz keine wohlklingenden Gedichte mehr geben durfte, erschien mir immer irgendwie nachvollziehbar. Warum Adorno Romane, die dem Faschismus doch viel näher stehen in ihrer Sinn-Diktatur, nicht ebenso abkanzelte, war mir nie ganz klar. Das mit dem Roman hat Wallace dann erledigt. Für mich war „Unendlicher Spaß“ ein Rite de Passage hin zu einem anderen Lesen. Literatur, die nicht unlesbar ist, begegne ich seitdem mit Misstrauen.
South Park ist vermutlich ein Kind solcher Denkweise. Wir haben die Narration enttarnt, weil die nacherzählbare Wirklichkeit sich von Wirtschaftsblase zu Wirtschaftsblase selbst als Fiktion enttarnte. Es war vielleicht nicht gerade leicht, aber oft genug notwendig, die eigene biografische Erzählung aufzugeben, wenn gerade eine Dotcom-Blase platzt und mit ihr die Lebensentwürfe von tausenden Aktionären und Jungunternehmern scheitern. Auch das Aufgeben der Narration aus subjekt- und herrschaftskritischer Haltung heraus ist eine Machtergreifung des Subjekts über seine eigene Identität. Wer sagt: „Ich höre jetzt auf zu erzählen“, ist schließlich meistens noch mittendrin. Die Geschichte vom Ende der Geschichte ist eine Geschichte. Und es war richtig, diese Geschichte zu erzählen. Aber es ist vermutlich, obwohl man sich kaum in die Reihe solcher Kritikern stellen mag, auch richtig, dass dadurch eine mächtige, sehr moderne, alte Erzählung die Lücke gesellschaftlicher Fortschritts-Erzählungen besetzen konnte.
Ich bin froh, mir die Menschheitsgeschichte nicht als eine Erlösungsgeschichte durch Klassenkampf vorstellen zu müssen. Trotzdem wäre ich froh, wenn die Generation Post-Narration, für die der Verzicht auf die Erzählung selbstverständlicher und darum weniger identitätsstabilisierend ist, vielleicht wieder in der Lage wäre, eine neue Narration zu entwickeln. Als Gegenerzählung zu den zu einfachen, die sich wieder durchsetzen. Vielleicht aus dem Spielerischen heraus, das dem Post-Narrativen eigen ist. Den Ansatz eines ironisch-politischen Mythos, mit dem Donna Haraway in den 90ern von den Cyborgs berichtete, weiter zu verfolgen, stelle ich mir produktiv vor: einen, der Erzählungen auf eine Art treu ist, die blasphemisch ist und ihnen gegenüber ganz und gar nicht unkritisch. Aber sie gerade darum so ernst nimmt. Den Anarchismus von South Park weiterzudenken und ins echte Leben zu übersetzen, darin könnte der Funke liegen, für einen Anfang.
von Fabian Ebeling
Trümmer*
Eine Kamerafahrt durch das zerstörte Berlin, 1948. Schutthaufen, Stein, Staub, ein paar Menschen stehen herum, fahren auf Motorrädern vorbei. „Germania anno zero“, Roberto Rossellini, italienischer Neorealismus. „Aber es ist eigentlich zu Ende. Etwas ist nicht mehr in Ordnung“, schrieb Gottfried Benn, schreibt Philipp Felsch in seinem „Langen Sommer der Theorie“.
Nirvana spielen zwei Tage nach dem Mauerfall im Schöneberger Ecstasy, am 11. November 1989 also. Kurt Cobain zerschlägt seine Gitarre. Nirvana sind mit TAD auf Tour, die letztens Alben wie „God’s Balls“ bei Sub Pop wiederveröffentlichten. Der dicke Sänger, Tad Doyle, blättert im überfüllten Tourbus durch ein Pornomagazin und sagt Sachen wie „Scheiß mich voll“. Die Russen sind seit Februar nicht mehr in Afghanistan, leere Panzer, gehäutete Soldaten, Kalaschnikows und Taliban. End of story. Gorbatschow, Glasnost, kaputte Sowjetunion, Francis Fukuyama, US-amerikanischer Politologe und einstiger Vordenker der Neocons, findet: Demokratie und Kapitalismus? Freie Fahrt! Wohlstand für alle! Geschichte? Vorbei.
“There are strong indications here at the Pentagon that this war may be beginning right now. And that the President may be going on television later this evening to explain what exactly is going on”, Wolf Blitzer, Military Affairs Correspondent, live aus dem Pentagon, CNN, 16. Januar 1991. Schalte nach Bagdad, am Telefon John Holliman, in der Nacht ist Gewehrfeuer zu hören, Krieg in Echtzeit, Krieg im Fernsehen, F16-Kampfflugzeuge in Formation und über brennenden Ölfeldern, Nachtsichtaufnahmen von Raketen, die in Gebäude einschlagen, kein Ende der Geschichte, wenn Geschichte Krieg, Konflikt und Kampf und Zerstörung und all das bedeutet. Sie verschiebt sich jetzt, an die Peripherie der kapitalismus- und demokratiebefriedeten Welt.
Ich mache gerade einen After-School-Mittagsschlaf, als mich meine Mutter weckt. Ich sehe Ulrich Wickert im Fernsehen, ich sehe, dass ein Turm fehlt, ich sehe, dass der zweite fällt. Staubschwaden drücken sich durch die Stadt, es ist grausam und geil. Ich gehe zum Fußballtraining, ein guter Freund fährt mit dem Auto vorbei, er ist sonst nie auf diesem Weg, zu dieser Zeit. Jemand kommt dazu und fragt: „Steht das Weiße Haus noch?“ – „Ja, das Weiße Haus steht noch.“ Aber auf dem Pentagon ist einer gelandet. Wrackteile liegen da rum. Hektische, verzweifelte Anrufe aus einem sinkenden Luftschiff, letzte Grüße, I love you.
Ein surrender Drohnenflug über Aleppo, 2016. Ein mit klassischer Musik unterlegter Drohnenflug über Aleppo. Ferngesteuert, weil Reporter und sonst eigentlich auch alle anderen Menschen lieber nicht dorthin sollten. Kaputte Häuser und Straßen, ein paar Autos fahren herum, so gut es geht, die Drohne liefert sauber-sterile Aufnahmen.
Geschichte: Menschen, besonders Männer, machen im großen Stil Sachen und andere Menschen kaputt, schaffen Nullpunkte, oder: Menschen, besonders Männer, unterzeichnen vielleicht einen wichtigen Vertrag, ein Papier, eine Erklärung, fangen neu an.
* Jede Alterskohorte, überall, hat ihre Trümmerhaufen, zerstörte Gebäude und Städte, und jeder kann sich ein gutes Bild davon machen, darüber lesen und reden, Storys dazu hören. Sie, die Historie, ist immer auch Narration, Bild, Text, ein Phänomen der Medienkultur.
Konstruktionen*
“It’s not the truth I see, it’s just a mockery.” Greg Sage, The Wipers, “Over The Edge”, 1983.
„Während so viele Generationen, und besonders die letzte, im Laufschritt der Geschichte gelebt haben, in der euphorischen oder katastrophischen Perspektive einer Revolution – hat man heute den Eindruck, daß die Geschichte sich zurückgezogen hat, einen Nebel der Indifferenz hinter sich zurücklassend, durchquert zwar von Strömen, aber all ihrer Bezüge entleert.“ Rückdeckeltext, Jean Baudrillard (1929–2007), Agonie des Realen, Merve Verlag, 1978.
“The image or copy is all that exists. People experience a simulated sense of reality, of representations of reality, rather than reality itself. And they are no longer concerned with the disconnection from reality. In fact, in the postmodern condition, Baudrillard argues, the simulation surpasses the real and society begins to produce images of images, copies of copies.” Youtube-Vortrag, COLT 360, im Herbst 2015.
„So ist zum Beispiel die Idee der Geistesgeschichte, also der Geschichte, wie der Geist zu sich selbst gekommen ist, bankrott. Das ist meine Erzählung. Sie ist bankrott wegen zweier Weltkriege und ihrer Folgen.“ Jean-François Lyotard (1924–1998), irgendwann zu „La condition postmoderne“ von 1979. Eine „Crise des récits“, die Krise der Erzählungen, der Erklärungsmodelle aus Wissenschaft, Philosophie stellte er fest. Das „post“ in postmodern meint also auch Skepsis.
„Ich glaube nicht an die Zwangsläufigkeit von geschichtlichen Entwicklungen – zum Beispiel habe ich nicht an den endgültigen Sieg der Demokratie geglaubt, als Fukuyama vom Ende der Geschichte schrieb.“ Wolfgang Schäuble, Die Zeit, 21.12. 2016. Okay, also hinterher ist ja jeder schlauer. Aber.
Wenn Geschichte auf ein Telos zuläuft, ein Ziel hat, wenn es einen deutschen Sonderweg gab, der direkt ins Dritte Reich führte, wenn die Geschichte den Zweck hat, der Demokratie oder dem Kapitalismus den Weg zu bahnen, um dabei obsolet zu werden, wenn sie sich immer auf etwas hin entfaltet, wenn Ereignisse eigentlich nicht mehr stattfinden, weil es zu viele Kopien von ihnen gibt, und wenn die Geschichte dann trotzdem weitergeht, dann hört sie nicht auf, weil sie immer auch gemacht ist. Die Geschichte hat kein Ende, sie hat Zustände. Sie hat Dürren, Hungersnöte, Erdbeben, Zeichen der Zeit, Mythen, die lesbar sind.
Ende der Geschichte: Menschen, besonders Männer, finden Gründe dafür, warum sie vorbei sein sollte und warum deswegen neu angefangen werden muss.
* Jede Alterskohorte hat theoretische oder ganz praktische Erklärungen parat, warum eine Geschichte, eine Erzählung zu Ende sein soll. Es gilt eigentlich, dem „post“ in postmodern, Posthistoire und meinetwegen auch dem goddamn Postfaktischen wieder die gebührenden Portionen Skepsis, Neupositionierung und, ja, Utopien einzutrichtern.
Alltag*
„Fass’ die Blumen nicht an“, sagt mein Vater. Es ist der Mai des Jahres 1986, ein paar Tage nach dem GAU in Tschernobyl, ich spiele draußen. Also zumindest hat er mir das so erzählt, weil: Ich erinnere mich da nicht dran. Er meinte auch, am Tag nach dem Unglück sei das Licht so ein bisschen komisch gewesen in der Stadt. Arkadi Pawlowitsch Bogdankewitsch, Dorf-Arzthelfer in Swetlana Alexijewitschs „Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft“: „Da liegen Karteikarten … Vor mir … Jeden Tag … Ich nehme sie in die Hand … Jeden Tag!
Anja Budai – geb. 1985, 380 Rem
Witja Grinkewitsch – geb. 1986, 785 Rem
Nastja Schablowskaja – geb. 1986, 570 Rem
Aljoscha Plenin – geb. 1985, 570 Rem
Andrej Kotschenko – geb. 1987, 450 Rem“
(Rem = veraltete Einheit zur Bemessung
von Strahlung)
Ich habe keine Ahnung, wann die Geschichten dieser Kinder zu Ende waren. Aber mit diesen Strahlungswerten im Körper haben sie es nicht lang gemacht. Meine ging weiter, die Wolke zog weiter.
Meine Mutter sagt: „Wenn du nicht gewesen wärst, ich wäre schon längst weg.“ Ich steige aus dem Auto. Heute, entscheide ich, trage ich keine Broschüren aus. Mein Freund M. und ich gehen in die Weinberge. Wir nehmen den vollgestopften Zeitungswagen und schmeißen ihn in einen Bach. Wir haben uns einmal entzogen, das war unsere Rebellion. Seine Eltern waren damals schon getrennt, sein Vater ist jetzt tot. Wie viele Eltern von Menschen, die ich kenne.
Die Geschichtswissenschaft hat schon lange festgestellt, dass Geschichte nicht nur von großen Figuren gemacht wird, schon lange. Wer das immer noch glaubt, kann sich zum Beispiel mal die deutsche Sozialgeschichte Hans-Ulrich Wehlers in fünf Bänden anschauen. Nur, weil Menschen behaupten, die Geschichte sei vorbei, wenn Konflikte aufgelöst werden, oder dass sie nur weiterginge, wenn große Beschlüsse gefasst werden, bedeutet das nicht, dass sie nicht ansonsten auch weiterfließt. Das bedeutet nur, dass diese Menschen scheinbar einen diskursiven Hoheitsanspruch auf den Gang der Historie haben.
Dass das anders ist, zeigten in den ersten Februarwochen gut 500.000 Rumänen, die mal wieder gegen die Korruption im Land protestieren mussten und damit genügend Gewicht auf die Straße brachten, sodass die Regierung willkürliche Beschlüsse zurücknehmen musste. Jedenfalls: Das Ende der Geschichte ist immer eine relativ straighte Erzählung. Ihr Fortgang sollte es auch sein, und wenn es sein muss, dann muss man nur jeden Tag auf all die Konflikte hinweisen, die es gibt. Spätestens dann versteht man, dass sie nie vorbei ist.
* Nennt es Kitsch, aber wenn fast alles, was zu jeder Zeit passiert, auch Geschichte ist, dann sind es doch gerade wir, die Gemeinschaft der Lesenden, der Facebookenden, der Tagesschau-Schauenden und Instantnachrichtenkonsumierenden, die diese Geschichte am intensivsten miterleben. Historie ist auch, wie Menschen sich Wirklichkeit konstruieren. Dabei können wir uns jeden Tag gegenseitig zuschauen. Jetzt, heute, morgen, gestern, jeden Tag.
Steffen Greiner, geboren 1985, schreibt für und ist Redakteur bei DIE EPILOG
Fabian Ebeling, geboren 1985, schreibt für und ist Chefredakteur der DIE EPILOG
Alle Rechte am Text liegen bei den Autoren.
--
Es war mehr ein Zufall, daß der Blick des Vaters einer vielköpfigen Mäusefamilie eines Tages auf seine jüngste Tochter ABIGAIL oder ADA oder ADALBERTA, oder wie hieß die eigentlich, fiel und er bei diesem vermutlich ersten Blick sehen konnte, wie schön doch seine ADALGARD oder ADALIA oder ADELE doch ist, und was es doch für ein Frevel wäre, würde er seine ADELGARD oder ADALIE oder ADELHEID verheiraten so mir-nichts-dir-nichts mit dem erstbesten Mäusejungen, denn was könnte der seiner ADELINA oder ADELFRIEDA oder ADELGUND schon bieten außer vielleicht ein etwas größeres Mäuseloch und vielleicht hin und wieder eine Scheibe Speck. Also nahm er seine ADELHEID oder ADELMUT oder ADELTRAUT ans Mausepfötchen und machte sich mit seiner ADRIANE oder AGATHA oder AGNES auf den Weg, ihr einen Bräutigam zu suchen, der ihr würdiger wäre, als all die Mäusejungen aus der näheren Umgebung ihres Mauselochs. Und die erste, die ihnen da auf dem Kartoffel- oder Rüben- oder Weizenfeld, wo sie ihre Behausung hatten, entgegen kam, war die Sonne, die sich da grade anschickte, über den Gersten,- den Raps-, den Maisfeldern aufzugehen. „Helios!“, rief da der Mäusevater der Sonne zu, „kuck her, ist meine AIDA oder ALBERTA oder ALDINA nicht wunderschön. Hast du nicht Lust, meine ALEKSANDRA oder ALESSA oder ALICA zu heiraten? Denn wenn ich jemanden kenne, der meiner ALIX oder ALMA oder ALOISA würdig wäre, dann du, denn mächtiger als du, Sonne, ist doch keiner, von dir hängt ja schließlich aller unser Leben ab!“ – „Ach Mäusevater“, antwortete ihm da die Sonne, während sie sich nun langsam von dem Hügel abhob, der da bei den Roggen,- den Hafer,- den Sonnenblumenfeldern den Horizont bildete, „ich würde dir ja gerne Recht geben und auch gerne deine AMALI oder ANABEL oder ANASTASIA heiraten, aber wie kommst du darauf, daß ich so mächtig bin, daß ihr auf der Erde alle von mir abhängig seid? Siehst du da drüben die Wolken, die sich im Westen zusammenziehen, die werden sich bald vor mich schieben, und dann bin ich weg und völlig überflüssig. Schon die Wolken sind mächtiger als ich, also frag doch eine von ihnen, ob sie nicht Lust hat, deine ANDRA oder ANDREA oder ANGELA zu heiraten, und sie so zur Frau einer einflußreichen Persönlichkeit zu machen.“ Also machten sich der Mäusevater mit seiner ANGELINA oder ANJA oder ANKE auf den Weg zu den Wolken, aber erst, als sie sich die Mühe gemacht hatten, in den Alpen einen der schneebedeckten Gipfel nach oben zu steigen, kamen sie den Wolken so nahe, daß sie mit ihnen in Kontakt treten konnten. „Wolken“, rief der Mäusevater von einer Almwiese den oben davonziehenden Wolken zu, „Wolken! Ist meine ANNE oder ANNA oder ANNABELLE nicht wunderschön! Und euch, Wolken, biete ich hiermit meine ANASTASIA oder ANNELIESE oder ANITA an als Wolkenbraut, und, Wolken, wenn es einer von euch daran liegt, meine ANTJE oder ANOUK oder ANTOINETTE zu heiraten, würde mich das jedenfalls freuen.“ Aber oben am Himmel die Wolken sagten zunächst gar nichts, schwiegen sich aus und ließen sich ganz geruhsam in dem lauen, da oben im Gebirge natürlich etwas kühlen Sommerwind gemächlich weitertreiben, bis sich schließlich doch eine kleine Kumuluswolke des gespannt Wartenden erbarmte. „Mäusevater“, piepse die kleine Wolke mit ihrer piepsigen Wolkenstimme von oben vom Himmel her dem Mäusevater zu, „von ganzem Herzen wünsche ich deiner APPOLONIA oder ARIADNE oder ARMIDA einen Mann, der ihrer Bedeutung gerecht wird, aber da bist du hier bei uns Wolken an der völlig falschen Adresse. Wir Wolken und einflußreich, da kann ich nur lachen! O, gäbe das eine Enttäuschung! Mäusevater, suchst du für deine Tochter ASJA oder ASTA oder ASTABERTA einen standesgemäßen Bräutigam, dann wende dich bitte an die Winde, die heute zwar nur sanft säuseln, eigentlich gar nicht zu spüren sind, aber wart ab, wenn denen einfällt, aus vollen Backen zu blasen, wie schnell wir da verschwunden sind. Ein Sturm und schon sind wir Wolken weg! Also Mäusevater, nun mach schon!“ Und es war eine baumlose Chaussee, die kerzengerade und kilometerlang durch flache, abgeerntete Felder führte, an dem die beiden, Mäusevater und Mäusetochter, endlich mit dem Wind in Berührung kamen und es war speziell ein kalter Nordostwind, der von den Feldern kam und so stark war, daß er die beiden nicht nur fast von der Chaussee gefegt hätte und Mäusevater auch ganz laut brüllen mußte, damit in dem Getöse der Wind endlich hörte, was Mäusevater von ihm wollte. „Klar“, antwortete ihm mit Sturmgebraus der Wind, „ich bin schon mächtig, bin beinahe unwiderstehlich, aber leider nur beinahe, siehst du da drüben der Fabrikschornstein, der ist von einem ganz anderen Kaliber. Gegen den wüte ich nun schon seit über hundert Jahren, letztes Jahr sogar als Orkan, der es in sich hatte, aber wie du siehst, er steht noch immer, streckt und reckt sich noch immer angeberisch in den Himmel. Mäusevater, willst du für deine ASTRID oder ASWINE oder AUDINCHEN einen Mann, der etwas darstellt, der für sie eine Stütze ist, dann frag doch drüben den Schornstein der Maschinenfabrik, ob er nicht Lust hat, sie zu heiraten, mit deiner AUGUSTA oder AUGUSTE oder AUGUSTINA einen Bund fürs Leben eingehen will.“ Aber der Schornstein der Maschinenfabrik, wie er da unbeweglich und etwas steif hinter seiner Fabrik in der Landschaft stand, ließ den Mäusevater gar nicht ausreden. „Mäusevater, für wen hältst du mich. Ich soll mächtiger, bedeutender sein als die Sonne, die Wolken, als der Wind, und ein Leben lang deiner AURELINA oder AURORA oder ARIZZA eine Stütze sein? Mäusevater, hörst du nicht, wie es unter mir piepst, knabbert und knuspert? Na, wer ist das wohl, wer da gerade dabei ist, unter mir mein Fundament zu zerstören! Das seid doch ihr Mäuse. Ihr Mäuse seid doch gerade dabei, mich einstürzen zu lassen und aus mir einen Haufen Bauschutt zu machen. Mäuse, gegen euch bin ich doch machtlos! Ihr seid doch die Herren der Welt! Also bleibt unter euch und vermehrt euch vermehrt, vermehrt euch, und auch deine AZYLA oder AZYLINA oder AZYLINE soll für viele, viele Mäuse sorgen, und dann piepst, und knabbert und knuspert, bis hier nichts mehr steht und ihr euren endgültigen Sieg feiern könnt“!
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
Lothar Trolle, geboren 1944. Dramatiker
siehe auch
Denkzeichen CXVII
Denkzeichen LXIX
Denkzeichen XIV
--
Der 8. November 2016 ist erst ein paar Monate her und seither beobachten wir eine atemlose Jagd um die Deutungshoheit auf den Feldern der Aufmerksamkeitsökonomie. Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, wenn es sich bei „Trump“ um eine gezielt eingesetzte Strategie handeln würde, die auf die Menschheit losgelassen wurde, um die letzten Reste kritischen Bewusstseins und Widerstandspotentials zur Strecke zu bringen. Jegliche Form einer öffentlichen Debatte würde als sinnlos erkannt werden, bevor überhaupt der Versuch unternommen worden wäre, sie zu führen. Jegliche Artikulation einer völlig anderen Sicht auf die Dinge könnte nur noch in extra dafür geschaffenen Safe Spaces unter Gleichgesinnten geäußert werden. Paradise! Aber noch ist es nicht so weit. Auch wenn nicht wenige sich schon ein bisschen was bei Trumps Taktik abgeschaut zu haben scheinen. Waren Künstler, Leiter von Kultureinrichtungen und Bürger von beratungsbedürftigen Politkern gerade noch eingeladen, sich mit fachlicher Expertise an lokalen kulturpolitischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen, müssen sie sich nun den Vorwurf gefallen lassen, elitär zu sein, wenn ihre öffentlich vorgestellten Ideen und Vorschläge nicht ins Konzept zweckrationaler, marketing- und eventorientierter Stadtpolitik passen. Bestenfalls könnten diese Erfahrungen dazu dienen, den Blick für die Machtverhältnisse zu schärfen und sich gegen die Strategien der Vereinzelung und Entsolidarisierung zu verbünden.
Das alles lässt unweigerlich an jenes Froschexperiment denken, bei dem der Frosch trotz langsam steigender Wassertemperatur so lange zufrieden vor sich hin paddelt, bis ihn schließlich der Hitzetod ereilt. Nicht dass die Veränderungen nicht zu spüren gewesen wären, aber so lange es möglich ist, sich mehr oder weniger unmerklich Schritt für Schritt anzupassen, hat man längst den Punkt verpasst, an dem es möglich gewesen wäre, grundsätzlich nein zu sagen.
Der 8. November 2016 war nicht nur der Tag, an dem Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde, es war auch der 100. Geburtstag von Peter Weiss. Ein willkommener Anlass, noch einmal die dreibändige „Ästhetik des Widerstands“ zu lesen. Jenen großangelegten Jahrhundertroman, der die Folgen des Scheiterns des antifaschistischen Widerstands bis weit über die Nachkriegszeit und die Zeit des kalten Krieges hinaus zu Bedenken gibt. Was lässt sich noch lernen aus den blutigen Kämpfen des 20. Jahrhunderts, die entlang klarer Fronten zwischen Unterdrückern und Unterdrückten verliefen?
Meine Recherchen zu Peter Weiss führten mich auch in die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf. Ich wollte wissen, welche Menschen in der Stadt, in der ich ein Theater leite, nach 1933 in den Untergrund gingen, und wie sie sich organisierten; vor allem, wie es gelingen konnte, die großen Organisationen der kommunistischen Arbeiterbewegung, aber auch die kirchlichen Jugendorganisationen, derartig effizient zu zerschlagen. Die Historikerin, die mich durch ihre medial hochmodern aufbereitete Ausstellung führte, hielt mir aus dem Stand einen einstündigen Vortrag. Systematisch und von langer Hand vorbereitet, würden die strategisch wichtigen gesellschaftlichen Organisationen mit „eigenen Leuten“ durchsetzt und gleichzeitig Parallel-Strukturen aufgebaut. Zum Zeitpunkt der Machtübernahme, würden die führenden Köpfe der Opposition sowie Intellektuelle, Künstler, Journalisten, das ganze kritische Potential ins Gefängnis gesteckt oder anderweitig zum Verstummen gebracht. Historisch sei das genauestens untersucht, aber dieses Wissen würde offenbar nicht dazu beitragen, dass überall auf der Welt autoritäre Regime immer wieder nach genau denselben Mustern errichtet werden. Ich muss gestehen, dass ich bisher tatsächlich davon ausgegangen war, dass aus der Geschichte zu lernen, per se ein kritisches Verhältnis zur eigenen Gegenwart beinhaltet, so als bestünde ein Konsens darüber, dass es darum ginge, die Machtverhältnisse im Sinne einer gerechten Gesellschaft für alle zu verändern. Aber natürlich stellt die Geschichte auch das Wissen bereit, wie sich genau dieses Begehren wirksam unterdrücken lässt.
Wenn die zurückliegenden Wochen und Monaten etwas zutage befördert haben, dann die Einsicht, dass dieser Konsens, sollte es ihn jemals gegeben haben, auch in Europa, wo nicht schon aufgekündigt, so doch offen zur Disposition gestellt wird. Wie genau das so schnell durchgestellt werden konnte, lässt sich noch kaum begreifen. Bei einem Besuch in Polen, wenige Tage nach der Premiere von Oliver Frlijcs Inszenierung „Der Fluch“ am Warschauer Teatr Powszechny, die einen öffentlichen Skandal auslöste, dessen Ausmaße weit über einen Theaterskandal hinaus gehen, formulierte Piotr Grszeczynski vom Teatr Nowy vor einer Gruppe von rund 100 ausländischen Kuratoren und Veranstaltern, die vor allem wissen wollten, wie sie ihre Solidarität mit den polnischen Künstlerkollegen in Form von Protestbriefen am effektivsten zum Ausdruck bringen könnten, einen bemerkenswerten Gedanken. Die Bedeutung von Frlijcs Inszenierung für das Theater in Polen bestünde vor allem darin, auf das Problem der Selbstzensur aufmerksam gemacht zu haben. Frlijc hatte also etwas ins Bewusstsein gerückt, was sich bis dahin nur im Innern der Institutionen und in den Köpfen jedes einzelnen abgespielt hatte, nun wurde es zum Gesprächsthema. Die Kampagne gegen die Inszenierung, gegen das öffentlich geförderte Theater und die öffentlich geförderte Kultur im Allgemeinen, der Druck auf die beteiligten Schauspieler bis hin zur sofortigen Kündigung von Arbeitsverträgen beim staatlichen Fernsehen, waren gewissermaßen zu erwarten. Wie die junge polnische Autorin und Dramaturgin Agnieszka Jakimiak das Hand-in-Hand-Gehen von Rechtspopulismus und Neoliberalismus beschreibt, kann man in ihrem Beitrag zu „The Year 2017 - A Collective Chronicle of Thoughts and Observations“ nachlesen, ein Projekt, das den Versuch unternimmt, Woche für Woche aus unterschiedlicher Perspektive den fortschreitenden Wandel zu beobachten:
http://journal.fft-duesseldorf.de/chronicle/
Peter Weiss schreibt in seinen Notizbüchern in den 80er Jahren: „wie der Faschismus ist die Studentenbewegung 68 nicht aufgearbeitet worden“. Nicht aufgearbeitet hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Klassenbewusstsein und kollektives Freiheitsbegehren, könnte man hinzufügen. Hinzuzufügen wäre außerdem, dass 1989 und der Zerfall der sozialistischen Staaten ebenfalls nicht aufgearbeitet wurden. Genau hier setzt das Buch des britischen Kulturkritikers und Theoretikers Mark Fisher „Capitalist Realism. Is there no Alternativ?“ an:
https://libcom.org/file/Capitalist%20Realism_%20Is%20There%20No%20Alternat%20-%20Mark%20Fisher.pdf
Wie konnte es gelingen, dass nach 1989 der Kapitalismus als scheinbar alternativlose Realität akzeptiert wurde? Indem das kollektive Bewusstsein durch neue Technologien, die ein neues Regime von Zeit und Arbeit errichteten, den Interessen des Kapitals unterworfen wurden. Hatten die Menschen in den 60er und 70er Jahren genügend freie Zeit, sich ein anderes Leben vorzustellen, halten uns heute Smartphone, Soziale Medien, der Zwang zur Selbstoptimierung, zur Partizipation in einem Zustand von konstantem business, konstanter sinnentleerter Geschäftigkeit. Die größte Angst der 60er und 70er Jahre, so Fisher, bestand darin, dass alle Arbeiter Hippies werden könnten und nie wieder arbeiten wollten. Also wurden Wege gefunden, die Menschen zur Arbeit zu zwingen, die sozialen Sicherungssysteme abzubauen und die Menschen ihrer freien Zeit zu berauben. Den sozialen Bewegungen ging spätestens in den 80er Jahren die Luft aus. Der ersehnte Wandel ereignete sich nicht so schnell, wie gehofft. Daher, meint Fischer, brauchen wir heute revolutionäre Geduld. Ein knappes Jahr vor seinem Tod im Januar 2017 hielt er mit Blick auf die Entwicklungen in Griechenland und Spanien einen geradezu optimistischen Vortrag darüber, dass jederzeit ein neues kollektives Bewusstsein entstehen könnte. Das war noch vor dem Brexit und vor Trump. Fisher litt unter schweren Depressionen und machte seine Krankheit immer wieder zum Thema, indem er sie radikal entindividualisierte. Aber Fisher war kein Pessimist, im Gegenteil, wie man zum Beispiel in diesem Vortrag sehen kann:
Kathrin Tiedemann, geboren 1964, leitet seit 2004 das FFT, Forum Freies Theater, in Düsseldorf
siehe auch Denkzeichen XXVIII, Kathrin Tiedemann, 20. Dezember 2012
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
--
Oh schnell! Schnell doch, schneller, schnell! Schnell noch das festhalten, bevor die Gedanken sich auflösen, und am Ende war alles nur ein Traum. Es geht mir ja alles viel zu langsam, ich hämmere mit meinem Zeigefinger auf mein Telefon ein, die Zeit rauscht vorbei, und der Gedanke, eben noch da, wird durch einen neuen ersetzt. Und jetzt? Jetzt aber, irgendwann muss es mal los gehen, doch wo beginnen? Vielleicht vor 72 Stunden im Frühdienst (Puls 68 – wozu hab ich den Fitbit?) in dem ich die Kartoffeln in der Metro für den SPIELER kaufe? 25 Säcke à 10 kg Kartoffeln. Ich habe jeden Sack an diesem Tag 4 mal in der Hand, bis er endlich im Keller des Theaters verstaut ist und dort geduldig und stumm wartet.
28 Stunden vorher Dienstbeginn. 14:00 Uhr, noch mitteleuropäische Winterzeit. Werde ich heute Nacht in der Kantine den Sprung in den Sommer hautnah erleben? Im Gang begrüßt mich Immo mit „Yeah Yeah Yeah!“, lachend im Achteltakt. Ich komm in die Requisite, Franzi ist schon da. Einen Kaffee, eine Zigarette, dann SPIELER einrichten. Wir bereiten vor, was gebraucht wird, kochen und decken den Tisch, an dem Alexander seinen Satz: „Warum gebe ich mich eigentlich mit diesen Leuten ab? Und warum bin ich nicht schon längst davongerannt?“ sagen wird. Wir richten das Casino ein, wieviele verschiedene Währungen hier aufeinander treffen, spielt keine Rolle, ist alles Theatergeld. Die 250 kg Kartoffeln kommen zum Einsatz. Die Säcke werden aufgeschnitten und im Bühnenbild-Kartoffelkeller verteilt. Beim Gastspiel in China war jede einzelne Kartoffel in Polsterfolie verpackt, da ist die preußische Orange noch eine Rarität.
17:15 Uhr, 45 Minuten vor Stückbeginn. Wir gehen die Stückliste durch, gucken ob alles am Platz ist. Requisiteure als Phänomen: zu beobachten, wie der eine etwas einrichtet und der andre es noch einmal etwas nach rechts, der nächste wieder ein wenig weiter nach vorne verschiebt, herrlich für das Auge eines Außenstehenden. Jetzt noch schnell „Knackige Debreziner mit deutschem Kartoffelsalat“ auf den gedeckten Tisch gestellt, wir sind bereit.
18:05 Uhr die Vorstellung beginnt (Puls 74). Die Vorstellung läuft, wir bauen um, räumen ab, räumen hin und räumen her. Im zweiten Teil kommt einer meiner Lieblingsumbauten näher (Puls 86). Ich befinde mich im Casino, die Bühne dreht, die Schauspieler bereiten sich vor, ich bereite mich vor (Puls 94) … Achtung! Schauspieler in Position, Kamera! (Puls 112) … Ich bin hochkonzentriert, vergesse alles, mein Privatleben hängt drinnen in der Requisite, jetzt bin ich nur hier, meine Sensoren achten auf alles und jedes kleinste Zeichen. Die Spannung der Spieler ist unglaublich, ihre Energie fließt durch mich hindurch, ich bin in ihrem Sog … ich muss mit, es gibt kein Zurück. Ich muss mit, mir bleibt keine Wahl (Puls 127) … und dann, dann hab ich es geschafft. Was ich genau getan habe spielt keine Rolle. Ich bin glücklich, Erleichternd durchströmt ein Glücksgefühl meinen Bauch, mein Herz (Puls fällt auf 84, 78, 72). Weiter! Die Vorstellung läuft, wir bauen um, räumen ab, räumen hin und räumen her. Abbau!
Danach in die Kantine. Ich kenne keinen andern Ort, wo man so gut feiern kann. Zeitsprung von Winter auf Sommerzeit kaum mitbekommen, der Frühdienst kommt und holt sich seinen ersten Kaffee (70 Cent für Mitarbeiter). Wir sitzen noch, wir wollen noch nicht gehen, doch die Sonne steht schon ziemlich hoch am Himmel. Also raus und weiter, mein Rad fährt mich nach Hause.
7 Stunden später, 15:00 Uhr bin ich wieder in der Requisite. Heute JUDITH, wo man so schön auf dem Asphalt im dunstigen Zuschauerraum hinter den schwarzen Hängern arbeiten kann. Ich höre Birgit und Martin zu, wie sie ihre vertraut-verrauchten Stimmen den Texten und den Zuschauern widmen. Orientalische Musik rauscht vom Band durch meine Ohren, ich kann die Trockenheit der Steppe spüren und begebe mich gedanklich in die Hitze der Sahara.
4 und eine halbe Stunde später: Abbau. Heute keine Kantine, nein, heute nicht.
10 Stunden später finde ich mich in der Requisite wieder (Puls 62) – schlaf ich noch? War ich zwischendurch zu Hause? Und dann fällt mir ein, dass es in einer von den letzten unruhigen Nächten gewesen sein muss, als ich diesen Traum hatte.
Zur Zeit schlafe ich nicht so gut, wenn ich zu früh ins Bett gehe, wache ich zu früh auf und wenn ich zu spät ins Bett gehe, wache ich auch zu früh auf, macht alles keine Sinn, aber in so einer Nacht muss ich diesen Traum gehabt haben. Und er ist mir heute erst wieder eingefallen, als ich die Requisite verließ. Das Gespräch mit Moritz über unseren Raum, was wir mit der Requisite machen und was sich hier verändern wird. „Na, der bleibt so wie er ist!, sag ich, und Moritz wiederholt meinen Satz murmelnd für sich selbst, als wenn es ihn beruhigen würde. Das alles hatte ich jedenfalls schon längst vergessen, und als ich ging, fiel mir plötzlich ein, dass ich genau davon schon geträumt hatte. Ein Traum vom Requisitenraum. Ich kam rein, der Boden war extrem schmutzig und das gesamte Innenleben war entfernt. Es bleibt also doch nichts, wie es ist. Alles war rausgerissen, es gab nichts mehr, nur der Grundriss und der hässliche, dreckige Linoleumboden waren geblieben. Ich sah mich um und hörte mich sehr laut sagen: „Wie praktisch! Jetzt können wir hier endlich mal richtig wischen!“
Träume sind merkwürdig. Theater-Angst-Träume sicher noch merkwürdiger. Sie ähneln sich, es geht immer um das eine: VORSTELLUNG VERPASST. Oft bin ich dann in einer fremden Stadt, in einem fremden Theater, manchmal auch in einem fremden Stück, trotzdem vertraute Szenen, vertraute Kollegen. Ich komme viel zu spät, unmöglich alles noch einzurichten. Die Vorstellung beginnt, und ich weiß, ich müsste jetzt umbauen oder überhaupt erstmal einrichten, aber ich schaff es nicht, die Requisiten in die richtige Reihenfolge zu bringen, ich schaffe es nicht. Ich komme nicht schnell genug auf die andere Bühnenseite, ich bleibe irgendwie auf der Drehbühne und stehe plötzlich vor dem Publikum. Ich irre in fremden Kellergängen umher und höre die Musik, bei der ich sonst etwas auf der Bühne zu tun habe. Ich fühl mich wie unter Drogen, die Vorstellung läuft und ich fahre mit einem Rad durch die Straßen der fremden Stadt. Ich überquere mit dem Rad die Dächer der Häuser, aber ich kann das Theater nicht finden. Plötzlich bin ich am Strand, ich überlege, wo ich am besten ins Wasser käme. Ich bade, schwimme, tauche, meine Gedanken sind im Theater, doch ich komme nicht weg. In welchem Land bin ich hier überhaupt und wie hierher gelangt? Niemand versteht mich, aber alle sind sehr freundlich, mein Herz rast und rast, ich kann meinen Puls nicht fühlen, und irgendwann komm ich viel zu spät endlich im Theater an. Die Vorstellung ist zu Ende, ich höre den Applaus. Ich versinke im Boden, denke, dass das ohne mich nur eine absolute Katastrophenvorstellung gewesen sein konnte. Panik steigt in mir auf, dann steht plötzlich Eike vor mir und mir wird klar, dass er alles allein gemacht haben muss. Ich starre ihn an, fassungslos und schweißgebadet.
Ein Ruck durchzuckt meinen Körper, BLACK, der Wecker klingelt. Frühdienst 72 Stunden zuvor! Ich fahre mit dem Rad ins Theater, in der Requisite sitzt Moritz. Der Raum ist so, wie er ist und immer war. Ich habe keine Vorstellung verpasst. Und jetzt muss ich los, in die Metro, Kartoffeln kaufen (Puls 68). Im Gang begegne ich Immo, „Yeah Yeah Yeah“, sag ich zu ihm und er, er lacht im Achteltakt.
Yvonne Schulz, geboren 1977, arbeitet seit 1997 in der Requisite der Volksbühne
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Konzentrieren wir uns auf drei davon, sie sind grimmig genug: Mittelschicht, Globalisierung, Populismus. Es sind Decknamen sozialer Prozesse, unter denen ihre Natur und folglich ihre Perspektiven nicht mehr zu erkennen sind.
Zuerst die Mittelschicht. Es heißt, sie charakterisiere geradezu die Gesellschaft der Bundesrepublik, wie sie in der Nachkriegszeit entstand und auch heute noch als vereinheitlichtes Deutschland besteht. Die „breite soziale Mitte“ verdanke sich dem deutschen Produktionsregime, der Eigentumsstruktur, dem Bildungsniveau, der Arbeitsdisziplin, der Kleinstaaterei und vielen weiteren Eigentümlichkeiten unserer Geschichte. Mag sein, aber kann das so fortgehen? Das deutsche Bürgertum (mit seinen Familien) stellte 1913 ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung, 1930 ein Fünftel, 1945 unverändert 20 Prozent und so bis ans Ende der 60er Jahre den Teil der westdeutschen Gesellschaft, der ihr Gesicht prägte. Mindestens drei Bürgertümer sind darin zu unterscheiden: Groß- und Wirtschaftsbürgertum, Bildungsbürgertum, Mittel- und Kleinbürgertum. Letzteres war damals mit 15 Prozent zu veranschlagen. Der Drehpunkt kam auch hier um 1970. Die schon länger gängige Vorstellung einer Mittelstandsgesellschaft wurde zum Selbstverständnis der Republik und große Teile der Arbeiterklasse gleich mit eingerechnet.
Seither ist es schwierig, die Zahlen festzustellen und die Fraktionen auseinanderzuhalten.
Gut vier Jahrzehnte ging das so durch. Die tatsächliche Zusammensetzung dieser übergroßen Mitte ist heute eine unbekannte Größe, nicht nur statistisch, sondern faktisch, soziologisch ebenso wie politisch. Inzwischen bleibt ihr selbst nichts übrig, als sich durch Eigenbewegungen bemerkbar zu machen und dadurch in ihre verschiedenen Teile auseinanderzugehen. Zwangsläufig werden dabei die jeweiligen sozialen Wurzeln freigelegt – dieser Prozeß hat gerade erst begonnen. Der ungenierte Gläubigerzugriff auf die Wirtschafts- und Sozialstruktur Griechenlands, die nationale Kampfabstimmung über den britischen EU-Austritt, das Ausfächern des deutschen Parteienspektrums, das stetige Anwachsen des französischen FN – seit 2015 entstehen den westlichen Gesellschaften wieder politische Ereignisse von Klassengröße und Klassentiefe. Offenbar stecken die sozialen Ergebnisse der gesamteuropäischen Nachkriegsgeschichte darin. Niemand kennt sie noch.
Globalisierung ist ein Pseudonym von sprachlich durchaus höher verdichteter Verlogenheit. Es suggeriert eine geographische Perspektive für einen Vergesellschaftungsvorgang. Statt dessen durchaus gewaltförmige Rückbindung an die Metropolen zu benennen – wie sie im Falle Griechenlands vor den Augen der ganzen Welt zu besichtigen war –, weist das Wort in die Ferne, als ob das Kapital die Modernität dorthin brächte und dabei allenfalls die Bestimmungen für den Arbeitsschutz zu beachten wären. Die Expansion wird wirtschaftlich vorgetragen und finanziell organisiert. Der Weltmarkt wird vervollständigt und dynamisiert, nachdem die Außenhandelsmonopole der sozialistischen Staaten zu bestehen aufgehört haben. Seither verändern sich überall die Machtverhältnisse zwischen Staaten und Märkten zum Nachteil der Staaten und zum Vorteil industrieller Ausbeutung und finanzieller Abschöpfung. Je hilfsbedürftiger ein Land ist, desto ungebremster werden die rein ökonomischen Interessen von Investoren und Kreditinstitutionen umgesetzt, umso weniger die Entwicklungsbedürfnisse der dortigen Gesellschaften berücksichtigt. Diese Modernisierung auf weltwirtschaftliche Art bedeutet in der Regel den Abbruch heimischer, mental und kulturell gewachsener Vergesellschaftungsformen durch die rationaler Verwertung. Da deren Umschlagsgeschwindigkeit aus den Metropolen bestimmt wird, reißt die Rückbindung ganze Stücke aus dem sozialen Grundgewebe der Peripherien heraus.
Auch in den Metropolen gibt es Zerfallserscheinungen des sozialen Zusammenhangs: gefühlte Entwurzelung, Kälte der Herrschenden, eigenartige Protestbewegungen. Eine merkwürdige Koalition von Liberalen bis Linken bezeichnet sie mit dem immer selben Wort als „Populismus“, ohne wahrzunehmen, was es bewirkt. Sein inflationärer öffentlicher Gebrauch setzt die politischen Demagogen mit ihren Zuhörern gleich. Es stellt die kurze Antwort mit der nachhaltigen Frage auf eine Stufe und verschließt so den Zugang zu der neuen Unruhe, die da angefangen hat.
Man könnte es vielleicht für einen Fortschritt halten, wenn der Kapitalismus nun als Bedrohung empfunden wird. 1990 wurde er in Ostdeutschland noch als Befreiung empfunden, auch bei uns gingen damals die meisten Arbeiter Arm in Arm mit dem Kleinbürgertum. Aber das Wort zeigt etwas anderes an, es hat schon begriffliche Qualität. Der Begriff sagt das Gegenteil von dem, was er meint: er will die Blindheit der Unterschicht benennen und sagt die der Oberschicht aus. Gewalttätigkeit klingt aus diesem Wort, und sie könnte wohl eines Tages daraus auch hervortreten. Vorläufig aber sind seine Benutzer eher politische Autisten, die sich für Demokraten halten.
Drei Pseudonyme für die soziale, wirtschaftliche, politische Gestalt der Gegenwart. Wörter, die mehr verbergen als erklären, Tendenzen, die nach allen Seiten ins Leere laufen, beteiligte Gruppen, die sich gegeneinander abkapseln! Und gar kein Ausweg? Wohl nur von Grund auf. Wo der ist? Bei den Klassen und Schichten, welche die gesellschaftliche Mitte bilden. Sie haben ihn unter sich aufgeteilt und dadurch neutralisiert. Zwei soziale Haltungen parieren sich gegenseitig, die eine versteht sich als Eigentümer, die andere als Produzent ihrer Lebensumstände. Der unbekannte Kleinbürger und der unbekannte Arbeiter. Die heutige Gewichtung der beiden Haltungen ist noch nicht zu erkennen. Vermuten läßt sich, daß bislang der moderne Arbeiter dem modernen Kleinbürger folgt. Wissen läßt sich aus der Erfahrung des letzten Jahrhunderts, daß dieses Verhältnis sich umkehren muß, wenn der Gesellschaft neue Bewegungsmöglichkeiten eröffnet werden sollen.
Klaus Wolfram, geboren 1950, Philosoph, ostdeutscher Oppositioneller seit 1975, Herausgeber der "Anderen Zeitung" 1990-92, Mitbegründer des Verlags BasisDruck
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Siehe auch Denkzeichen CXXII (OSTDEUTSCHE EINSAMKEIT) vom 3. Oktober 2016.

110 x 140 cm, Öl auf Nessel, 2017
Alle Rechte am Bild liegen beim Autor.
Wir sind spät dran. Wir haben zu viel Zeit verstreichen lassen. Man klopft schon mit langen Fingernägeln auf harte Tischplatten. Das Geräusch lässt uns nervös mit den Nasenflügeln zucken. Sollten wir uns beeilen? Macht das nicht alles noch schlimmer? Unzählige Wochen ohne etwas zu tun, scheint für jemanden, der sich selbst unter Druck setzt, eine Ewigkeit. Daher also der Tritt; der Stoß; der Wink nun doch vorzutreten und sich zu rechtfertigen. Die Vorladung liegt schon im Briefkasten.
Wir gehen also vor die Tür und müssen erst einmal niesen. Sind an den starken Pollenflug nicht mehr gewöhnt und steigen vorsichtshalber auf die Schultern des anderen. Des motivierteren. Des besseren. Lächerlich, wenn man bedenkt, dass dieses Vorhaben nun wirklich nichts bringt. Doch scheint es nötig, in Anbetracht der Tatsache. Wir rennen also die Straße hinab. Mehrere rote Doppeldeckerbusse versuchen sich uns in den Weg zu stellen. Wir täuschen eine Silhouette vor und preschen in die entgegengesetzte Richtung. Nun ist es von Vorteil nebeneinander zu laufen – also tun wir es.
Wer zwischen Winter und Frühling durch enge Häuserschluchten läuft, sollte sich nicht so oft umsehen. Hinter uns versuchen Handtuchverkäufer ein gutes Geschäft zu machen. Nach wochenlangem Nichtstun ist uns aber die Lust nach Feilschen vergangen. Somit bleibt uns nur die Möglichkeit in der Menge unterzutauchen. Wir hocken uns hin. Eine Gruppe Pfadfinderinnen stellt sich um uns herum. Sie wollen uns schützen, verdienen sie dadurch doch genug Abzeichen, um einen ausgedehnten Urlaub an der Adria antreten zu dürfen. Wir beneiden sie kurz um ihre Naivität, müssen aber weiter. Die Vorladung zittert in unseren Taschen.
Nur noch fünf Häuserblöcke. Die Straßen sind so eng, dass wir hintereinander laufen müssen, und von so hohen Häusern umzäunt, dadurch so dunkel, dass wir den Weg nur mit zusammen gekniffenen Augen erkennen können. Wir wünschen uns, es wäre Nacht, es gäbe Lichtkegel, denn am Tag scheinen die Laternen nur im Weg zu stehen. Als ob unser Wunsch erhört worden wäre, öffnen sich alle Fenster in der ersten Etage der Häuser und grimmige Rentner leuchten uns den Weg mit ihren Leselampen. Wir werfen dankbare Handküsse zu ihnen rauf. Manch einer zückt seinen Hut. Das empfinden wir dann aber doch als ein wenig zu hochnäsig.
Kurz vor dem Ziel stolpern wir. Kurz vor dem Ziel muss man stolpern. Gerade wenn man vorgeladen wurde. Denn sonst ist es nicht spannend genug. Sonst kommt man einfach an. Und einfach ankommen, verursacht bei denen, die uns vorgeladen haben, hysterische Schreikrämpfe. Wir lassen uns daher einfach fallen und landen in den dafür vorgesehenen Federbecken. Hier kommt man nur mit Brustschwimmen voran. Die Federn kitzeln uns in den Nasen und wir müssen wieder niesen. Diesmal können wir nicht auf die Schultern des Anderen steigen. Wir würden einfach untergehen. Drei Züge später erreichen wir endlich das rettende Ufer.
Ein Mann im Anzug hilft uns heraus. Seine Hand ist feucht und riecht komisch. Er lächelt. Allerdings viel zu freundlich. Wir können uns nicht helfen, aber dieses Lächeln scheint nicht für uns bestimmt zu sein. Und tatsächlich taucht hinter uns seine Verlobte auf. Sie laufen Hand in Hand davon und wir betreten das Gebäude. – Die Vorladung dem Portier zeigend, werden wir in einen Besprechungsraum geführt. Sieben Frauen schütteln den Kopf und tippen mit dem linken Zeigefinger auf ihre Armbanduhren am rechten Handgelenk. Keine Chance.
Wir sind spät dran.
Stephan Weiner, geboren 1984, Redakteur der EPILOG – Zeitschrift zur Gegenwartskultur.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
Billetts verkauft. Gehadert. Allzu leichtfertig den Job-Futuromaten der ARD gefragt, wie es so um die Zukunft des Kassierens bestellt ist. Sieht nicht gut aus. „100 % der Tätigkeiten in diesem Beruf könnten schon heute Maschinen übernehmen“, heißt es nüchtern. „Der Grad der Automatisierbarkeit“, so die rechnerische Erklärung, „ergibt sich, wenn man die Anzahl der automatisierbaren Tätigkeiten eines Berufes durch all seine Tätigkeiten insgesamt dividiert und mit 100 multipliziert.“ Klingt erst mal kompliziert, ist aber ganz einfach. Besonders für Billettkassen-Mitarbeiter, Kassenfrauen, Kassenmänner. Zum einen, weil sie im Umgang mit Zahlen versiert sind. Zum anderen und wesentlicher, weil diese Rechnung für sie bestechend übersichtlich ausfällt. Daran ändert die kulturell hochgeschätzte Institution des Theaters nichts, nicht mal dieses Theater. „Ihr Arbeitsalltag besteht im Wesentlichen aus 2 verschiedenen Tätigkeiten, 2 davon könnten Maschinen übernehmen.“ In einer Marthaler-Inszenierung würde so ein Satz poetisch klingen. Jenseits der Bühne sorgt er für Unbehagen. Nicht deshalb, weil das Arbeitsfeld offenkundig kein weites ist. Auch nicht, weil die Zukunftsprognose ein wenig düster scheint. Das Provisorium braucht in der Regel keine Zukunft. Und irgendwie ist man auf das Konzept düsterer Zukünfte sowieso eingestellt, erst recht an diesem Ort. Wen tröstet es schon, dass laut eben jenem web-Orakel Dramaturginnen und Dramaturgen, Schauspielerinnen und Schauspieler zu 0%, Intendantinnen und Intendanten nur zu 13% zukünftig durch Maschinen zu ersetzen sind? Die Zukunft ist gewieft. Sie findet bekanntlich andere Wege.
Nein, das tägliche Unbehagen einer Kassenmitarbeiterin entsteht aus der tristen Einsicht, dass die Wirklichkeit dieser Prophezeiung schon jetzt wenig entgegenzusetzen hat. Die Zukunft verspricht bloß, was die Gegenwart längst einlöst. Die Kasse eines Theaters ist ein Maschinenraum der Kunst. Ein Maschinenraum, an dem nichts metaphorisch glänzt, ein Maschinenraum, in dem routinierte Automaten walten, Damen ohne Unterleib, Herren ohne Unterleib – SERVICE NO SERVICE – ein Maschinenraum, den es braucht, um Produktion und Rezeption, Kunst und Kohle stetig zusammenzuführen. Mehr nicht. Weniger natürlich auch nicht.
Er ist klein, dieser Raum. Manche nennen ihn winzig. Zwei Meter im Quadrat. Sechs weniger als dem Deutschen Schäferhund für seinen Zwinger tierschutzrechtlich zugesichert sind. Kein Ort für Schäferhunde also. Keiner für Klaustrophobiker. Auch raumgreifende Ambitionen lässt man lieber vor der gepanzerten Tür, man wird sie bei Bedarf am Abend wieder einsammeln. Für Pragmatismus und stoischen Gleichmut hingegen ist immer und viel Platz in der Billettkasse.
Billett-Kasse. Wenn das Theater seine eigenen Strategien entwickelt, um die Dämonen des Dienstleistens zu zügeln, dann gehört Rhetorik natürlich dazu. Billetts – das klingt so angenehm antiquiert, nicht nach obligatorischem Konfliktmanagement, Schnappatmung oder nöliger Empörung auf zwei Beinen. Eher nach dem haptischen Erlebnis des Papiers, nach Reinhardt oder Goethe. An Goethe kommt man offenbar nie vorbei. Drinnen nicht, draußen auch nicht. Niemand hat Tragödien, wie sie sich in der Kassenhalle am Rosa-Luxemburg-Platz nun allabendlich abspielen, je treffender erfasst als der Direktor im Faustschen Vorspiel auf dem Theater:
Denn freilich mag ich gern die Menge sehen,
Wenn sich der Strom nach unsrer Bude drängt,
Und mit gewaltig wiederholten Wehen
Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt,
Bei hellem Tage, schon vor Vieren,
Mit Stößen sich bis an die Kasse ficht
Und, wie in Hungersnot um Brot an Bäckertüren,
Um ein Billett sich fast die Hälse bricht [...]. (Faust I, V. 49-56)1
Mehr Goethe war nie. Seitdem das kulturpolitisch verfügte Ende seinen Anfang nahm, ist diese Szene unser tägliches Vorspiel auf dem Theater. Wie oft noch Gesichter, Gefühle, Fliegen, Fäuste? Nicht oft genug. Wir zählen rückwärts, verkaufen letzte Blicke im Akkord. Kaum etwas verkauft sich besser. Letzte Blicke haben eine gewaltige Lobby. Auch eine gewaltig unspezifische. Alle wollen sie werfen und geworfen haben. Neophobiker, Nostalgiker, Stammgäste und die, die es auf den letzten Metern noch werden möchten. Letzte Blicke sind notorisch knapp und schon deshalb ungemein begehrt. Wir wollen mal nicht so tun, als bestünde da kein Zusammenhang. Fast jeden Abend gibt sich die wogende und gewogene Menge vor der Kassen-Loge – auch so ein freundlicher Euphemismus – nun wahrhaft aufopferungsvoll dem Wartenummerninferno hin. Wer vor einer fünf-, sechs- oder siebenstündigen Inszenierung noch drei Stunden Lebenszeit in das Ringen um ein Billett investiert, hätte ein solches in jedem Fall verdient. Doch leider erhöhen Hoffnung und Opferbereitschaft keine Saalkapazitäten. Und wer regelmäßig Akteurin in diesem Foyer-Spektakel ist, weiß daher auch, dass sich (Kassen-)Halle und (Kassen-)Hölle nicht zufällig nur durch einen winzigen Vokal voneinander unterscheiden. Im Fieber der Abendkasse verwandeln sich die Dinge und die Menschen – vor der Billettkasse genauso wie darin. Manieren gehen flöten, Höflichkeit wird zur Königsdisziplin, das Verließ des Kassenfräuleins zum Schutzbunker, die wartende Menschenmenge zu einem Wesen mit fünfzig Köpfen und ebenso vielen glühenden Augenpaaren, das vor der Kassenluke lauert, wittert, argwöhnt, knurrt. Abendkasse! Mir graut's vor dir.
Weil zu Goethes Zeiten das Telefon noch nicht erfunden war, liest man im FAUST nichts von Telefontragödien. Das Telefon ist die Gnadenpforte des 21. Jahrhunderts. Bevor der Strom am Abend leibhaftig zur Bude drängt, zwängt er sich tagsüber ohne Unterlass durch schmale Telefondrähte. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen, Wünsche und leider auch Enttäuschungen darin Platz finden. Es ist erstaunlich, dass ein Telefon nie heiser wird. Lange Zeit bin ich gern ans Telefon gegangen. Lange Zeit war es ein Hort schöner Stimmen, starker Dialoge, erheiternder Sprachbeugungen: „Zwei Karten für ‚Flutsch‘ bitte. Einmal ermäßigt und einmal voll daneben.“ Mittlerweile nisten auch in den Telefonleitungen viele maulende Myrten mit nachvollziehbar sinkender Frustrationstoleranz. Mittlerweile regiert auch hier die Monotonie der schmerzlichen Wiederholung: „Leider ausverkauft. Vielleicht im nächsten Monat wieder.“ In zwei Monaten werden wir nicht mal mehr das sagen können. Dann hat das anstrengende Ende ein Ende. Kein Grund zur Freude. Billetts verkaufen. Hadern.
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
1Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Eine Tragödie. Hrsg. v. Albrecht Schöne, Frankfurt a. M., Leipzig 2003, S. 15.
Der Vorstandsvorsitzende lächelt, sein Device misst eine erhöhte elektrodermale Aktivität, minimal beschleunigten Puls, aber kein Grund zur Aufregung: Schon blinkt ein Smiley auf dem Display, alles in Ordnung – allmählich erreicht er seine Betriebstemperatur: Performance-Modus. Die Projects sind noch immer das ehrgeizigste privatepublic Redevelopment-Projekt, zumindest in der westlichen Hemisphäre, aus Abu Dabi ist Masdar bekannt, Songdo in Südkorea, vielleicht noch die wesentliche kleinere von Panasonic betriebene Sustainable Smart Town in Fujisawa, Japan, aber sie alle haben auf jeweils unterschiedliche Art und Weise eine ungünstige Entwicklung genommen. Jedenfalls sind die Yards ein bis dato unübertroffenes Sozialexperiment, allein im letzten Jahr beliefen sich die Besucherzahlen auf durchschnittlich 68 000 am Tag, Tendenz nach wie vor steigend. Die 22 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifizierten Hochhäuser weisen neben der Wohnfläche insgesamt 1 540 000 Quadratmeter Gewerbe-, Verkaufs- und Bürofläche auf, hinzu kommt ein zusätzlicher Wohnkomplex, der in südlicher Richtung an die Orchid Gärten anschließt. Die Yards beherbergen insgesamt 118 Läden, zwei Cafés, eine Bar, zwei Restaurants, ein Luxushotel mit 225 Betten, sowie einen Veranstaltungsort, eine öffentliche Schule mit 340 Plätzen, einen öffentlichen Public Square, sowie den Orchid Park, der sich über sechs Straßenzüge bis zur 37. Straße im Westen erstreckt. Insgesamt können bis zu 32 000 Menschen in den Yards wohnen, eine Stadt in der Stadt, die sich über vier Blöcke in nordsüdlicher, sechs Blöcke in ostwestlicher Richtung ausdehnt, aber all das wäre kaum der Rede wert – wäre diese Stadt nicht schlauer als jede andere Stadt in der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Der Vorstandsvorsitzende lächelt. Kein Ort, der eine höhere Dichte an elektronischen Chips und Sensoren aufwiese. Nach drei Jahren können die Betreiber der Projects, die eng mit der örtlichen Universität und einem Verbund internationaler Forschungszentren zusammen arbeiten, auf umfassende Datensätze zurückgreifen, Fußgängerströme, Verkehrsflüsse, Luftqualität, Energieverbrauch, Müllentsorgung, Recycling – sämtliche Zu- und Abflüsse in und aus der Stadt werden kontinuierlich erfasst. Der Energieverbrauch konnte in den ersten drei Jahren drastisch reduziert werden, nur über die aufgewendete Energie der Rechnerleistungen, die in einem siebenhundert Kilometer entfernten Rechenzentrum in Echtzeit verwaltet werden, liegen nach wie vor unterschiedliche Zahlen vor. Zudem ist der Wasserverbrauch gesenkt worden, ein Teil des Abwassers wird direkt in den Yards recycelt. Ebenso zählt die Kriminalitätsrate zu den niedrigsten. Die autonome Reglung von Verkehrs- und Fußgängerströmen hat Menschenansammlungen, egal ob linien-, pulk- oder traubenförmig, trotz der gewaltigen Besucheranstürme weitgehend aufgelöst, der Vorstandsvorsitzende lässt an dieser Stelle stets seine langgliedrigen Finger, als gälte es, die Explosion eines Feuerwerkkörpers zu simulieren, fächerförmig auffliegen, die Hände eines Zauberers, der das weiße Kaninchen soeben in seinem Zylinder verschwinden lässt. Hinzu kommen erschöpfende Daten zu den Bewohnern, Angestellten und Besuchern, deren Lebensgewohnheiten und -qualität, Gesundheit, Happiness Index oder Aktivitätslevel betreffend, sei es hinsichtlich der Infrastruktur im Großen oder des Mikromanagements der Aktiv-Homes im Kleinen, die von der Elektrizität über Temperatur, Lüftung und Licht, bis hin zu Reinigungs- oder Lebensmittellieferdiensten weitgehend selbsttätig gesteuert werden. Die Projects werden von dem visionären Ehrgeiz getragen, das beste living urban environment der Zukunft zu sein – und im Rückblick hat sich die Vorgehensweise, die smarte Technologie der Stadt- und Gebäudeplanung von Anfang an als zentrales Gestaltungselement zugrunde zu legen, gegenüber Initiativen, die versuchen, bestehende Strukturen nachträglich umzurüsten, als weitaus überlegen erwiesen. Der Vorstandsvorsitzende hält sämtliche Daten auf Abruf bereit, in Vorverkaufsgesprächen und Verhandlungen hat er sie bis zur Ermüdung wiederholt, jetzt, mit dem Blick auf den Cisco-Tower im Hintergrund, mit 233 Metern das höchste Gebäude der Yards, zu seinen Füßen das pulsierende Stadtleben, kann er die Umgebung für sich sprechen lassen. Er entspannt sich, lässt seinen Blick über die mit Stoff bedeckten Häupter der Delegationsmitglieder hinweg durch die Glasfront und langsam hinaus ins Freie schweifen.
An der Ecke 29. Straße und 10. Ave. ist kurzzeitig eine Lücke entstanden, ein Durchgang, der über den Eingangsbereich einer Bank erneut auf die 10. Ave. zurückführt, und der sofort von einigen Demonstranten genutzt wird, die abseits der Masse gestanden hatten. Als sie aus dem Schatten des Eingangsbereichs auf den Gehsteig der 10. Ave schnellen, ihre Bewegungen im Vergleich zu denen der Polizisten leichtfüßig und wendig, tragen sie ihre hautfarbenen Halstücher, die zuvor noch in der Gesäßtasche oder lose um den Hals geschlungen waren, plötzlich um das Kinn gebunden und bis über die Nasenspitze hochgezogen, die eine oder andere Strumpfmaske ohne großen Ehrgeiz mit menschlichen Gesichtszügen bemalt, Mund, Nase, Ohren, auf der Schädeldecke ein zerpflücktes Wollnest, zudem die ein oder andere Sonnenbrille. Sofort geraten die Polizisten in Bewegung, einige versuchen den Durchgang durch den marmorgetäfelten Eingangsbereich der Bank zu blockieren, wohin schon weitere Demonstranten nachdrängen. Die Polizisten stemmen sich dem Strom mit ihrem gesamten Gewicht entgegen, die Knüppel waagrecht mit beiden Händen wie die Chromreling einer Jacht umklammernd. Ein Polizist, der in die Knie geht, kugelt sich in eine fötale Stellung, bevor ihm Kollegen zur Hilfe eilen; erst jetzt wagt er, seine Füße wieder auszustrecken, den Kopf aufzurichten, mit der Unbeholfenheit eines auf dem Rücken liegenden Käfers wendet er sich um, rappelt sich auf. Auf der Straße versuchen unterdessen Demonstranten vereinzelt die Frontformation der Polizisten zu durchbrechen, die sich aufgrund der Unruhe stellenweise gelichtet hat; bevor die Polizisten unter den energischen Rufen ihrer Kameraden die Lücken erneut schließen, diesmal rücken sie noch enger zusammen, die Leiber von Warmblütlern, die einander nichts als sich selbst zum Schutz gegen die Kälte zu geben haben. Eine kleine Schar, die mit langen Schritten die 10. Ave. hinaufjagt, gefolgt von Polizisten – offiziell wurde ein Vermummungsverbot verhängt –, drei Demonstranten haben die Ordnungshüter bereits erwischt, kesseln sie ein, greifen sie an Armen und Knöcheln, behandschuhte Fäuste, die packen, was sie zu fassen kriegen; wer das Gehen verweigert, wird an Händen und Füßen zum Mannschaftswagen geschleift, hier und da entblößte Hüften, Bäuche, die zwischen Stiefeln und Kampfuniformen sichtbar werden. Noch immer warten die Polizisten auf Anweisungen, an der Straßenmündung sind die Demonstranten noch weiter vorgerückt: Hände skandierend erhoben, halten mobile Endgeräte – Fotos, die geschossen, Videos, die aufgenommen, Text, der versendet, Nachrichten, die empfangen, Neuigkeiten, die verfolgt, Absprachen, die getroffen, Botschaften, die gepostet, Kommentare, die geteilt, Posts, die geliket, Trends, die angestoßen werden, dazu die immer gleichen Parolen, die langsam verebben, aber nur um mit erneuter Emphase angestimmt zu werden, als plötzlich zwei der drei Drohnen, die bisher in einer Dreieckskonstellation in zwanzig Meter Höhe nahezu bewegungslos über der Kreuzung schwebten, nur hin und wieder von einer Windböe ergriffen und aus ihrer Position geworfen, in einer Diagonalen hoch auffliegen, und sich in der Straßenschlucht Richtung 9. Ave. dem Blickfeld entziehen.
Im Konferenzsaal im 52. Stock des Orchid-Towers haben sich die von der Holding engagierten Juristen unabhängig voneinander jeweils einen der Verträge, die in zwei Stapeln nach Sprachen getrennt in mehrfacher Ausfertigung zwischen ihnen lagern, vorgenommen. Daumen und Zeigefinger an der Falz, lassen sie die Seiten durch die Finger gleiten, als wollten sie beiläufig kontrollieren, dass ihre Anliegen noch immer kleingedruckt im Verborgenen liegen. Es ist mittlerweile der vierte Vertragsentwurf, die Verhandlungen sind auf einem guten Weg. An dem Zuschlag hängt nicht nur das Interesse der Holding, sondern das der Stadt, die von dem Auftrag auf vielfältige Weise profitieren würde. Darüber hinaus treibt der Vorstandsvorsitzende die Verhandlungen mit einem persönlichen Ehrgeiz voran, Ende des Jahres wird er aus der Holding ausscheiden, seit eineinhalb Jahren setzt er deshalb alles daran, dass die Vertragsabschlüsse noch in seine Amtsperiode fallen. Dreimal sollen die Yards in identischer Bauweise in die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft und dort mehr oder weniger schlüsselfertig errichtet werden. Der Vorstandsvorsitzende geht die Gesichter der Delegationsmitglieder durch, sie sind scheinbar alle in dieselben Kopftücher gefasst, unklar, ob es sich um teure Stoffe oder einfache Baumwolle handelt, der Vorstandsvorsitzende kann keine eingewebten Muster erkennen, er muss unwillkürlich an Bettlaken, dann Kopfkissenbezüge denken, versucht diese Assoziation aber sofort wieder wegzudrängen. Selbst die geflochtenen Kordeln, die um die Stirn gebunden sind, wirken in ihrem einförmigen Schwarz eher wie touristische Ramschware. Der Vorstandsvorsitzende zwingt sich, jeden einzelnen der Delegationsmitglieder für mindestens zwei Sekunden zu fokussieren. Die Delegationsmitglieder erwidern seinen Blick ihrerseits alle mit ernster, geradezu feierlich wirkender Miene – selbst von den Kellnerinnen lassen sie sich kaum ablenken, man hatte sich im Planungsstab vorab sogar über die Rocklänge verständigt: Und in der Tat lassen die Kellnerinnen jetzt an Stewardessen von Emirates denken, vielleicht Arabian Airlines: cognacfarbene Blousons mit Dreiviertelärmeln und blutroten Nähten, um die Hälse transparente, nur von einem Rotschimmer durchwirkte Seidenschals – verwaltete Herzen, ganz um das Wohl ihrer Klienten besorgt. Vor dem aufgewühlten Himmel, der hinter der Glasfront tobt, hat dieses Bild durchaus seine Richtigkeit, sinniert der Vorstandsvorsitzende, bei dem Gedanken hellen sich seine Gesichtszüge umgehend auf.
Eigentlich moderiert er den Übergang zu den Verhandlungen an diesem Punkt mit einer Anekdote, noch besser sind Fun Facts, sie funktionieren immer, es ist immer wieder verblüffend, selbst bei einem kulturell oder ethnisch diversen Publikum: Dienstags wird in den Yards am wenigsten Alkohol konsumiert, freitags am meisten; Auswertungen haben ergeben, dass Becks-Trinker eher rechtskonservativ wählen, Cognac-Trinker linksdemokratisch; gleiches gilt für Porsche- und BMW- vs. Google-, VW- und Mercedesfahrer; die englische Bulldogge ist das beliebteste Haustier unter den O-Yanern, so der Spitzname, der sich für die Bewohner der Orchid Yards eingebürgert hat. Und überhaupt wurden in den Yards bisher mehr Hunde als Kinder zur Welt gebracht, aber das liegt wohl auch an einem unseriösen Hundeausgehservice, der sich mittlerweile gegen eine Sammelklage vor Gericht verantworten muss. – Jedenfalls folgt an dieser Stelle nichts, was ausdrücklich in seinem Redemanuskript vermerkt wäre, darin ist er gut, vor allem kommt es gut bei einem Publikum an, das gewohnt ist, Vorgefertigtes zu schlucken, Informationshappen, zum sofortigen Verzehr durch einen numerischen Fleischwolf gejagt, der seine Wirkung zwar nicht verfehlen, aber sehr wohl mit einem hohen Sättigungsgrad seiner Zuhörer rechnen muss. Dennoch verbucht der Vorstandsvorsitzende die Abschweifungen spontan als nicht zielführend, plötzlich von einem Wunsch nach klaren Worten gepackt: „In den Yards fragen wir nach dem Was“, erklärt er jetzt, die Aufmerksamkeit der Zuhörer erneut auf sich ziehend, „nicht dem Warum. Es ist das Interesse an Möglichkeiten, nicht an Gründen, die den Erfolg der Projects verantworten, und die die Energien freigesetzt haben, um ein Gesamtkonzept für ein zukunfts- und adaptierfähiges Stadtleben aus der Taufe zu heben.“
Auszug aus „Orchid Yards“, in: Philipp Schönthaler "Vor Anbruch der Morgenröte“, Matthes & Seitz Berlin, erscheint demnächst
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
siehe auch Denkzeichen LXXVIII, Michael Birn, 7. April 2015, No Future - A Masterplan
Auf einer Skala von eins bis zehn, und eins wäre, sagen wir eine Nacktschnecke in deinem Kaffee und zehn wäre, dass der Tod abgeschafft werden würde, dann ist das hier schon eine acht. Von der Stadt hat man eigentlich nicht viel gesehen. Wir fahren mit dem Taxi einmal an dem Kopf von Karl Marx vorbei und ich denke, den kann ich mir auch morgen noch angucken. Am nächsten Tag fahren wir wieder mit dem Taxi an dem Kopf vorbei, ich überlege, ob wir kurz aussteigen sollen, um ein Foto zu machen, aber mein Handy ist aus und so wichtig ist mir der Kopf von Karl Marx irgendwie doch nicht. Es regnet, es ist grau und die Leute sprechen tatsächlich sächsisch. Ich hatte mir die Stadt großzügiger vorgestellt. Sie ist dann doch dichter bebaut als gedacht. Der Abend war windig, ich stehe in der Bahnhofshalle und der kalte Wind lässt mich frieren. Es sind wenig Leute unterwegs, im Backwerk sitzen ein paar ältere Grüppchen und trinken Kaffee. Ich geh kurz rein und schaue in alle Ecken, ob es irgendwo eine Steckdose gibt. Es gibt aber keine. Vielleicht trinke ich auch einen Kaffee – wer weiß, wann ich abgeholt werde. Es ist Weihnachten und ich bin hier, weil ich mal was erleben wollte. Warum die anderen hier sind, weiß man nicht. Ich werde mich nicht in das Backwerk setzen. Ich stehe vor dem Backwerk neben dem Mülleimer, eine Taube pickt daneben im Abfall.
Vögel sind ein Abschied, sind ein Wiedersehen. – Absurd jetzt an Heiner Müller zu denken, aber der war schließlich auch mal hier in der Stadt oder nicht? Oder ist der nicht auch hier geboren oder in der Nähe? Die Taube ist weder Abschied noch Wiedersehen, sie ist die Taube vom Backwerk. Sie ist keine Verheißung, aber sie sieht gesund aus, gutes Grau, kräftig und irgendwie sauber. Am Ende der großen Halle ein kleiner heller Kopf, suchende Augen. Der Kopf grinst. Mittlerweile ist mir so kalt, dass ich angefangen habe zu zittern.
Eigentlich will ich auch grinsen, aber ich habe das Gefühl, ich gucke verkniffen. Andrej holt Geld am Automaten, er beobachtet mich, wie ich die Halle betrachte. Ich merke, wie er mich beobachtet. Er weiß, dass ich weiß, dass er mich beobachtet. Wir müssen grinsen. Ihm gelingt es ganz gut, mir eher mittelmäßig. Man fragt sich, wo das herkommt, dieses ganze Romantisieren dieser ostdeutschen Städte, das den Kindern aus dem Prenzlauer Berg so anhaftet, die Sehnsucht nach dem Oderbruch, die verklärten Augen, wenn man ein Arbeiterdenkmal sieht und mit welchem Klang man die Namen der Städte ausspricht – voller Verheißung, als wären sie alte Weihstätten: Rostock, Magdeburg, Leipzig und Karl-Marx-Stadt, die heute anders heißt. Aber das ist auch so eine Angewohnheit, die neuen Namen nicht zu benutzen und so heißt die Danziger Straße immer noch Dimitroffstraße und die Frankfurter Allee immer noch Stalinallee und dann sagen wir auch gerne Kaufhalle mit einem ironischen Grinsen im Anschluss und die Eltern haben das irgendwie gar nicht. Das haben irgendwie nur wir. Das Taxi fährt in die Innenstadt, Andrej zeigt auf ein paar Gebäude und erklärt sie für mich, wir fahren an Karl Marx vorbei – der Eiffelturm dieser Stadt, denke ich. Voller Hochachtung betrachte ich den breiten Boulevard, die schönen sozialistischen Fassaden. Es gibt ein Café Moskau wie in Berlin. Die Stadthalle – ein wunderschöner Mehrzweckbau, sieht ein wenig aus wie ein Korallenriff, und bevor ich es beeinflussen kann, bin ich ein kleines bisschen verliebt, verliebt in Karl Marx Stadt. Die Straßen sind leer, es nieselt, wir suchen ein Restaurant. Als der Pernod leer ist, würde ich eigentlich gern noch einen trinken, aber ich will vor dem Theater nicht schon betrunken sein. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist das gefährlich und sowieso muss man so viele Menschen zwischen den Jahren treffen. Also werde ich schon genug betrunken sein – die nächsten Tage – heute können wir getrost etwas später mit dem Betrinken anfangen.
Wir gehen die Straßen entlang, alles scheint sich auszuruhen, der Gehweg hat sich hingelegt, die Laternen leuchten nur mit halber Kraft, die Geschäfte gönnen sich einen kleinen Powernap. Ein ewiger Sonntag! Vielleicht ist es sonst gar nicht so anders, könnte man meinen. Es brennen nicht viele Lichter in den Fenstern, vielleicht schlafen ja tatsächlich alle. Es kommt uns vor, als wäre es schon weit nach Mitternacht, dabei haben wir noch so viel vor. Von weitem erkenne ich am Ende der Allee wieder den großen schwarzen Kopf von Karl Marx, die zweitgrößte Portrait-Statue der Welt. Ich glaube mich zu erinnern, dass sie den Kopf nach der Wende entfernen wollten oder es sogar getan haben, aber jetzt steht sie jedenfalls da. Ein riesiger Kopf, das war wohl das wichtigste an diesem Menschen, sein großer Kopf, und es ist ausnahmslos eine Ehre, so bombastisch dargestellt zu werden – an so einem prominenten Ort in der Stadt. Und doch hat es etwas von einem Kopf, der als Trophäe dort aufgebahrt wurde, gerade eben vom Rumpf getrennt, von der Guillotine abgesäbelt und jetzt als Mahnung und zur Abschreckung dort niedergelegt wurde – und jeden an die Schuld dieses Kopfes erinnern soll.
Zwei Schritte weiter ist er verschwunden, der Kopf. Wir gehen beide in die Nacht, die Städtenamen auf den Schildern an den großen, breiten Straßen tragen Namen, die ich noch nie gehört habe. Die Häuser sind bestimmt aus den fünfziger Jahren, sie besitzen wenig bis gar kein Dekor und sie erinnern mich an diesen calvinistischen Stil, in dem so viele Häuser in Zürich gebaut wurden. Stellt sich die Frage, wie das nun im Zusammenhang steht, dieser Sozialistische Klassizismus und das Calvinistische. Darüber könnte man ja jetzt reden mit ihm. Vielleicht interessiert sich Andrej auch für Architektur, das weiß man nicht, ob er das Gleiche fühlt beim Anblick des Farnsworth-Hauses oder so etwas Ähnliches. Kurz wird geschlafen, mein Kopf sagt mir, es sei circa vier Uhr nachts, es ist aber kurz nach halb sieben und wenn wir noch ins Theater wollen, müssen wir jetzt die Karten abholen. Das Stück ist ein Klassiker, Weihnachten ist auch ein Klassiker, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Während wir Whiskey in der Theater-Bar trinken, streiten wir ein kleines bisschen über den Spielplan allgemein und über die Position des Struwwelpeters im speziellen. Streiten ist vielleicht ein wenig übertrieben, denn eigentlich diskutieren wir nur etwas lauter. Dann plötzlich läuft das Lied der unruhevollen Jugend in meinem Kopf, und ich bedanke mich bei meinem Kopf. Wir reden also angeregt über das Theater, und das Lied der unruhevollen Jugend nimmt sehr viel Platz ein in meinem Kopf. Ich versuche trotzdem bei der Sache zu bleiben. Andrejs Worte werden leiser, das Lied in meinem Kopf wird lauter, Andrejs Lippen bewegen sich energischer, er scheint dran zu sein, an irgendeiner Sache. Mein Kopf bewegt sich im Rhythmus des Zustimmens, ich versuche irgendwas zu verstehen, aber es ist das große Finale des Liedes in meinem Kopf und ich höre absolut nichts anderes mehr. Zum Glück klingelt es und wir machen uns auf den Weg zum Zuschauerraum, schlängeln uns etwas ungalant und arrogant zwischen den Bürgern dieser Stadt hindurch, betrachten skeptisch die Szene. Wir wissen beide, worauf wir uns hier eingelassen haben, das war der Plan, das war die Idee, wir wollten ins Theater gehen.
Der Rest des Abends verschwimmt irgendwie zu vielen Gesprächen über dasselbe, wir essen irgendwas mit Sahne, trinken mehr und mehr Rotkäppchen Sekt, mal Rosé, auch mal halbtrocken, zwischendurch auch Pernod und Wodka. Vor Andrej werde ich nicht den Kürzeren ziehen, ich werde jeden Wodka bis zum bitteren Ende trinken, betrunken zuhören, versuchen souverän zu tun und egal, wie abwesend ich schon bin, trotzdem alles aufzusaugen. Ich wache auf, weiß kurz nicht, wo ich bin. Das Fenster steht halb offen, es ist kalt. Kurz überlegen, was alles passiert ist und was nicht. Andrej und der Typ, dem die Wohnung gehört, haben russische Lieder gesungen - das war schön. Andrejs Stimme ist im Russischen sehr weich. Etwas aggressiv die Stimmung grundsätzlich, also nicht zwischen ihm und mir, aber trotzdem gut, das hat mir alles sehr gefallen. Es regnet draußen. Durch die Scheiben des Taxis erkenne ich den Kopf von Karl Marx, wir rasen zum Bahnhof. Er steigt in seine Mitfahrgelegenheit ein – in irgendeine westdeutsche Stadt. Ich muss noch auf meinen Zug nach Leipzig warten. Die Verabschiedung ist sachlich, ich könnte ihm in diesem Augenblick sagen, was ich denke, aber das wäre dumm und völlig unpassend, deswegen sage ich etwas sehr Allgemeines. Die Stadt hab ich gar nicht gesehen, also muss ich wiederkommen, vielleicht im Sommer und dann die Geschichten hören. Der Junge hat bestimmt viel erlebt, denke ich.
Im Zug fällt mir ein, dass sich meine Eltern nach meiner Geburt zwischen Berlin und Karl-Marx-Stadt entscheiden konnten. Und sie haben sich für Berlin entschieden.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Vor mehr als zwanzig Jahren schickte die New York Times ihre Reporter quer durch die Vereinigten Staaten. Sie sollten herausfinden, wie ganz normale Bürger wirklich lebten und dachten. Zuvor hatten zahlreiche Leserbriefe das Blatt erreicht, deren Verfasser erbittert Klage über die Veränderungen führten, die in ihrem Berufs- und Alltagsleben seit den frühen 1980er Jahren eingetreten waren. Davon leitete sich der Auftrag der Emissäre ab: „What we sought was to document real suffering, psychic as well as material, among millions of Americans“. Das Ergebnis der Recherche erschien 1996 unter dem Titel „The Downsizing of America“ im hauseigenen Buchverlag der Zeitung.
Die einzelnen Reportagen sowie das umfängliche statistische Material vermittelten dem Leser das Bild einer tief gespaltenen Nation. Frauen und Männer der weißen Mittelschicht, dieser tragenden Säule der US-amerikanischen Gesellschaft, berichteten von der Vergeblichkeit all ihrer Bemühungen, den schleichenden Zerfall ihrer Existenzgrundlagen aufzuhalten, von schließenden Fabriken, Massenentlassungen, von Verschuldung, erodierendem Gemeinsinn, wachsender Kriminalität. Die Klagen verstummten all die Jahre nicht, und wer einen Eindruck der seither weiter gewachsenen sozialen Kluft und Frustration gewinnen möchte, lese den Bestseller von George Packer „The Unwinding. An Inner History of the New Amercia“ aus dem Jahr 2013.
Drei Jahre nach dessen Erscheinen wird Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt. Die Leute in den prosperierenden Regionen reiben sich die Augen. Und gehen auf die Straße, wütend über den Mann, mehr noch über die Rückständigen, die Dummen, die ihm ins Amt verholfen haben. So wie Monate zuvor die ‚Zukunft des Vereinigten Königsreichs’ nach dem Mehrheitsvotum der Briten für den Brexit auf die Straße ging, voller Groll auf dasselbe Personal, das ihre und seine eigenen Interessen an Nationalisten und Populisten verriet.
Wie arrogant, wie bigott muss man eigentlich sein, um so zu reagieren? Wie realitätsblind, um Trumps Rede von den „invisible people“, den „forgotten people“ zähneknirschend wiederzukäuen? Unsichtbar, vergessen – von wem? Doch wohl von den gut Situierten, den gut Gescheitelten. Wie nur konnte ihnen über Jahrzehnte hinweg entgehen, dass da tief im Inneren ihrer Staaten etwas brodelte, etwas auszubrechen drohte?
Dieselbe Mischung aus Arroganz und Heuchelei in Deutschland, dieselbe Verachtung für PEGIDA-Demonstranten, AfD-Wähler, die „Brandstiftern“, „Rattenfängern“ folgten, also selber Zündler, Ratten und in jene Zone zu verweisen waren, in der man sein Recht auf öffentliche Meinungsäußerung verwirkt.
„Die historische Niederlage und Erniedrigung der arbeitenden Klassen Großbritanniens ist inzwischen das wichtigste Exportgut der Insel“, schrieb David Graeber im Heft 6, 2016 der „Blätter für deutsche und internationale Politik“. Glaubte irgend jemand ernstlich, die Individuen, die diese Klassen einst bildeten, würden sich in Luft auflösen? Sie verschwanden nicht, vererbten ihre Wut über das ihnen Angetane an die Nachwachsenden, und warteten gemeinsam mit diesen auf eine Gelegenheit, Rache zu üben.
Was wir seit geraumer Zeit erleben und wohl weiter erleben werden, ist die Wiederauferstehung der ihrer Repräsentanten und Organisationen entfremdeten bzw. beraubten Klassen als triumphale Abstrafungskollektive. Politikern, Meinungsführern, Demoskopen, die unentwegt verkünden, wie gut es allen geht, so gut wie nie, einen Strich durch ihre Rechnung zu machen, das Fürchten zu lehren, dazu reichen die zersplitterten Kräfte noch. Oder wieder, seit die Aussicht besteht, sie neu zu bündeln, Wahlen in unwägbare Zitterpartien für die Etablierten zu verwandeln.
Dabei nehmen die Wähler hin, „dass ihre Stimme ‚instrumentalisiert’ wird. Sie selbst haben das Mittel der politischen Wahl instrumentalisiert, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen.“ (Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, Frankfurt am Main 2016, S. 129). Die Schuld an dieser vertrackten Instrumentalisierung tragen jene, die es ablehnten, der Empörung Gehör zu schenken, ihr ein Ziel im Zentrum der Macht zu weisen. Den Abgehängten und Aufgebrachten zu ihrem Recht, nicht nur, wie alte und neue Populisten, zu ihrem Ausdruck zu verhelfen, wäre Aufgabe der Linken. Vom Ausdruck abgestoßen, zuweilen direkt angewidert, lässt sie dieses Recht auf sich beruhen und treibt ihre Klientel in die Arme ihrer Widersacher.
Um besser zu verstehen, wie es zu dieser abgründigen Entfremdung der einen von den anderen kommen konnte, mag ein kurzer Blick auf die Ambivalenz der „offenen Gesellschaft“ sowie ihre beiden konträren Hauptakteure hilfreich sein – die globale und die stationäre Klasse.
Dank ihrer Verfügung über knappe, begehrte Ressourcen streichen die Mitglieder der globalen Klasse die Prämien der offenen Gesellschaft ein. Verschlechtern sich die Verwertungsbedingungen an einem Ort, lösen sie sich davon und ziehen weiter. Ihre Vermarktungschancen erhöhen sich im selbem Maß, in dem sich ihr Aktionsfeld erweitert und entgrenzt. Für sie kann die gesellschaftliche Öffnung gar nicht weit genug gehen, weshalb sie politische Parteien unterstützten, offen oder verschämt, die den Interessen des „Marktvolks“ Vorrang gegenüber jenen des „Staatsvolk“ sichern.
Anders bei den Mitgliedern der stationären Klasse. Notleidend an Ressourcen ökonomischer wie kultureller Art, die ihnen Flügel verleihen könnten, dem Auf und Ab lokaler, regionaler Märkte alternativlos ausgeliefert, erleben sie die Entgrenzung des sozialen Raums als Gefährdung ihrer ohnehin prekären Existenz. Für sie geht die gesellschaftliche Öffnung immer schon weit genug, weshalb sie politische Parteien unterstützen, die ihnen soziale Garantien und Schutz vor noch weitergehenderer Öffnung offerieren. Infolge der Einschwörung ehedem linker Parteien auf das neoliberale Konzept der offenen Gesellschaft politisch obdachlos geworden, bleibt den Mitgliedern der stationären Klasse gar keine andere Wahl, als sich nach anderen Repräsentanten umzusehen.
Und das wirkt. Kurz nach dem Brexit kündigte Theresa May, die neue britische Regierungschefin, eine umgehende Wende der Wirtschaft- und Sozialpolitik zugunsten der arbeitenden Mehrheiten an, und soeben wärmte Angela Merkel den alten Slogan aus Wirtschaftswunderzeiten, „Wohlstand für alle“, auf. Waren da in der Vergangenheit etwa einige zu kurz gekommen, die man jetzt eiligst zufrieden stellen musste, ehe noch größeres Unheil geschah?
Was der Linken im Westen nie gelang, effektiven Druck auf die Eliten auszuüben, vermochte die neue Rechte fast im Handumdrehen. Sie erweckt den glaubwürdigen Eindruck potentieller Mehrheitsfähigkeit und das erschreckt die ökonomisch und politisch Mächtigen, nötigt diese, aus Angst, keinesfalls aus Einsicht, zu zumindest verbalen Zugeständnissen an die ominösen 99 Prozent. Aber besser das als gar nichts.
Statt auf die soziale Basis neurechter Strategen einzuprügeln hätten Linke und Linksliberale jede Veranlassung, über ihre Mitverantwortung an dieser möglicherweise säkularen Wende der politischen Repräsentationsverhältnisse nachzudenken.
Der Umgang der deutschen Linken mit Sarah Wagenknecht, der einzigen prominenten Figur in ihren Reihen, die aus dem eigenen Versagen Schlüsse zieht und um die Rückgewinnung der Verprellten kämpft, gibt hierzulande wenig Grund zur Hoffnung, dass der wiederholte Weckruf alsbald Folgen zeitigt.
Ins Haus steht gelegentlich der Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland, leider, eine neue Runde Selbstmitleid und Fremdanklage. So leicht werden sich die Wohlmeinenden von den Fakten nicht beirren lassen. Lieber faseln sie noch eine Weile vom Triumph des Postfaktischen über die Gemüter der sogenannten „einfachen Leute“. Da steht man zwar auf verlorenem Posten, aber wenigstens auf der richtigen Seite.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
iDie hier entwickelten Gedanken finden sich näher ausgeführt im jüngsten Buch des Autors: Authentizität! Von Exzentrikern, Spielverderbern und Dealern (Verlag Theater der Zeit, erscheint im März 2017)
Wolfgang Engler, geboren 1952, Soziologe, Rektor der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“
„Was? Wieviel kostet der!? Aha, und trinkst du oft solches Zeug? Diesen Whisky, sagen wir mal, pro Woche … macht also im Jahr …“ (rechnet)
„Komm, lass gut sein, Pro..st Neujahr.“
„Oha. (Zeigt die Summe auf dem Taschenrechner) Echt man, wenn du aufhörst zu trinken und jeden Tag was zur Seite legst, kannst du dir bald ne Wohnung leisten. Und wofür brauchst du eigentlich die Uhr? Ne, jetzt echt mal jetzt, wofür? Das Handy tuts doch auch. Hast keine Wohnung, aber ne Armbanduhr. Das ist doch n Witz. Spar lieber für die Wohnung.“
„Scheiße.“
„Nein echt, ich versteh dich nicht. Die ganzen Reisen nach Europa, wohin willst du da grad wieder? Allein die Tickets … (holt den Taschenrechner raus, rechnet) Dann das Hotel, und was essen musst du auch noch …“ (rechnet)
„Hör zu, ich geh jetzt.“
„Wart mal. Trinken wir aufs neue Jahr!“
„Ja. Frohes Neues.“
„Ich wünsch dir, dass du dir im neuen Jahr eine Wohnung kaufst. Ist auf den ersten Blick vielleicht unrealistisch, aber ...“
„AAAA.“
„Schon gut, ist ja gut. (Sitzen eine Weile schweigend da …) Aber mal im Ernst, wo würdest du dir gern eine Wohnung kaufen?“
„Fick dich, ok!“
„In welchem Bezirk? Warum denn so wütend? Aaha, verstehe. Ist ein wundes Thema nämlich. Brauchst eine Wohnung und hast keine. Wie mans dreht und wendet, gegen die Natur kommst du nicht an. Der natürliche Lauf der Dinge. Musst ja immer gegen den Strom. Wozu, das ist ein Naturgesetz, braucht der Mensch eine Wohnung? Na? Sag?“
„Ich bitt dich im Guten, hör auf.“
„Ja, tut er! Denn er braucht eine. Was ist die Bilanz deines bisherigen Lebens? – Keine Wohnung. Kannst dich halt nirgendwo wirklich zu Hause fühlen, entspannen, deswegen bist du so gestresst. Ich versteh das, ich bin nicht sauer. Ich war, weißt du, auch immer so angespannt, bevor ich die Wohnung gekauft hab.“
(Er, der andere, nimmt ein Messer vom Tisch und sticht zu, wieder und immer wieder. In den Rumpf, in den Hals. Aus dem Hals spritzt das Blut.)
„Im Guten hab ich dich gebeten.“
(Keucht und ringt nach Luft) „Warum, warum hast du das gemacht? Jetzt sperren sie dich ein, und du wirst dir nie eine Wohnung kaufen. Bist du denn normal? (Das Blut sprudelt nur so) Du bist absolut unpraktisch.“
„Sei still jetzt.“
(Er nimmt einen Stuhl und schlägt damit auf den Kopf seines Gegenübers ein. Der Stuhl zerbricht.)
„Nur weil du weder Wohnung noch eigene Möbel hast, kannst du noch lang nicht fremde Sachen zerschlagen.“
(Auf den Lärm hin kommen Frau und Kind angerannt.)
„Papa, Papa!“
„Pass doch auf, Spatz, nicht ins Blut mit den Söckchen, verteilst es bloß noch in der ganzen Wohnung. Ausziehn, sofort!“
(Sohnemann zieht die blutverschmierten Söckchen aus. Die Frau sieht ihren Mann mit einem Messer im Hals im Blut liegen.)
„Neeeeeein! Schnell, Schatz, beeil dich, hol einen Lappen. Das ganze Parkett versaut. Die schöne neue Wohnung. Hättet ihr nicht auf den Balkon gehn können.“
(Der Mann vergeht in Zuckungen und stirbt. Die Frau hält inne. Lange Pause. Der Sohn kommt mit dem Lappen angerannt. Die Frau weint.)
„Warum hast du das getan (zeigt unter Tränen auf die blutige Couch)? Auf ebay kann ich sie jetzt für n paar piefige Euro verschleudern. Hast nichts, was dir gehört, und auch keinen Respekt vor den Sachen der andern.“
(Das Kind rutscht auf dem Blut aus, schlägt mit der Schläfe auf der Tischecke auf, die Glasplatte zerbricht, das Kind stirbt.)
„Oh, Scheiße! Das Kind wollte ich nicht, das war eigentlich ganz ok. Entschuldige.“
„Jetzt auch noch das Tischchen! Das ist doch die Höhe, glaubst wohl, ich vergess jetzt das Tischchen?“
(Die Großmutter kommt dazu. Man spürt große Lebenserfahrung und Weisheit.)
„Der Kram lässt sich wieder ersetzen, Hauptsache, wir haben eine Wohnung ...“
FROHES NEUES 2017!
Aus dem Russischen von Jennie Seitz
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Сколько? Сколько стоит? Так, а ты такой виски часто пьешь? Ну в неделю даже если. Так это в год выходит… (считает)
Ну ладно, хорош, С наступаю…щим.
Ого. (показывает сумму на калькуляторе) Блин, если тебе бросить пить и откладывать каждый день, ты квартиру можешь быстро купить. Слушай, а вот часы тебе зачем. Нет, ну правда, зачем? Время можно на телефоне смотреть. Квартиры нет, а часы покупаешь. Это просто смешно. Лучше бы на квартиру отложил.
Блядь.
Нет ну правда я тебя не понимаю. Все эти поездки в Европу, куда сейчас ты там собрался? Так это билеты стоят … (достает калькулятор считает) а еще гостинница да, ну там поесть что-то надо (считает)
Слушай, я пойду.
Подожди. Давай с Новым годом!
С новым годом.
Я тебе желаю в новом году купить квартиру. Пусть это на первый взгляд желание несбыточное, но…
АААА.
Ну все все. (Сидят, какое-то время молчат) Ну правда, а вот где бы ты хотел купить квартиру?
Иди на хуй, а?
В каком районе? Вот ты почему сейчас злишься? Аааа. Я понял. Потому что тема-то больная. Нужна квартира, а ее нет. Как ни крути, против природы не попрешь. Естественный ход вещей. Вот ты всегда против течения. Зачем? Это естественный закон. Человеку нужна квартира? А? Ответь?
Прошу по-хорошему, прекрати.
Нужна! Каков итог прожитой жизни твоей? Нет квартиры. Просто ты нигде не можешь себя почувствовать по-настоящему дома, расслабиться, поэтому такой нервный. Я понимаю, я не обижаюсь. Я знаешь тоже пока не купил квартиру на нервах весь был.
Его собеседник берет нож со стола и много много раз втыкает его в тело. В туловище, в горло. Из горла хлещет кровь.
Просил помолчать?
(хрипит и задыхается) Зачем, зачем ты это сделал? Теперь тебя посадят и ты никогда не купишь квартиру. Ну ты нормальный человек? ( Фонтаном льется кровь) Абсолютно непрактичный.
Замолчи.
Собеседник берет стул и многократно бьет его по голове. Стул ломается.
Если у тебя нет квартиры и своей мебели, это не значит, что можно не ценить чужую мебель .
На шум прибегает жена и ребенок.
Папа, папа.
Сынок, ну куда ты в кровь чистыми носочками, сейчас разнесешь по всей квартире, срочно снимай.
Сынок снимает запачканные кровью носочки.
Жена видит мужа в крови с ножем в горле.
Ааааа. Быстрей сынок, быстрей, беги, неси тряпку. Весь паркет загадили. Ведь только купили квартру. Могли бы и на балкон пойти.
Муж умирает в конвульсиях. Жена останавливается. Долгая пауза. Прибегает сынок с тряпкой. Жена плачет.
Ты зачем это сделал (сквозь слезы показывает на заляпанный кровью диван)? Я теперь его только за копейки на авито могу продать. Вот, своего ничего нет, ты и чужого не умеешь ценить.
Ребенок поскальзывается на крови, падает виском на угол стола, стеклянная крышка журнального столика разбивается. Ребенок умирает.
Ой, бля! Ребенка я не хотел, он вроде нормальный был. Извини.
И столик еще! Это верх цинизма, ты что думаешь я забуду теперь про столик?
Приходит бабушка.Чувствуется огромный жизненный опыт и мудрость.
Это дело наживное, главное квартира есть...
С НОВЫМ ГОДОМ 2017 ГОДОМ!
Wir haben uns davor zu fürchten, dass wir uns an solche Terrorakte gewöhnen und schmerzloser werden gegenüber denen, die sie für ihre menschenfeindlichen Argumentationen zitieren. Wir haben erschreckt und schon fast wie selbst betroffen menschlich zu reagieren. Wir müssen, wie es mein großes Vorbild in Sachen Literatur, Adolf Endler, gesagt hat, die Brennesseln in unsere Tastaturen stecken, dass wir uns an ihnen verbrennen, stets wieder neu entzünden. Was wir auf keinen Fall gebrauchen können, für jede Form von Kunst gelten muss, die wir betreiben, ist Abhärtung und Abstumpfen. Der Terror darf sich nicht in unsere Weichteile fressen. Wir müssen empfindlich wie nackte Wesen bleiben. Es gibt keinen besseren Schutz, als die blankgeriebene Haut für uns.
*
Für mich ist jeden Tag Terrortag. Ich bin da zugegeben ein wenig übertrieben vorsichtig, verhalte mich paranoid, denke ich. Aber was will ich gegen meine neue Routine tun? Klaus, mein Kumpel, der mit mir fühlt, eventuell so gar versteht, ist in seinem Leben durch Milzbrand und Talibangefahr verunsichert. Wir können beide nicht mehr sorgenfrei in die Stadt gehen. Wir halten Ausschau, unauffällig. Wer uns kennt und beobachtet, wird den neuen Zug an uns entdecken. Was heisst denn neu an diesem Zug? Wir schauen seit fünfzehn Jahren danach aus, ob die Welt sich seit dem 11. September grundlegend verändert hat. He, he. Und wir können, nein, müssen sagen: Kinder, echt einmal! Man muss doch nur zum Alexanderplatz pilgern. Wo wenn nicht an diesem unverrückbar gleichbleibenden Ort, lässt sich die allerkleinste Veränderung nachweisen? Wir verlassen uns nicht mehr auf die nach aussen hergezeigte anheimelnde Marktplatzsicherheit am Bummelrondell. Uns schützen Uniformen nicht. Wir meiden Menschenansammlungen sowieso.
Ich komme von der Ostsee, da ist jedes Jahr Saison. Da tummelten sich Menschen über Menschen in Nackte und Nichtnackte eingeteilt am Strand. Oh wehe dem, sie tummeln da noch heute mit Sicherheit. Nein, nein. Wir lassen das schön aus, dieses Gewimmel, von dem Goethe gefaselt hat, dass er es sehen will und unter all ihnen wandeln. Wir marschieren gegen das Ticken der Weltzeituhr, weg von den Leuten, der Herde, den Gruppenbildungen, Rudeln. Ich nehme lange schon niemanden mehr ein Gepäckstück ab, nicht einmal der jungen Frau Nachbarin ihre beiden schweren Einkaufstaschen. Nicht einmal, um zu ermessen, für welche Art Sprengsatz sie sich entschieden hat. Ich stelle gezielte Fangfragen. Was da eine um diese Uhrzeit so Seltsames mit sich herbei schleppt? Warum sie in Berlin bleibt, obwohl sie doch in Stuttgart wohnhaft war? Wer sie hierher nach Berlin geschickt hat? Wie sie an den feinen Lehrstuhl an der Universität gekommen ist? Welchen ausländischen Hinz und Kunz sie dort kennt? Und die legt ihren schönen Kopf zur Seite, wenn ich beschließe, sie einer spontanen Taschenkontrolle auszusetzen. Und dann finde ich etwas und frage sie streng, aus welchen Gründen sie Backpflaumen statt frische Cocktailtomaten bei sich führt? Was sie mit dem Ökoheinz um die Ecke täglich zu tuscheln hat? Ja, täglich und Tuscheln ist das ja wohl lange schon nicht mehr. Sie lacht ungehalten drauflos. Ihre weißen Zähne blitzen blitzen mich an wie ein Bekennerschreiben. Sie zeigt erst meinem Kumpel Klaus, dann mir einen heftigen Vogel, tippt den Zeigefinger an ihre Stirn. Das wollen wir uns merken. Da werden wir mal intensiv recherchieren, was das in anderen Kulturkreisen bedeuten mag, dahinter stecken könnte. Gewiss. Und hat die Traute, echt einmal, stellt uns gegenüber glucksend klar, sie werde doch wohl ihre Pflaumen einholen dürfen, wo immer sie die kaufen wolle. Wenn die gekauft worden, nicht an sie übergeben worden sind, kontere ich blitzgescheit, betone, dass es uns einzig um unsere ganz persönliche Sicherheit geht, wir nicht mehr nach Freund und Freundin unterscheiden wollen, wir nun mal irrelevante Abweichungen im Verhalten von Bekannten registrieren müssen.
Gerade gegenüber dem eingeschlichenen Freundeskreis, für den man gar nicht kann, von dem man oft nicht weiss, wie er zustande kam, warum man immer noch zu ihm gezählt wird, sollte jedermann unerbittlich hart sein, erkläre ich mich ihr gegenüber offen. Der wahrhaftige Terror fängt nach wie vor nämlich in der Familie und unter Freunden an, sogenannten, unbekannten Freunden, die es unüberprüft das Leben lang sind, nein sein wollen. Nix da mehr weiter. Hier muss Abkehr und Verdächtigung her. Und also begleiten wir die verwirrte Pflaumenkäuferin in ihren Stadtbezirk, an ihre Haustür zurück und warten etwa zehn Minuten vor der Tür darauf, dass sie nicht zurückkehrt oder heimlich an uns vorbeihuschen will. Erst dann gehen wir Richtung U-Bahnstation und umsichtig schnell, und vor allem sehr leise an ihr vorbei. U-Bahn nehmen wir lange schon nicht mehr. Wir laufen zu Fuss. Wir wechseln nach Zufallsprinzipien die Bürgersteige, und wenn uns das so vorgeschrieben wird, gehen wir Umwege, nur um selbst nicht in Gefahr zu geraten – wie der dem Terror gegenüber vorbehaltlose Alexander Osang geradezu leidenschaftlich vor jedweder U-Bahnbenutzung weltweit warnt und seit zehn Jahren, heutzutage noch verstärkter, in New York lieber zu Fuß geht, als erschossen oder in die Luft gejagt zu werden. Und nur deshalb verweigern wir uns der Einladungen zum Pflaumenkuchenschmaus, setzen lieber den Überprüfungslauf in unserem Sicherheitsleben fort. Wir schauen uns jeden Passanten genau an, wo doch jeder einzelne, wir sagen jedermann, ein Schläfer, ein Terrorkunde sein kann. Wo man von keinem Menschen, oft genug nicht von sich selber, sicher sagen kann, in welches Lager das eigene Hirn bereits gewechselt ist, ohne es selber mitbekommen zu haben. Was ist, wenn wir schlafen? Wer tritt da an unser Bettchen, und knetet uns um für einen Gewaltakt, den wir begehen aber nicht begehen wollen, ferngesteuert?
Mein guter Kumpel Klaus, ja diese unbekannte Größe, dieser Verdacht an meiner Seite, kann doch aufblühen und ebenfalls ein lautloser Attentäter sein, nicht wahr. Will damit warnend sagen: Möglich ist alles. Und wie ich uns beide im Schaufensterglas sehe, kriege ich einen fürchterlichen Schrecken. Das sind nicht mehr wir, das sind Fahndungsbilder von uns beiden, die ich da sehe, die uns soeben entdeckt haben und stellen wollen. Und deswegen rennen wir panisch aufgescheucht vor uns selber weg. Und sitzen dann im hinteren Eck unserer Stammkneipe wie auf der Flucht. Der Wirt ist viel zu lange hinten. Er wird doch nicht telefonieren, uns anzeigen? Wir sind alle nahezu ideale Personen und gute Krieger der heiligen Sache, sagt er schließlich, als er zurückkommt zu uns. Unsere Tarnungen sind simpel, sagt er weiter, aber dadurch nahezu perfekt. Wir geben uns als völlig normale Durchschnittsbürger, und hops lassen wir die Bombe platzen, werden gesucht, kommen irgendwo unter, wechseln unsere Identität, werden zu dem, was wir immer schon waren, imaginäre Personen. Es beobachtet uns doch niemand, weil keiner das Schreckliche je von uns denkt, das wir anrichten werden, wenn man es uns befiehlt. Die Leute sehen uns nicht als Gefahr. Sie sehen durch uns hindurch, sage ich. Und Klaus behält voll die Nerven, steht auf, geht zu ihm hin, sagt unerschrocken zum Wirt: Man darf sich von niemanden mehr täuschen lassen, muss umsichtig sein, denn es ist nichts wie es scheint, ist genau umgekehrt. Nicht die Unauffälligen, sondern die Aufdringlichen sind die wahren Terroristen. Mein lieber Freund, du bist durchschaut, ein typischer Schläfer im Schafsfell. Und dann befällt mich die vollkommene plötzliche Paranoia. Ich schlage den Wirt zusammen, weiß nicht woher ich sie habe und warum ich sie ihm anlege, die Fussfessel. Reine Vorsichtsmaßnahme, sagt Klaus. Er könnte uns lange schon im Visier haben, ein V-Mann sein. Sieh ihn dir doch einmal ganz genau an, diesen seltsamen Typen. Macht man ja sonst nicht, einen wie ihn unter die Lupe nehmen. Der hat diesen Zug um seine Fresse, und das schon eine gewisse Weile, sieht aus, als würde der ein IS-Kämpfer sein. Im Grunde ist der gesichtslos wie ein Aufruf zum Terror. Der hat nicht nur uns, der hat alle hier in der Kneipe im Auftrag einer unbekannten Macht ausspioniert. Aber feste, sage ich zu Klaus. Es geschah alles hier aus Sicherheitsgründen. Und dann erst rufen wir die Einsatzkräfte. Die kommen binnen drei Minuten. Die Kneipe wird geschlossen. Den Wirt und seinen Arbeitscomputer fahren sie in drei Überlandbussen davon. Die Sicherheitskräfte tragen lustige Tarnkappen, nennen sich geschlossene Gesellschaft, schicken uns nach Hause, raten an, dort sieben, acht, elf Tage zu bleiben, nicht mehr hinaus zu gehen, wenn uns unser Leben lieb wäre. Und ob, sagen wir, und gehen dankend ab, wir bleiben.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend alle miteinander! Herzlich willkommen. Ich möchte nun einen Zaubertrick vorführen. Einen ganz besonderen Zaubertrick. Es ist der traurigste Zaubertrick der Welt! Am Ende des Tricks wird dieser Raum sich auflösen! Dieser Raum der tausend Möglichkeiten, in dem mindestens tausend Möglichkeiten existieren. Und am Ende wird dieser Raum verschwinden! Also passen Sie auf! Der Trick ist ganz neu, ich zeige ihn heute zum ersten Mal. Dafür brauche ich aber Ihre Hilfe! Bitte helfen Sie mir mit diesem Zaubertrick. Können Sie das tun? Okay! Es geht schon los. Stellen Sie sich vor, Sie sind meine Enkelin. Stellen Sie sich das vor. Stellen Sie sich vor, Sie sind alle meine einzige, wertvolle, allerliebste Enkelin! Und ich bin Ihr Opa. Sie sind alle meine Enkelin! Und ich ihr trauriger Opa! So! Ja? So! Ich habe so viele Erinnerungen an diesen Raum! Opa hat so viele Erinnerungen! Ich habe so viele Erinnerungen! So unglaublich viele Erinnerungen! Wichtige und unwichtige! So verdammt viele Erinnerungen! Zum Beispiel dieser Urknall. Mein Schatz, ich erinnere mich gut an diesen Urknall, diesen unglaublich traurigen Urknall, als wäre es gestern gewesen. Aber nicht so gut an meine Geburt. Viele von diesen Erinnerungsdingern tun sehr weh, viele nicht ganz so sehr. Ich komm mir so alt vor, wenn ich merke, wie viele Erinnerungen ich habe und wie viele schon weg sind. So verdammt alt komm ich mir vor! Wie son Urknall. Da zum Beispiel. Da stand ein Klavier. Erinnerst du dich? Da saß Remi. Und er spielte einen Song, einen sehr tristen Song, diesen Song hier und Philipp trug Luis, der Simba war, in den Armen und streckte ihn in die Höhe und Philipp sang dazu. Aaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaasked for Tristan und so weiter. Alle dachten, er singt jetzt, aaaaaa sevenja, aber das war eine Finte! Und stattdessen sang er diesen Song, der an Traurigkeit kaum zu überbieten war. Und dann pustete Martha ein Plantschbecken auf und weinte hemmungslos hinein, nach dem sie „ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros gesungen hatte, kannst du das mal anmachen kurz? Mach doch mal an! So und sie konnte aber nicht genug weinen, um zu sterben, weil sie weinte nicht vor Traurigkeit, sondern um das Becken zu füllen. Also holte sie den Wasserspender und tat so, als wären es ihre Tränen und ertränkte sich im Planschbecken. Und dann stand da das Klavier, schon früher einmal, und dort saß die junge Fanny Wehner. Die junge traurige Fanny Wehner. Erinnerst du dich daran? Daran erinnert sich doch keiner mehr! Der junge Remi war auch da und spielte die Geige und die junge Franzi spielte das Cello, alles nicht unmelancholisch und sie spielten eine Ouverture, diese Ouverture hier, und es war sehr traurig. Weißt du noch? Ach, du weißt es doch gar nicht mehr. Aber es sind sehr wichtige Erinnerungen für mich. Große, wichtige Erinnerungen. Und da, hier, hier ist Sarah auf einer Bananenschale ausgerutscht und dann ist Rose in einem Bananenkostüm auf Sarah ausgerutscht. Das war unglaublich witzig! Aber auch unglaublich traurig. Die Leute haben gelacht, aber auch geweint. Und hier, da war Franzi und hier war Jette und da war Widu, der Widu aus der Schweiz, aus dem betrübten Kanton Basel Stadt, und wusste nicht, wo oben und unten ist, seine Verlobte waren auf einmal zwei Personen! Und Franzi und Jette, seine eine Verlobte, malten das Raum-Zeit-Kontinuum an die Wände und Widu wurde immer verwirrter und trauriger. Weiß das überhaupt noch jemand? Und dann hat Remi hier seinen ersten Monolog gehabt. Er hatte damals einen viel stärkeren Akzent als heute und studierte noch Medizin oder so, aber er war so unglücklich damit. Er sprach für die rauchende Komode Aspelund und – ach, ich habe ganz vergessen, ich rauche ja auch! Die ganze Zeit rauche ich hier schon, man sind die lecker! Gib mir mehr! Noch eine! Los, eine noch! Jetzt sei doch nicht so geizig und gib mir schon die Schachtel! – und ja, Aspelund sagte, wie schlimm alles sei, wie Fatzer das Wort Scheiße aufgebraucht hat und hat dabei ihre unterste Schublade geöffnet und uns gezeigt, dass da nichts mehr drin war, da unten in der untersten Schublade, weil Fatzer alles Schlimme schon begangen hat. Es sind so wichtige Erinnerungen für mich. Aber es erinnert sich ja niemand dran! Ich sage immer, hier und hier, aber war das überhaupt hier? Mach doch mal einen Tocotronic-Song an. Mach doch mal den Song an! Los, mach den mal an, so einen traurigen von früher und wir rauchen ein paar Zigaretten. So. Rauch doch mal ne Zigarette. Mhh. So. Mhh! Der ist so schön traurig! Weißt du, mein Liebling, früher, da haben wir immer Tocotronic gehört, um traurig zu sein. Das war mal son Ding, das war mal cool. Tocotronic hören und traurig sein. Los, lehn dich hier mal an an meiner Schulter und wein doch mal ein bisschen. Na los doch! Mehr! Mehr! Jetzt heul doch mal! So richtig! Ich brauch jetzt mal ein Taschentuch. Mach mir mal die Tränen hier weg! Es sind so verdammt viele. Hier haben wir geprobt und unten haben wir getrunken. Hier oben haben wir geprobt! Wir haben viel gelacht, aber vor allem auch viel geweint! Geweint! Wie richtige Männer und Frauen! Wie kleine Pandabären haben wir geheult und verdammt, es war schön! Jeden Tag! Und unten, in dieser bedrückend schönen und oft sehr aufdasgemütschlagenden Kantine, da haben wir getrunken, so richtig getrunken, verstehst du, mein Schatz? Auch jeden Tag! Einmal, da saßen wir noch da, Nora, Rose und ich, und wir waren so traurig und wir haben dazu getrunken und wir haben versucht das Endorphinsilo mit Alkohol zu füllen, das ging auch ganz gut und dann sind wir mit Roses Auto, Rose hatte ein Auto - es war zwar nicht besonders groß, aber dafür verdammt trist! – zu mir gefahren und haben Heiner mitgenommen. Heiner war überhaupt nicht traurig, aber den haben wir schön reingezogen in unsere schöne Melancholie und die große Liebe, die wir für uns alle empfanden. Und wir haben noch mehr getrunken, verantwortungslos getrunken, auf der Straße und am Steuer. Und wir sind gefahren auf der Straße, die schluchzte, und wir haben gesagt, wir fahren jetzt hier so lange auf dieser Straße bis sie zu Ende ist. Und am Ende der Straße war der Flughafen Schönefeld. Und wir fragten die Frau im Ticketschalter, welcher Flug der nächste ist und sie sagte etwas bedrückt „Kopenhagen“, und wir so „dann 4 mal Kopenhagen bitte“ voller Überschwang und Hoffnung auf Glück, und dass wir vielleicht dänische Designermöbel zerstören würden, und schoben sehr viel Bargeld über den Tresen. Und dann waren wir morgens um 8 in Kopenhagen und wir haben uns die Stadt angeschaut und uns oft umarmt und nachts sind wir mit einem Bus und einer Fähre zurück nach Berlin. Wir waren jung und brauchten das Geld nicht. Aber jetzt, sieh doch mal wie alt Opa ist. Kannst du noch einen Tocotronic-Song anmachen? Und reich mir doch nochmal die Zigaretten bitte. Und nimm dir jetzt doch auch mal eine! Wie, du rauchst nicht! Wieso denn nicht zur Hölle! Jetzt fang endlich an zu rauchen! Hör auf Opa, und rauch! Aber nicht zu wenig! Rauchen! Los! Alle! Jetzt riskier mal was! So ist brav. Opa schickt dir jetzt zum Geburtstag jedes Jahr ne Stange Marlboro. Ach ja, dieser Raum. So viele Erinnerungen. So viele schöne und traurige Erinnerungen. Ich könnte noch sehr sehr lange über Erinnerungen sprechen. Aber es erinnert sich ja niemand dran. Zum Beispiel, wie ich da unten im großen Saal saß und viele Stunden Theater geschaut habe und es war einfach mega nice. Boah, Opa geht oft ins Theater und es ist so selten mega nice. Das ist wirklich schade. Wirklich schade ist das! Woran liegt das denn nur! Weißt du, Opa war nie im Krieg, Opa war immer nur im Theater. Wäre ich doch nur mal im Krieg gewesen. Mein Opa hat immer gesagt, als Opa damals im Krieg war und die und die Sachen passiert sind, da saßen wir mit offenen Mündern und in unseren Gehirnen und Fantasien haben wir Schüsse gehört und Schreie und andere Aufregungen. Aber ich steh hier und sage, als Opa damals im Theater war, und keine Sau interessierts. Ich sehs doch. So langweilig ist das. Das ist ja so schade. Warum stehen denn alle Leute vor einem Technoclub und nicht vor einem Theater? Wieso sind denn so viele Leute bereit, für ein Wochenende in diese Stadt zu jetten, um irgendwo in einem eisigen Wind vor einer alten Fabrik oder Brauerei zu stehen und dann womöglich gar nicht reinzukommen! Warum stehen die denn da und nicht vor dem Theater und wollen da rein? Was ist denn das? Warum ist denn Theater so öde? Wer war denn das? Und jetzt? Was wird hier nur werden. Es ist alles so schlimm. So schlimm! Was wird hier nur werden in diesem Raum? Wird der ein W-Lan-Router? Wird das hier mal Style? Was soll denn das sein? Was soll das denn heißen? Was soll hier nur mal werden? Wird das hier mal das Büro für coolen Kram und Trends? Wird das hier eine kuratierte Espressobar? Wird hier einfach alles mega nice aussehen? Wird sich jemand viele Gedanken darum machen, wie Hammer das hier mal aussehen wird und mega wenig Gedanken, warum es so Hammer aussehen soll, außer dass es halt Hammer aussieht dann? Wird man davon Bilder ins Internet stellen und die Leute werden sagen, man, das sieht ja voll Hammer aus? (ruft aus dem Fenster) Ihr habt so schlechte Ideen, Leute, so so schlechte Ideen! In euren Köpfen sind nur schlechte Ideen! Es ist widerlich! Extrem ekelhaft und sehr widerlich! Ich bin extrem ratlos! Ganz ganz dolle ratlos. Und jetzt. Jetzt schließ deine Augen. Schließt alle eure Augen und vielleicht rollt dabei aus Versehen eine Träne aus der Iris, durch das Maskaragitter hindurch, die dann schwarz über deine Wange rollt, schwarz wie die Seele der Performancekunst, und wenn du die Augen gleich wieder öffnest, dann ist es 2017 und der Raum ist verschwunden. Und weg ist der Raum! Da ist er weg! Das was hier mal war, gibt es nicht mehr. Hier ist nur noch ein Lager für verbrauchte Trends. Und das wars, dieser Raum ist verschwunden. Und jetzt schließe die Augen nochmal. Schließe sie! Und wenn du sie gleich öffnest, dann sind alle Ideen verschwunden und es gibt nur noch Style. Und wenn du sie jetzt nochmal schließt und wieder öffnest, dann gibt es auch keine Utopien mehr, sondern nur noch Risikoarmut. Die dritte Welt des Risikos, da liegt sie vor dir, diese glatteste Taigawüste aller Zeiten. Und ab jetzt, jedes Mal, wenn du blinzelst, wird etwas Wichtiges verschwinden und etwas Unwichtiges auftauchen. Jedes Mal, wenn du blinzelst, ab jetzt, wird eine schlechte Idee auftauchen und eine gute ersetzen! Diese 24 Stunden, da war mal viel Neugier und Interesse drin, aber irgendwie ist das nicht mehr so, irgendwie werden die mit jedem blinzeln beschissener! Ja, so läuft das! Und dein einziger Trost ist das Internet. Nur das Internet! Und dort sind nur noch Bilder von schlechten, Hammer aussehenden Ideen! Und unglaublich lustige Videos, Milliarden lustiger Videos und Milliarden trauriger Videos und Milliarden schockierender Videos bis dein Humor und alle anderen Gefühle völlig zermalmt sind. Das war der traurigste Zaubertrick aller Zeiten. Mein Schatz, rauchen wir noch ein paar Zigaretten und holen uns ein-, zweihundert Liter Augentropfen. Es gibt kein Argument für schlechte Ideen und Risikoarmut und langweilige und schlechte Entscheidungen. Lass dir das niemals einbläuen! Lass dir das von niemandem jemals erzählen! Kein einziges Argument dafür gibt es, kein einziges! Du musst mir versprechen, mein Liebes, dass du das Theater retten wirst! Du musst Opa versprechen, dass du das Theater retten wirst! Ach was, die ganze Welt! Dass du mal was riskierst! Dass du riskierst riskierst riskierst! Setz mal deine Karriere aufs Spiel! Oft! Häufig! Und Sympathien! Einstimmigkeit! Deine innere Ruhe! Deine Sicherheit! Das musst du mal alles rein schmeißen! Auf deinem Weg liegen viele Steine, viele verbitterte Egosteine, viele Steine des Misstrauens, viele Steine der Mittelmäßigkeit und der Aufgabe. Aber du musst Opa versprechen, dass du Magierin wirst und diese Welt verzauberst. Und fühl dich mal mehr angesprochen! Finde das mal nicht niedlich! Nimm das mal ernst! Bitte, mein Liebes! Ich zähle jetzt bis drei und dann bist du eine pubertierende Jugendliche zum Beispiel, eine pubertierende Jugendliche voller Gedanken und Kommunismus und Zuneigung und Weltschmerz und Neugier und Empfindungen und Unzerstörbarkeit und ungestüm und ohne Zögerlichkeit und Strategien und Funktionstüchtigkeit und ohne jede Ahnung von Strukturen und ihren Ruinen, ohne Charme und Cleverness und dann rettest du unsere Welt.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
Bonn Park wurde als Sohn zweier Koreaner 1987 in West-Berlin geboren und nach einer Stadt benannt. Kurz danach wurde er Autor und Regisseur und seit 2008 Mitglied von P14. Seine Arbeiten waren an diversen Theatern in verschiedenen Ländern zu sehen und wurden manchmal ausgezeichnet.
--
Sie wird wie immer alles geben, um uns zu verunsichern, aber wir müssen ihr zeigen, wer hier wohnt, wer hier zu Hause ist.
Seit der Unterzeichnung des Mietvertrags von 1996 sind wir die unbefristeten Mieter. Eigentlich wohnen wir hier schon seit fünfundzwanzig Jahren. In unserer Familie gibt es einen Spruch: Gehe überall hin, aber kehre zu dem gelben Frühstückstisch zurück. Höchstwahrscheinlich gibt es gelbe Tische in anderen Wohnzimmern auch, aber es ist anders, wenn das dein Frühstückstisch ist, auf dem du seit so vielen Jahren dein Ei gegessen hast, so wie du dein Ei magst, und du magst es so, weil du es inzwischen nur so kennst. Und auch wenn die Fenster ziemlich undicht sind und im Winter immer wieder anlaufen und alles nass wird und der Wind durch die Räume fetzt, als wären wir im Garten, weshalb unsere jüngere Tochter von September bis Mai kränkelt, möchten wir nie irgendwo anders leben.
In letzter Zeit bekommen wir viel Besuch. Allen gefällt es hier. Wir sind stolz und zugleich gastfreundlich und kochen auf eine bestimmte Art und Weise, die den meisten wirklich gut schmeckt. Wenn sie nach einem Rezept fragen, sage ich, dass es nicht nur an Zutaten liegt, sondern an unserem Geschirr und unserer Innenausstattung und der Musik, die wir hören. Ich sage, das was ihr hier zu essen bekommt, kann man in keiner anderen Wohnung nachmachen. Ihr müsst einfach wiederkommen.
Nur sie findet nichts Besonderes daran. Sie bringt ihre selbstgemachten Aufläufe und Kuchen und wirft vorwurfsvolle Blicke in die staubigen Ecken. Sie sitzt am gelben Tisch mit einer Haube auf dem Kopf, weil ihr der Wind zu stark ist, als hätte sie nicht ihre ganze Kindheit hier bei uns verbracht. Sie vermisst unser Essen nicht. Sie vermisst unseren wohnungsspezifischen Humor nicht. Sie will nicht, dass wir über unsere Nachbarn schlecht reden, dafür ist sie zu fein. Letztes Mal habe ich ihr den neuen Ofen gezeigt, den wir so teuer gekauft haben, den großen Kachelofen, der das Wohnzimmer wärmt, aber sie lachte nur und sagte, ihr könnt die ganze Wohnung verbrennen vor lauter Heizen - wenn ihr die Fenster nicht isoliert, ist alles umsonst. Sie sagte, so seid ihr immer gewesen, bei euch ist einiges falsch.
Deshalb werde ich sie heute Abend, wenn sie wieder kommt, an der Tür abfangen. Ich werde sagen, lass deine Aufläufe vor der Tür und nimm deine Verachtung an die Leine. Zieh deine Kappe und deine komischen Schuhe aus. Du weißt genau, wie ungern wir unseren Boden putzen. Und du bist unglücklich, das weiß ich, werde ich sagen, man sieht es dir an. Du hasst es, wenn dich Menschen fragen, aus welcher Wohnung du kommst und wie man in deiner Wohnung isst, redet und heizt, weil du dann zugeben musst, dass du zu uns gehörst. Sie fragen dich, ob du nicht einen Schock bekommen hast, als du in ein Haus umgezogen bist, in dem es statt eines gelben nur einen roten Tisch gibt. Das muss furchtbar gewesen sein, sagen alle zu dir, plötzlich im Windschutz, von ganz anderen Bakterien umgeben. Und ich finde auch, dass das furchtbar gewesen sein muss. Deine Verachtung uns gegenüber ist Selbstverachtung, du solltest deine Wohnung lieben und vermissen, egal wie sie ist. Du musst deiner Wohnung verzeihen! Nur dann kannst du dir selbst verzeihen. Das werde ich heute Abend zu ihr sagen, und wenn ich mit dem Reden fertig bin, wird sie weinen. Sie wird gebrochen sein.
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
Barbi Marković, geboren 1980 in Belgrad, lebt in Wien. Zuletzt SUPERHELDINNEN, Residenz Verlag
--
Ich verrinne, ich verrinne
wie Sand, der durch die Finger rinnt
Ich hab auf einmal so viel Sinne,
die alle anders durstig sind
Rainer Maria Rilke
Jede Erscheinung beweist ihre Notwendigkeit durch ihr Dasein. So haben wir das gelernt, so wurde es überliefert. Von den Vätern, die vor den Söhnen sterben. Aber das hier, diese Realsatire die sie „Halluzination“ nennen, die ist doch nicht mehr zumutbar. „Warum spielen die hier die ganze Zeit bayrische Blasmusik?“ Ich lausche, kann jedoch nichts hören, außer dem mechanischen Ticken der Morphium-Pumpe. Hier wird Raum zu Zeit und der Raum ist endlos und steril. Die Familie im Nebenzimmer wird gebeten, nach Hause zu gehen, man könne doch nicht und so weiter. Das fremde Essen riecht auch etwas streng. Wir sind hier nicht im Orient. Deutschland, du Opfer!
Der Gang ist leer und kalt und voller Linoleum. Oben, unten, seitwärts. Überall Linoleum. Dazu ein lebloser Limonenduft, bekannt aus Raststätten, Funk und Fernsehen. Das Haus ist kalt und nichtssagend, offenbar war das hier schon immer so. Kein Wunder, hier hält man sich auf, wenn man sterben muss, aber nicht darf. Die Angestellten schauen grimmig wenn man auf den Tod zu sprechen kommt. „Nicht sterben dürfen, das ist doch ein Treppenwitz der Geschichte“, sagt ein befreundeter Autor am Telefon. Ich höre wie er sich den Satz zeitgleich notiert. Ätsch, Erster! Ich frage den Sterbenden, ob er denn einen Wunsch hat. „Sterben“ sagt er. „Besser heute als Morgen.“ Da hat er sich den falschen Ort ausgesucht, im Krankenhaus wird gefälligst nicht gestorben. Wo kommen wir denn da hin. Am besten verbieten wir das Sterben gleich ganz.
Sterben ist nicht mehr en Vogue, man hat jetzt andere Hobbys. Leben heißt Profitmaximierung. Klingt abgedroschen, ist so. Nicht mal die Autoren dürfen oder können sich noch totsaufen, selbst hierzu fehlt ihnen die Konsequenz, der Mut, die Intoleranz dem Leben gegenüber. Wie bei allem anderen. Auf dem Bildschirm flimmert eine Dokumentation über einen alkoholkranken Schriftsteller, der sich zu Tode trank und ich werde wehmütig, schaue in die gesellige Runde. Feiglinge sind wir, wie wir hier unsere zwölf Bier über den Abend verteilt trinken und uns dabei verwegen vorkommen. Der Alkohol dient hier und heute nur noch der Kontaktaufnahme, nicht mehr der Abschottung oder der Selbstzerstörung. Passt aber auch, Vernetzung wird schließlich großgeschrieben. Die Kunst wurde übernetzwerkt, die Einsamkeit, das Leiden, abgeschafft. „Wanna come over and destroy each other emotionally? Its for my art!“ Bleibt einem ja sonst nichts übrig. Brutalität hat wenigstens kein Verfallsdatum.
Am nächsten Morgen sitze ich erneut im Kankenhaus, schleppe einen halbgaren Kater mit mir herum. Inkonsequent wie immer. „Frechheit! Es gibt jetzt einen Krisenherd-Marathon. Der Sieger bekommt 10% seiner Bankschulden getilgt“ sagt er. Ich nicke. Das Morphium halt. „Was machen wir jetzt?“ Was soll man darauf schon antworten. Darauf weiß man doch nie eine Antwort. „Warten“ sage ich. Da lacht er. „Das ist doch lächerlich. Ihr habt einfach nichts drauf. Es ist Samstagabend und wir sitzen hier herum anstatt tanzen zu gehen. Diese Arschkapitalistenschweine, die haben mehr drauf als ihr. Was ist da nur passiert? “ Das wollten DIE STERNE etwas abgeändert schon 1996 wissen, aber es gab und gibt keinen Grund diese schrammligen Gitarrenriffs zu ertragen und sich die Haare nicht zu waschen und all dieser Scheiß. Die Hamburger Schule in den Kinderschuhen, ich, der Leisetreter, erneut auf dem endlosen Gang. Zigarette vor der Tür, ein Leichenwagen fährt vor. „Kinderwagen des Todes“ sage ich und ernte pikierte Blicke.
In der Kneipe hat man ebenfalls wenig Verständnis für meine Respektlosigkeit. „Woran arbeitest du gerade?“ „An meinem Verfall!“ Die anderen hier machen auch irgendwas mit Kunst, aber es ist die Zeit der Versachlichung. Shakespeare schön und gut, aber jetzt muss es doch endlich mal um uns gehen. Es geht doch schon so wenig um uns. Vor allem um mich. Und ein wenig auch um dich, aber nur wenn es mit mir zu tun hat. „Lass mal noch ein bisschen ballern, damit wir nicht ganz so betrunken sind“. Schnief. Traurig sowas. Noch eine Runde, gegenseitiges Abklopfen, der gezähmte Exzess als Anbiederungsform. Nach Rudi Carrells Tod wurde einer seiner Wegbegleiter gefragt, wie der Rudi mit seinen Freunden umging. „Rudi hatte keine Freunde. Er hatte Beisitzende, an denen er seine Gags testete.“ Lifegoals.
Am nächsten Tag ist der Kater noch ein bisschen harmloser. Training. Wir stehen im Saft, keine körperlichen Gebrechen, nicht mal ein ordentliches Zipperlein. Das kommt davon, wenn man sich täglich so elitär und weltfremd betrinkt, da schafft man es nicht mal unter die Räder zu kommen. Eingebildet und größenwahnsinnig wie Caligula, mit goldenem Hafer gemästet wie sein Rennpferd. Wozu also sterben? Zu Zeiten Jörg Fausers, da war der alkoholbedingte Tod noch immanent. Einfach mal besoffen auf die Autobahn laufen, macht doch heutzutage kaum noch jemand. Wäre aber mal wieder an der Zeit. Scheiß Theorie, ohne Praxis kein Ergebnis.
Der Gang mal wieder. Ich verstehe kein Wort. Das Buch ist auf Türkisch. Es lag hier einfach herum, im totalen Nichts, zwischen der Neonbeleuchtung und dem monströsen Arsch der keifenden Krankenschwester. Aus irgendeinem Grund blättre ich dennoch darin herum. Unverständliche Hieroglyphen, der Turmbau zu Babel. Auf der letzten Seite ist die Nummer von Moritz Rinke vermerkt, handschriftlich. Ob es wohl viele Leute gibt die Moritz Rinke heißen? Nur zur Sicherheit speichere ich die Nummer und öffne einen Online-Messenger. Da ist er. Der Moritz. Sein schwarz-weisses Profilbild grinst mich an, er ist Online. Überlege kurz ob ich ihm schreiben soll, vielleicht kann er mir sagen, wie er das handhabt, diese Inkonsequenz und all diese Netzwerke und die Versachlichung und so weiter. „Hallo Herr Rinke, wir kennen uns nicht, aber...“ Dann fällt mir ein dass er Fußball spielt. Im Club oder in der Autoren-Nationalmannschaft oder so. Zum Sterben ist er wohl der falsche.
Auf dem Zimmer darf immer noch nicht krepiert werden. Cortison, Novamin, Oxygesic, Tavor, Haldol, Morphium, Dipidolor, Vergentan. „Es gibt ein Geheimnis. In meinem Kopf ist eine magnetische Sonde. Und um die geht es hier die ganze Zeit. Diese Sonde kann sämtliche Transaktionen auf der Welt verändern. Das wäre ein gigantischer Finanzcrash. Deswegen der ganze Aufwand hier.“ Ich nicke wieder und verspreche gleich wiederzukommen. Einmal durchatmen. Auf dem Flur kommt mir ein Mann entgegen, Schläuche hängen aus seinem Hals, darüber ein monströses Doppelkinn. Natascha Kampusch würde dort Platz finden, so groß ist es. Er stoppt, eine Krankenschwester hält ihm ein Gerät vor die Stirn, ein blauer Lichtstrahl schießt hinaus, es piept, der Mann geht stoisch weiter. Die Krankenschwester notiert das Ergebnis ihrer extraterrestrischen Messung. Was ist, wenn mein Vater recht hat? Wenn es hier wirklich um die Magnetsonde geht? 12 Monkeys und so, ihr wisst schon.
Die Kunst zu sterben. Sterben gelassen zu werden. Lasse Sterben, ein berühmter norwegischer Ahnenforscher. Haha. „Ja, das sind gute Ansätze“ sagt der Arbeitskreis der Vernetzten. Ich bin mir da nicht so sicher, ich nehme Humor sehr ernst. Die Zeit verwundet alles Heile, sagte John Lennon. In fließendem Deutsch. Auch das können sie verstehen, wie sie hier so sitzen. Sie raten mir darüber zu sprechen. Vielleicht nicht mit Ihnen. Aber mit jemand anderem. Reden hilft, sagen sie. Tut es nicht. „Vorname Hass, Nachname Gewalt steht in meinem Dokument im Pass von German.“ rappt HAFTBEFEHL, als ich mir die Kopfhörer aufsetze und das ist wahrer als alles was ihr in eurem Weißweinzirkel heute zustande bringen werdet. Ich möchte in das Zimmer gehen, in dem der Limonenduft wabert und der Sterbende sich dauernd erbricht, das Bett raus schieben, am besten einen Abhang hinab und hinterher rennen. Dann, im Tal angekommen, endet alles in einer gewaltigen Explosion. Und an dem Feuer zünden die Überlebenden ihre Molotovcocktails an und die, die langsamer sterben wollen ihre Zigaretten. So wäre doch allen geholfen. Prost!
Juri Sternburg, geboren 1983, Autor und Dramatiker aus Berlin-Kreuzberg. Zuletzt "Das Nirvana Baby" im Korbinian Verlag.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Zur Kritik der Komplexität
Politische Konflikte werden heute vielfach als “komplex” wahrgenommen. Flüchtlinge benehmen sich nicht wie brave Opfer, das Proletariat wählt diejenigen, die es immer schon ausgebeutet und unterdrückt haben, die Banker rufen nach mehr Regulation der Märkte und die CSU kämpft für die Rechte der Frauen. Komplex kann in diesem Zusammenhang nichts anderes heißen, als dass verschiedene Herrschaftsverhältnisse und damit konkrete Interessen einander überkreuzen. Für die einzelnen sozialen Akteure erscheinen dann die Verhältnisse als “unübersichtlich” und tendenziell widersprüchlich, was ihren Anspruch auf Selbstbestimmtheit und Handlungsmacht empfindlich einschränkt und sie nach einfachen Lösungen suchen lässt. Das war wohl nie anders, und doch schien es innerhalb der Linken ein Narrativ zu geben - den Hauptwiderspruch von Kapital und Arbeit - das diese Komplexität zu reduzieren, den Schein der Komplexität zu zerreißen und dahinter den wahren Antagonismus zu erkennen versprach. Und selbst als der Hauptwiderspruch ins Wanken geriet und die vormaligen “Nebenwidersprüche” von Geschlecht, Sexualität, “Rasse”, Ethnizität oder Alter in den Vordergrund drängten, schien die Konfliktlogik selbst davon unberührt, und die Lösungsgewissheit musste nur vom Haupt- auf die Nebenwidersprüche ausgedehnt werden. Heute hingegen scheint die Fokussierung auf ein Herrschaftsverhältnis die anderen leicht verschwinden zu lassen, wie etwa Didier Eribon in seiner Rückkehr nach Reims selbstkritisch vermerkt. Gerade die Lösungsgewissheit in einem Bereich lässt die anderen als vernachlässigbar erscheinen, und die Konfliktlinien verschieben sich zunehmend zwischen die unterschiedlichen Artikulationsformen der Widersprüche und die Behauptungen ihrer jeweiligen Priorität. Die Frage, wie ihr Zusammenhang gedacht werden kann, scheint also ebenso zunehmend an Bedeutung zu gewinnen wie das Verständnis und die Bewertung der Komplexität selbst. Ist ein komplexes Bild der Welt gut, weil es den unterschiedlichen Herrschaftsverhältnissen Raum gibt, weil es deren tendenzielle Widersprüchlichkeit erkennen lässt und weil es schließlich die Aussagepositionen mit umschließt – denn Komplexität lässt sich nur als relativer, auf den konkreten Aussageakt bezogener Begriff denken? Oder ist es schlecht, weil es jedes Lösungsangebot in weite Ferne rückt und konkrete Politik, das heißt das Versprechen auf ein besseres Leben, den rechten Populisten überlässt. Dementsprechend wird der „nebenwidersprüchlichen“, minoritären Linken seit geraumer Zeit der Vorwurf gemacht, im Namen politischer Korrektheit größtenteils nur mehr Verzicht zu predigen und kein phantasmatisches Genießen für alle mehr offerieren zu können.
Warum aber scheint es überhaupt so schwierig zu sein, die unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse nebeneinander und gleichzeitig zu adressieren, wie es die Mikropolitiken in den 1970er Jahren und die radikaldemokratischen Ansätze seit den 1980er Jahren versucht hatten? Warum sollte es für „uns“ als gute Linke überhaupt ein Problem darstellen, intersektionell zu denken und somit feministisch, anti-kapitalistisch und antirassistisch zu sein? Die Antwort kann nur lauten, dass „wir“ immer schon in sozialen Verhältnissen leben und damit in unseren Aussagepositionen innerhalb der verschiedenen Herrschaftsverhältnisse unterschiedlich positioniert sind. Und diese grundlegende soziale Positioniertheit bedeutet nichts anderes als dass weder eine gemeinsame Basis reiner Unterdrückung in allen Herrschaftsverhältnissen als Ausgangspunkt des politischen Denkens und Handelns angenommen werden kann noch ein universell umfassender Zielhorizont. Vielmehr sind die unterschiedlichen Meinungen und Interessen konstitutiv für jede politische Artikulation. Erst aus ihnen heraus können sowohl die strukturelle Benachteiligung bestimmter sozialer Gruppen als auch jede mögliche Universalisierung gedacht werden. Hierfür ist jeweils ein spekulatives oder phantasmatisches Moment von Nöten, dass die je eigene soziale Positionierung zwischen Privileg und Benachteiligung transzendiert, etwa ein emphatisches „Wir“, das stets auch diejenigen einschließen soll, die sozial oder politisch anders positioniert sind als diejenigen, die dieses Wir einfordern.
Doch ein „Wir“ lässt sich sinnvoll nur behaupten, wenn es sich von einem „Ihr“ oder „denen dort“ abgrenzt. Dementsprechend ist die Unterscheidung zwischen „uns“ und den anderen, zwischen „Wir“ und „Ihr“ heute heiß umstritten. Postkoloniale Theorien haben an dieser Unterscheidung ein entscheidendes Moment der Selbstverkennung festgemacht. In diesen Rhetoriken verschwinde die grundlegende Bezogenheit sozialer Gruppen aufeinander, ihre historischen Interaktionsformen ebenso wie die darauf aufbauenden, aktuellen Machtkonstellationen, und deshalb könnten kontingente historische Abgrenzungsakte als Ausdruck essentieller Wesenheiten erscheinen. Erst vor dem Hintergrund einer solch grundlegenden Selbstverkennung lasse sich eine kulturelle und intellektuelle Hegemonie Europas behaupten, die eben genau darin bestehe, ihre eigenen Abhängigkeiten zum Verschwinden zu bringen. Demgegenüber betont die postmarxistische, links-Schmittianische politische Theorie gerade die Notwendigkeit solcher Unterscheidungen; sie warnt vor den „Illusionen des Kosmopolitismus“ (Chantal Mouffe) und sieht die Artikulationsformen des Politischen unmittelbar an Akte der Ent- und der Unterscheidung gebunden. Die Frage wird daher einerseits sein, inwieweit die postkoloniale Vorstellung grundlegender entanglements überhaupt politikfähig sein kann, und andererseits wie sehr die politischen Unterscheidungen des Links-Schmittianismus ihre eigenen Abgrenzungsakte reflektieren bzw. verhindern kann, dass sich diese Abgrenzungsakte essentialisieren und universalisieren.
Will man diese doppelte Frage ernst nehmen, müssen politische Slogans von „Yes, we can“, „Wir schaffen das“ bis hin zu „We must try!“ genauer untersucht werden. Die Ähnlichkeit dieser Appelle ist tatsächlich frappant, wenn auch bei Obama und Merkel ein nationalstaatlicher, bei Negri ein universell-kosmopolitischer Horizont impliziert ist. Alle drei negieren jedoch die Abgrenzungsakte des „Wir“ und implizieren, dass diejenigen, die von diesem Wir erst einmal ausgeschlossen sind – und gegen die es sich richtet -, früher oder später in dieses integriert werden können. Das reformistische wie das revolutionäre Pathos des „Wir“ unterschlägt die sozialen und die politischen Differenzen im Namen eines impliziten, geschichtsphilosophischen Narrativs, das konstitutiv in eine unabsehbare Zukunft verweist. An dieser Form der Vereinfachung von Politik haftet stets ein Moment des Unpolitischen, das den Eigensinn der jeweils anderen, seien diese nun sozial anders positioniert, nationalstaatlich und kulturell andersartig markiert oder als politische Gegner ausgewiesen, negiert; und diese implizite Negation bringt auch das Wir zum Schillern, weil klar wird, dass es konstitutiv unklar bleiben muss, wer damit eigentlich gemeint sei. Von hier aus wird vielleicht auch verstehbar, warum die Erfolge der Rechten so schlecht verstanden und bekämpft werden können, eben weil diese mit ihrem radikal vereinfachten, dumpfen „Wir“ kein Ambivalenz-Problem mehr haben. Sie haben nur mehr den universellen Bürgerkrieg als Phantasma einer finalen Reinigung.
Das in aktivistischen Rhetoriken immer wieder geforderte „gemeinsame Wir“ scheint also tatsächlich nicht nur strukturell unmöglich sondern sogar abgründig hinsichtlich seiner eigenen Abgrenzungsakte zu sein. Je umfassender und eindeutiger es zu werden verspricht, desto problematischer scheint es sogar zu werden. Aus diesem Grund wäre die grundlegende Ambivalenz politischer Subjektivitätsbehauptungen - und nichts anderes stellt das emphatische Wir dar – zu verteidigen. Deren Komplexität wäre dann auch keineswegs nur mehr als ein „Name für Resignation“ (Ariane Leendertz) zu verstehen, wie es in den Sozialwissenschaften heute – vor dem Hintergrund hoher Erwartungen an ein aktives social engineering in den 1960er und 70er Jahren – der Fall ist. Denn zweifellos ist am Begriff der Komplexität auch etwas zu gewinnen: die Unterscheidung etwa von sozialer Positionierung und politischer Aussage, und damit die Anerkennung einer grundlegenden Differenz, die nicht aufgelöst werden kann. Keine soziale Positionierung stellt per se bereits eine politische Positionierung da, und kein politischer Anspruch wird je die soziale Positionierung seiner jeweiligen Aussagesituation transzendieren können. Jedes Wir muss stets von einem konkreten, sozial positionierten, kulturell markierten und sich politisch artikulierendem Ich ausgedrückt werden. Diese Differenzen der Aussagebedingungen zu reflektieren unterminiert Politik nicht, sondern erhellt ihre Voraussetzungen. Auch andere Unterscheidungen, etwa zwischen Bürokratie und Populismus sind denkbar, die den Spielraum des Politischen definieren und deshalb weder in die eine noch in die andere Richtung dämonisiert werden müssen.
Die Kritik der Komplexität erfordert daher auch eine Komplexität der Kritik, die sich nicht mehr als reines Mittel im Dienste vorgegebener Selbstverständlichkeiten verstehen lässt. Die Zwecke der Kritik müssen selbst als normative Motivations- und als Zielhorizonte ebenso wie als taktisch-strategische Einsätze reflektiert werden können. Gerade aus der antinormativen kulturellen Kritik ist auch politisch zu lernen, dass die eigene Normativität immer erst behauptet und hervorgebracht werden muss, dass sie aber gleichzeitig nicht absolut gesetzt werden darf. Denn sonst kollabiert jeder kritische Anspruch. Kritik selbst lässt sich ja keineswegs als ein Wahrheitsereignis verstehen, sondern nur als ein historischer und kulturell äußerst spezifischer Aussagemodus, der uns, also diejenigen, die ihn zu beanspruchen suchen, immer auch schon positioniert, und zwar nicht notwendigerweise auf der richtigen oder guten Seite. Kritik scheint mir nämlich ein durch und durch liberaler Sprechakt zu sein, für den die kompetitive Abgrenzung von anderen konstitutiv ist. Sie stellt eine jener liberalen Institutionen dar, die nach Obama unbedingt verteidigt werden müssen, am besten vielleicht, in dem man sie selbst kritisiert. Denn es ist die besondere Artikulationsform der Kritik, durch die sich ein Spielraum öffnet zwischen einer kulturalistisch verstandenen Vielheit auf der einen Seite und einer rein politischen Entscheidungslogik auf der anderen. Erst innerhalb dieses Spielraums ist es möglich, jemanden für bestimmtes (sexistisches, rassistisches, klassistisches) Verhalten zu kritisieren ohne ihm gleichzeitig eine identitäre Zuschreibung aufzuerlegen. Es geht also darum, Abgrenzungen vorzunehmen - und somit ein politisches „Wir“ zu implizieren - ohne die Abgegrenzten zu essentialisieren und die eigene Sprechposition dabei zu universalisieren. Dieses „Wir“ muss der politischen Artikulation vorbehalten bleiben, und darf nur bedingt gleichzeitig auch einen sozialen Zusammenhang anzeigen. Entscheidend ist sogar, wie mit denen, die nicht als diesem Zusammenhang zugehörig aufgefasst werden, umgegangen wird und wie mit deren Kritik gerechnet werden kann. Soziales und Politisches bleiben in dieser Sichtweise aufeinander bezogenen, ohne sich ineinander auflösen oder sich radikal voneinander trennen zu können. Auf vergleichbare Weise lassen sich von hier aus vielleicht auch Verzicht und Spaß in ihrem intrinsischen Zusammenhang erkennen. Denn zweifellos gibt es keinen reinen Spaß ohne Verzicht und keinen Verzicht ohne ein gewisses Maß an Genuss. Politik ist ohne Komponenten aus beiden nicht zu haben. Viel wäre daher gewonnen, diese grundsätzliche Bezogenheit der Kategorien aufeinander als Ausgangspunkt der jeweiligen Positionierung zu nehmen und somit den eigenen Spaß in Relation zu einem möglichen Genießen der anderen zu setzen.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Orte, Akteure, Strategien
Menschen und Daten, aber auch Güter, Geld und Müll – alles ist in Bewegung und kann ohne Kontrolle nicht in Bewegung bleiben. Wessen Interessen werden dabei berücksichtigt? Wer wird benachteiligt? Wo können demokratische Verfahren der Bewegungskontrolle installiert werden, um mehr Gleichheit und Gerechtigkeit herbeizuführen?
In naher Zukunft werden schätzungsweise 700 Millionen Menschen durch ökonomische Krisen, Klimaveränderungen und Kriege ihre Heimat verlieren. Einige von ihnen werden in den Globalen Norden fliehen. In Europa etwa stellt uns diese Entwicklung schon heute vor drängende Herausforderungen. Hier haben demokratische Staaten immer größere Probleme, ihrer Kernaufgabe nachzukommen: den Zugang zu lebensnotwendigen Ressourcen und die Gültigkeit elementarer Rechte sicherstellen. Betroffen sind nicht nur diejenigen, die in großer Zahl nach Europa fliehen oder einwandern, sondern auch jene, die schon hier sind.
Dabei soll die allgemeine Prekarisierung der Lebensgrundlagen ohne größere Mitbestimmung geregelt werden – die TTIP-Verhandlungen sind symptomatisch für diese Tendenz. So wird die Zirkulation von Geld, Gütern und Rohstoffen, ebenso der Verkehr von Menschen, Daten und Müll in dem Maße zunehmend undurchsichtiger, in dem er einerseits zusehends komplexer wird und andererseits immer größere Ungleichheiten hervorbringt. Damit erwächst ein noch unverstandenes Problem für die Grundstruktur der Weltgesellschaft: Die Bewegungen, über die wir Verbindungen herstellen und kommunizieren, die uns das Verteilen und Teilen, die uns aber auch Flucht und Neubeginn ermöglichen – all diese Bewegungen finden in einem Netz aus Interdependenzen statt und sind daher von Kontrolle abhängig. Kontrolle, die den Verkehr steuert, damit das Netz nicht zusammenbricht. Es ist diese Form von Kontrolle als Steuerung (an Orten wie Grenzen und an Infrastrukturen im allgemeinen), ohne die das komplexer werdende Miteinander nicht auskommt. So ist schon heute spürbar: Wer Bewegungen kontrolliert, programmiert die Zukunft. Also gilt es zu fragen: Sollten steuernde Entscheidungen über Bewegungen von Menschen und Ressourcen im Dunkeln getroffen werden? Oder sollte es eine demokratische Bewegungskontrolle in Bezug auf Infrastrukturen und Grenzen geben? Und wenn ja, was muss man fordern und erkämpfen, damit demokratische Mitbestimmung möglich wird?
*
Diese globale Bewegung von Menschen avanciert immer mehr zu einer technologischen Frage: Flüchtende ebenso wie jene, die sich als Angehörige des mobilen Mainstreams wähnen, machen sich nicht mehr ohne Smartphones auf den Weg, um nicht auf GPS und andere Technologien verzichten zu müssen. Derweil wird die Bewegung von Daten zusehends zu einer Frage von sozialer und ökonomischer Teilhabe: Es geht sowohl um den Zugang zu Daten, der wiederum Wissenserwerb ermöglicht, als auch um die Steuerung und Überwachung von Datenströmen, die wiederum die Einflussnahme auf Kommunikationsvorgänge, das Zustandekommen von Gemeinschaftlichkeit im Allgemeinen und nicht zuletzt neue Abwehrverfahren der EU ermöglichen. So bildet sich das Elixier einer neuen Form von Macht, die „Bewegungsströme“ futurologisch antizipieren und durch Vorwegnahme kontrollieren möchte.
In Europa hat diese Form von Macht mit dem „preemptive border management“ Gestalt angenommen. Von besonderem Interesse ist dabei die Grenzmanagement-Agentur Frontex, die nicht nur einem Nationalstaat, sondern einem Verbund von rund 30 Staaten dient. Frontex bildet aus und trainiert, managt und koordiniert die Grenzschützer der EU, die der Zukunft zuvorkommen möchten und das Antizipierte militarisieren. Etwa dann, wenn es darum geht, „push backs“ zu organisieren.
Diplomatisch „nicht abgewickelte Rücksendungen“ genannt, betrifft dies Menschen, die gehindert werden sollen, eine EU-Außengrenze zu überschreiten. Die Grenzmanager haben den Anspruch, immer schon vor der nächsten Fluchtbewegung zur Stelle zu sein, damit in wenigen Sekunden Entscheidungen über Leben oder Tod, über Passieren-Lassen oder einen „push back“ fallen können. Prognosen ermöglichen diese Arbeit. Sie entstehen auf der Basis von aufwändigen Big-Data-Analysen. Das eigens dafür eingerichtete European Border Surveillance System (Eurosur) bietet dafür das „information-exchange framework“.
Eurosur bündelt die Daten von Überwachungszeppelinen, Drohnenbooten, Radaranlagen, Bewegungs- und Offshore-Sensoren, sowie Informationen aus Risikoanalysen, Satellitenbildern und Archiven mit Migrantenprofilen. Neben nationalen Grenzbehörden zählen auch die European Maritime Safety Agency und das EU Satellite Centre zu den Partnern dieses Überwachungsnetzes. Dieser demokratisch schwer zu kontrollierende militärisch-informationelle Komplex begünstigt die Fusion von Datenbanken staatlicher und privatwirtschaftlicher Akteure und treibt die Bürokratisierung der Geflüchtetenregistrierung voran, mit Knotenpunkten wie der Europäischen Agentur für IT-Großsysteme (kurz: eu-LISA), der European Dactyloscopy (der europäischen Datenbank zur Speicherung von Fingerabdrücken, kurz EURODAC) und im Falle Deutschlands dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (kurz: LaGeSo), das die Aufgabe der Zentralen Leistungsstelle für Asylbewerber in Berlin innehat.
Im Schatten der Verdatung mutiert Bewegungskontrolle. Demokratische Verfahren sind dabei immer weniger von Willkür zu unterscheiden. Außengrenzen werden nach Belieben reaktiviert, hybridisiert und dynamisiert. Sie verschwinden in Glasfaserkabeln und werden zusehends ortlos. Im Zuge dessen verschieben sie sich auch ins Innere, etwa in die Innenstadt Berlins, wo unzählige Geflüchtete vor der Erstmeldestelle verharren wie vor einer Landesgrenze. Die Gründe für diese Verhältnisse liegen nicht zuletzt in einer unreifen EU-Flüchtlings- und Migrationspolitik. Beispielsweise ist es an europäischen Außengrenzen nur theoretisch möglich, einen Asylantrag zu stellen. Zudem stehen Länder, aus denen heute die meisten Geflüchteten in Europa eintreffen, auf einer „visa black list“.
Was bedeutet das? Die illegale und unregulierte Einreise über die Infrastrukturen der Schlepperindustrie ist so vorprogrammiert – ebenso die hohe Lebensgefahr dieser Option. Das wiederum produziert „hässliche Bilder“, Maßlosigkeit und Unkontrollierbarkeit. Länder entlang der Balkanroute nehmen dies zum Anlass, die Dublin-III-Verordnung1 nicht mehr anzuwenden. Der Fall ist rechtlich nicht geregelt. Die Koordinaten des Asylrechts geraten ins Wanken. Parallel dazu wird das Schengener Abkommen ausgehöhlt, wenn Staaten wie Deutschland, Österreich, Slowenien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Malta und Frankreich mehr oder weniger beliebige Grenzkontrollen wieder einführen.
In so einem Moment „stirbt die Idee von Europa“, wie Georg Seeßlen vergangenen Herbst notierte. Ebenso schleichend kommt es zum Tod von Menschenrechten, wie dem der Bewegungsfreiheit innerhalb eines Staates, wenn Residenzpflicht durchgesetzt wird und damit eine Verpflichtung für Geflüchtete, bestimmte Kreise nicht zu verlassen. Selbst dann, wenn in der Praxis „Kontingentflüchtlinge“ in festgelegten Anzahlen gleichmäßig auf einzelne Bundesländer verteilt werden.
Vor diesem Hintergrund liegt es an sozialen Bewegungen wie Blockupy oder an paneuropäischen Bürgerbewegungen wie DiEM25, die Aufgaben einer europäischen Ordnungsmacht zur Diskussion stellen – speziell im Hinblick auf eine transparente Politik des Grenzmanagements und demokratische Formen der Bewegungskontrolle. Oder sollten wir auf Brüssel warten?
*
Heutzutage offenbaren die diversen Trends der Bewegungskontrolle ihre Fragwürdigkeit am dramatischsten entlang des Flüchtlingstrecks zwischen Assos und Lesbos, Idomeni und Opatovac, Budapest und Berlin. Hier, in den intransparenten Infrastrukturen des Fluchtverkehrs, kippt demokratische Bewegungskontrolle allzu sichtbar ins Unregulierte und Willkürliche. Dabei erodieren Menschenrechte, etwa das Recht auf Asyl und das Recht auf Bewegungsfreiheit.
Am Horizont der Europakrise, die auf absehbare Zeit vor allem auch eine Flüchtlingskrise sein wird, zeichnet sich die große Herausforderung ab, die Wechselbeziehung von Infrastrukturen und Bewegungskontrolle aktiv zu gestalten. Können Infrastrukturen transparent verwaltet werden, so kann es auch gelingen, Bewegungen demokratisch zu kontrollieren. Das gilt auch für Fluchtbewegungen.
Umgekehrt kann demokratische Bewegungskontrolle maßgeblich dazu beitragen, Infrastrukturen zukunftsweisend weiterzuentwickeln. Auch das zeichnet sich entlang des Flüchtlingstrecks ab: Hier, an den Rändern gesellschaftlicher Systeme, wo Staaten und Märkte die Menschen zur unbedingten Selbstverantwortlichkeit aufgerufen haben, revitalisieren Geflüchtete sowie „WillkommensbürgerInnen“ das demokratische Projekt: Migration als soziale Bewegung.
Sie überraschen durch kollektiv entwickelte Überlebensstrategien und durch innovative Formen der wirtschaftlichen und politischen Teilhabe. Die Selbstorganisation und das kooperative Handeln stehen im Zeichen von Peer-to-peer-Bewegungskontrolle: Die Bewegungen werden nicht von oben oder von außen gesteuert, sondern durch die Handelnden selbst, indem sie auf Augenhöhe miteinander einen Dialog eingehen und solidarische Netzwerke erschaffen – in Bereichen wie Pflege, Verkehr, Bildung und vielem mehr. So könnten neue Infrastrukturen entstehen, die Wege in eine gemeinsame Zukunft weisen.
Um das Potenzial und die Problemlage zu erkunden, sollten zunächst jedoch die defizitären Infrastrukturen der Fluchtbewegungen näher betrachtet werden. Denn hier verbergen sich Grenzen allenthalben dort, wo über Recht und Partiziption entschieden wird – also darüber, ob und in welchem Ausmaß jemandem Grund- oder Menschenrechte und Zugang zu Wissen oder Gesundheitsvorsorge zugestanden werden. Sie können, potentiell so omnipräsent wie Drohnen etwa, überall vorgefunden werden entlang des Flüchtlingstrecks und verbergen sich etwa in den immer wieder skandalisierten Schleuser- und Schmugglernetzwerken, Schlauchbooten, Grenzposten, Hotspots, Lagern, Meldestellen, Notunterkünften, Asylheimen, Abschiebehaftanstalten und Deportationsflügen. Wer ankommt oder nicht, wer kurz oder ewig warten muss, wer anerkannt wird und wer nicht, wer weiter darf oder wer zurück muss – die Bewegung von flüchtenden und geflüchteten Menschen wird auf schwer nachvollziehbare, teils willkürliche Weise kontrolliert. Der Begriff „Blackbox Abschiebung“ (Miltiades Oulios) bringt die Zustände exemplarisch auf den Punkt, denn es gibt kaum Einblicke in die Infrastrukturen der Flucht. Gleiches gilt aber auch für die Bewegung von Daten – die von Geflüchteten wie vom mobilen Mainstream gleichermaßen genutzt werden.
Die digitale Infrastruktur, die selten in diesem Kontext betrachtet wird, besteht aus Smartphones, Facebook-Accounts, Service-Providern, Glasfaserkabeln, Knoten, One-Stop Shops, Datenzentren und Datenbanken. Ob Datenpakete schnell, langsam oder gar nicht eintreffen, näher inspiziert werden oder nicht, gesammelt und analysiert werden oder unbeachtet bleiben, kurz- oder langfristig gelagert werden, weitergereicht werden oder nicht, via Empfehlungsalgorithmen priorisiert werden oder nicht – all diese Entscheidungen werden unter fragwürdigen Bedingungen getroffen. Ob es dafür noch eine Art von demokratischer Legitimation geben kann, wird sich dann zeigen, wenn die Orte und Zeiten für eben diese „Politik der Mikro-Entscheidungen“ (Florian Sprenger) durch zivilgesellschaftliche Akteuren identifiziert, ausgeleuchtet, okkupiert und im Zuge dessen demokratisiert werden können.
Die Komplexität dieser Herausforderung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass akuter Handlungsbedarf besteht. Die hermetische Black-Box-Politik der Daten-Infrastrukturen regelt nicht nur auf intransparente Weise den digitalen Verkehr der Bits, sondern auch das Zustandekommen von Kommunikation, ja das Zustandekommen von sozialen Verbindungen. Diese sind gerade auch im sozialen Raum der Prekären, Marginalisierten und Geflüchteten heute ohne das Internet nicht denkbar.
All das haben auch Edward Snowdens Enthüllungen nicht geändert. Doch sieht man nun klarer denn je, was für die Gesellschaft auf dem Spiel steht. Außerdem kann man besser als je zuvor nachvollziehen, warum dem Konnex von „Geolocation“ und Mobilität eine gesteigerte Bedeutung zukommt. Die algorithmische Analyse von Informationen auf der Basis von dazugehörigen Ortsdaten macht rasante Fortschritte. Ganze Industrien entstehen, um aus Metadaten Bewegungsprofile zunehmend mobiler Bevölkerungen abzuleiten. Unterstehen Metadaten dem Datenschutz? Angeblich nicht, weil sie keine Relevanz für die Privatsphäre haben. Snowdens Enthüllungen zeigen das Gegenteil. Doch ein demokratisches Verfahren dieser besonderen Bewegungskontrolle ist bislang nicht in Sicht.
Wie kann eine transparentere Verwaltung der Infrastrukturen gestaltet werden? Welcher Rahmenbedingungen bedarf es, um demokratische Bewegungskontrolle zu ermöglichen? Wie können Menschenrechte gewahrt bzw. geltend gemacht werden?
Es ist an der Zeit, die „Globalisierung“ einmal mehr als Politikum zu hinterfragen und dabei die Diskurse der „Digitalisierung“ und der „Migration“ miteinander ins Gespräch zu bringen. Dieser Konnex ist noch weitgehend unterbelichtet, weil Bewegungskontrolle für den Verkehr von Menschen und Bits weder systematisch zusammengedacht noch als gemeinsamer Nenner der Auseinandersetzungen wahrgenommen wird.
Doch erst wenn die unsichtbaren Verbindungen dieser Diskurse offengelegt werden, könnte politisches Handeln auf einer tieferen, strukturellen Ebene möglich werden, also dort, wo sich die Komplexität von Bewegungen adäquat erfassen lässt. Oder auch dort, wo sich die zeitgenössische Struktur von Macht offenbart – nämlich als „movement-based power“ (Brian Massumi). Um Gegenmächte zu formieren, gilt es insofern das breite Spektrum zivilgesellschaftlicher Akteure in neuer Weise miteinander zu vernetzten.
Dazu zählen Transparenz-Initiativen, die die opaken Verwaltungsinstanzen der Infrastrukturen adressieren – etwa Datenjournalismus-Projekte wie The Migrant Files. Oder Initiativen, die WillkommensbürgerInnen mit sozialen Bewegungen zusammenbringen, in deren Fokus Gemeingüter und Infrastrukturen stehen. Darüber hinaus Initiativen, die Netzneutralität und Menschenrechtsaktivismus zusammendenken. Nicht zuletzt Initiativen von Geflüchteten, die kollektive Selbstorganisation, politische Emanzipation und p2p-Kooperation in den unsichtbaren Räumen der Überlebensökonomien kultivieren. Aber auch Initiativen, die, wie Blockupy, das europäische Grenzregime herausfordern – etwa mit dem European March for Refugees Rights.
Insofern geht es heute für die Zivilgesellschaften primär darum, die Frage nach einer Bewegung der Bewegungen ernst zu nehmen und auf der Höhe der Zeit bzw. ihrer größten Konflikte zu denken.
Krystian Woznicki organisiert gemeinsam mit der Berliner Gazette die dreitägige Konferenz „TACIT FUTURES. Verborgene Zukünfte, Visionen für demokratische Bewegungskontrolle“, die von 27.-29.10. in der Volksbühne stattfindet
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
1 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist.
Im Rückblick, aus größerem Abstand, werden die Dinge kleiner, sollte man meinen. Es gibt aber auch Dinge, die werden dann größer, der Abstand verringert sich, der Zusammenhang tritt erst richtig hervor und reicht womöglich bis in den heutigen Tag. So steht es um die soziale Natur der ostdeutschen Erfahrung. Ein Vierteljahrhundert steckt sie schon in der westdeutschen Hülle und bewegt sich nun selbständig vielleicht zum ersten Mal wieder.
In der Zeitrechnung der DDR-Geschichte stünden wir mit 25 Jahren etwa bei 1975, nehmen wir noch die SBZ hinzu, wären wir im Jahr 1970. Das war die Zeit, in der das innere Gleichgewicht der DDR-Gesellschaft umschlug, ihrer politischen Konstruktion die Initiative verloren ging und stattdessen die Mehrheitsgesellschaft sich durchzusetzen begann. Mindestens bis dahin müßte man auch zurückgehen, um von dem Fortgang der Ereignisse etwas zu verstehen – aber das Verstehen steckt wohl gerade in einer weltweiten Rezession.
Der ostdeutsche Arbeiter in seiner DDR-Gestalt stand erstaunlich frei inmitten seiner industriellen Gegenstandswelt. Das Gemeinwesen garantierte ihm den Arbeitsplatz, so wurde sein Nebenmann kein Konkurrent und der Betriebsleiter kein Eigentümer. Es war zwar nur eine politische Garantie, aber immerhin umfaßte sie die Gesellschaft im Ganzen. Sie galt allen, dem Arbeiter wie dem Angestellten, dem Bauern wie dem Künstler, dem Professor wie dem Studenten, dem Arzt und seinen Patienten. Sie betraf sämtliche wirtschaftlichen und kulturellen Gliederungen, und die dort Betroffenen zogen, je länger je mehr, ihre eigenen Konsequenzen aus diesem Produktionsverhältnis. Die langfristige Stagnation des Staatssozialismus war kein Stillstand, sie war zunächst das Aufhören der Umbauinitiative von oben. Doch nur deshalb, weil die Verwalter stagnieren, hören alle anderen nicht auf, sich als Subjekte zu verhalten.
Und was konnten wir tun in solcher Lage? Der erste Blick galt den mißlichen Umständen, der zweite dem Kollegen. Um der Mangelwirtschaft standzuhalten, brauchte man ihn. Da die unpraktischen Bedingungen weitgehend gleich waren, rückten persönliche Beziehungen bald an die erste Stelle. In ständig breiterem Maßstab bestimmten personale Verhältnisse die gesellschaftliche Entwicklung. „Wer mit wem konnte“, nicht wer wieviel zahlte, das entschied über die alltäglichen Probleme, sei es am Arbeitsplatz oder andernorts im Leben. Jeder Fabrikarbeiter kannte die Maxime „Privat geht vor Katastrophe“. Sie bezeichnet zwar nur eine enge Schwundstufe der sozialen Praxis, aber auch sie enthält deren allgemeine Grundform. Gegenseitige Hilfe mußte die Mängel ausgleichen – und tatsächlich vermochte sie die Lücken in dieser Zivilisation weitgehend zu schließen. Gegenseitiges Kennenlernen war die erste Lebensbedingung für diese Art von Parallelgesellschaft. Was getan werden konnte, wurde getan. Man kann es auch Alltagswiderstand nennen, und er griff viel weiter in die Gesellschaft hinein als die Ideen der kleinen Opposition. Durch mindestens zwei Jahrzehnte hindurch war diese im Grunde personale Vergesellschaftung, im Guten wie im Bösen, die lange Vorgeschichte von 1989.
Die Verzweiflung war schließlich groß, wenn auch nicht tief geworden, sie war allseitig und allerseits anzutreffen, ausgebreitet über das ganze kleine Land. Die Selbstbestimmung begann für die Mehrheiten als großartige Ratlosigkeit gegenüber dem „großen Ganzen“ der Gesellschaft. Beim ersten Schritt vollständig auf sich selbst zurückgeworfen, übertrugen sie die gute alte Gegenseitigkeit nun ins politische Handeln. Wieder ging der Blick zum Nebenmann, um Wort und Weg zu finden. Jeder sah beim andern dieselbe Frage und fand die gleiche Antwort. So begann die Bewegung dialogisch, und was eben noch Ratlosigkeit gewesen war, setzte sich als Gewaltlosigkeit durch. Natürlich, die politischen Differenzierungen folgten bald nach, innerhalb weniger Wochen, aber auch sie konnten diese tiefe Gemeinsamkeit auf Jahre hinaus nicht zerstören.
Diese durchgreifende Gewaltlosigkeit im Vollzug einer grundstürzenden Revolution ist die eigentliche Erbschaft der staatssozialistischen Gesellschaften. Sie deckte gleichzeitig mit der Inkohärenz der politischen Konstruktion auch die soziale Kompetenz ihrer Mitglieder auf. Die sofort einsetzende Generalaussprache in der Gesellschaft war auf die Bildung einer eigenen Öffentlichkeit aus und darauf zwingend angewiesen. Der Fortgang der deutschen Einigung verengte diesen Prozeß thematisch und brach ihn 1992 gänzlich ab, in dem die notwendigen Institutionen aufgelöst oder umbesetzt wurden. Sämtliche Medien, jede TV-Anstalt, jeder Radiosender, jede Chefredaktion einer großen Zeitung, waren seitdem altbundesdeutsch dominiert. Auf dieser Basis konnte nie mehr als ein öffentliches Selbstgespräch der Westdeutschen über die Ostdeutschen entstehen.
Zu der industriellen Enteignung trat die mediale Entfremdung hinzu. Daraus ergab sich keine Öffentlichkeit, die den Umbrüchen seither gewachsen gewesen wäre, die dem Nachdenken auf die Sprünge hätte helfen können und die neuen Umstände durchsichtig machte. Besteht kein Zugang zur Herkunft, entsteht auch keine Offenheit für die Zukunft – ein doppelter Verschluß der Perspektiven. Das politische Gespräch ist wieder aufs Privatgespräch heruntergedrückt. Ganz im Gegensatz zu dem Lamento der etablierten Parteien über die jüngste Neugründung im Spektrum spricht es durchaus für uns, daß hier nur 15% den Ausweg an der falschen Stelle suchen. Die Zahl zeigt eben die Menge des Gifts an, das sich in der Gesellschaft angesammelt hat.
Unsere Revolution wird als Konterrevolution dargestellt. Statt der Emanzipation, die sie für uns in Wahrheit war und ist, wird die unendliche Geschichte von der Repression erzählt. Diese Erzählung nennt sich „Aufarbeitung“. Von unserm alltäglichen Widerstand kann sie nur eine „durchherrschte Gesellschaft“ erkennen. Aber 89 war kein Aufstand, sondern eine Bewegung. Eure Muster treffen unsere Erfahrung nicht. Die Frage ist, was wird aus unserer Erfahrung in dieser Einsamkeit?
Klaus Wolfram, geboren 1950, Philosoph, ostdeutscher Oppositioneller seit 1975, Herausgeber der "Anderen Zeitung" 1990-92, Mitbegründer des Verlags BasisDruck
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
„Wer DADA isst, stirbt daran, wenn er nicht DADA ist.“
Raoul Hausmann
Einen Namen tragen heißt sterben müssen.
Benannt zu werden, kurz nach unserer Geburt, ist die Feststellung dessen, dass unser Tod unabwendbar ist. Es bedeutet, dass jemand Sorge dafür trägt, dass wir etwas anderes, etwas mehr, sind, als unser organischer Zusammenhang. Es gibt also etwas an uns, das un-leiblich, un-sterblich ist. Und dennoch braucht auch der Name einen Leib, braucht er etwas, das er bezeichnen kann. Sonst bleibt er ein Laut, Musik, im besten Fall.
Vielleicht ist es der Name, der den phänomenalen Leib, das leibliche In-der-Welt-Sein, zum Körper macht. Zu einem Körper, den Menschen manipulieren und instrumentalisieren können und wollen. Zu einem Körper, der seine Bedeutung auch in einem symbolischen Zusammenhang sucht.
Was aber bedeutet es unter diesen Umständen, sich selbst zu nennen, nicht benannt zu werden und den Namen zu tragen wie ein Schicksal? Was bedeutet es, die Autonomie zu besitzen, sich selbst einen Namen zu geben? Und was bedeutet das für das sogenannte „Selbst“? Selbstbezeichnung ist auch immer ein Akt der Selbstermächtigung.
1916 ‚gebiert sich’ in Zürich der „Club DADA“. Oder anders, der Club DADA fängt an, sich zu gebären, denn wenn man Raoul Hausmann glaubt, „war DADA eine riesige Entbindung, aber niemand hatte die Kühnheit, einer Entbindung zuzusehn“. Ob DADA zuerst da war oder der Name DADA ist ungewiss und muss es bleiben, denn was DADA ausmacht und was DADA zu einer „riesigen Entbindung“ macht, ist diese Ununterscheidbarkeit – die Ununterscheidbarkeit zwischen dem Namen DADA und dem Leib DADA, zwischen der Entstehung eines Zeichens und eines Bezeichneten. Eine Ununterscheidbarkeit, mit der wir Menschen, die wir uns über unseren Namen identifizieren, immerzu konfrontiert sind.
In dieser kleinen Verschiebung der Selbstbenennung anstelle des Genanntwerdens wird offensichtlich, was wir an uns selbst nicht sehen können: die Entbindung aus dem Naturzustand und die Einbindung in den sozialen Körper der Sprache. Der Name DADA, ist das, was DADA zu einer Avantgardebewegung macht. Das Verhältnis des Namens DADA zum Leib DADA, die Unmöglichkeit der Existenz des Einen ohne das Andere, die auf uns selbst hinweist ohne didaktisch zu sein und die ein Grundproblem des Seins in sich trägt, die es gebiert, die nur in diesem Konflikt lebt und ohne ihn sterben würde oder nie dagewesen wäre und die Tatsache, dass sich dieser Konflikt in der Kunst austrägt und nicht in uns selbst – das ist, was Avantgarde ist, was Avantgarde immer sein muss: Ein Konflikt, der hervorgebracht wird durch das Kunstwerk selbst, der nicht etwas zeigen soll, sondern der etwas ist. Ununterscheidbar, ob durch den Künstler bewusst hergestellt oder ihm unterlaufen. Ununterscheidbar, ob Werk eines Künstlers oder ein autonomer lebendiger Name, ein autonomer lebendiger Leib – das eine pustet dem anderen Leben ein.
Dass die Selbstermächtigung durch Namensgebung auch über Leben und Tod entscheiden kann (und dass ihre Konsequenzen gleichwohl nie vollständig in unserer Hand liegen) zeigt die Geschichte von dem listenreichen Odysseus und dem einäugigen Polyphem. Odysseus und seine Gefährten gelangen auf einer ihrer Irrfahrten auf die Zyklopeninsel. Dort treffen sie in einer Höhle den Zyklopen Polyphem. Polyphem, bekannt dafür besonders gern Menschenfleisch zu essen, verspeist zur Begrüßung zwei von Odysseus Gefährten. Da Odysseus nun auch um sein Leben fürchtet, schmiedet er einen listigen Plan. Er macht Polyphem betrunken und erzählt ihm, sein Name wäre „Outis“, das altgriechische Wort für „Niemand“. (Natürlich fällt hier die Lautverwandtschaft zwischen „Outis“ und „Odysseus“ auf, eine Lüge fällt immer leichter, wenn die Wahrheit nicht weit entfernt ist). Als der betrunkene Riese in seinen betrunkenen Schlaf fällt, blenden Odysseus und seine Gefährten ihn, indem sie ihm einen glühenden Pfahl in sein einziges Auge stoßen. Polyphem ruft seine Zyklopenfreunde und erzählt ihnen aufgebracht „Niemand“ hätte ihn geblendet und „Niemand“ wollte ihn ermorden. Odysseus und seine Gefährten sind daraufhin gerettet, Polyphem bleibt blind und unverstanden zurück.
Selbstbehauptung aber ist auch Selbstverleugnung - Odysseus wird einen Teil des „Niemand“ nie wieder los. Er ist damit – in der Interpretation seines Lesers Adorno – der erste homo oeconomicus.
Odysseus befreit sich vom Gewaltzusammenhang der Natur, symbolisiert durch Polyphem, und stellt sich, indem er sich selbst (um-)benennt, in den symbolischen Zusammenhang der Sprache und des Sozialen. Die Idee vom eigenen Namen als etwas Natürlichen, und somit auch der eigenen Bestimmung, als etwas Unabwendbaren, Schicksalhaften, wird durch diese Selbstbenennung, durch die listige Verschiebung von Odysseus zu Outis, negiert. Sich von seiner scheinbar unveränderbaren mythischen Identität, von seinem vorgesehenen Auftrag auf der Welt, zu befreien ist ein Akt der Emanzipation.
Vielleicht zeigt DADA den „-ismen“, den Genies des 18. und 19. Jahrhundert, dass sie alle eigentlich auch ‚DADA’ sind – so wie Odysseus uns zeigt, dass wir alle auch „Niemand“ sind.
In dieser Variante wäre das Wort DADA ein Synonym für ein NICHTS, das an die Stelle von ETWAS tritt und damit das ETWAS, in diesem Fall einen formalen Konsens, entlarvt. Ein Jahr vor der DADA-Gründung stellt Kasimir Malewitsch in Sankt Petersburg sein Gemälde „Das schwarze Quadrat“ aus. Die Bedeutung des Gemäldes, das genau das zeigt, was der Titel verspricht, entfaltet sich erst durch seine Platzierung – an der höchsten Stelle einer Ecke des Raumes, umgeben von anderen Bildern Malewitschs. Es nimmt damit die Position ein, die in einem traditionellen russischen Haus einer religiösen Ikone vorbehalten ist. Malewitsch, der „die Empfindung der Gegenstandslosigkeit“ darstellen will, opfert das Bild bzw. die Idee der Abbildbarkeit der künstlerischen Geste der Verneinung. Ein schwarzes Quadrat erfährt seine Bedeutung nur durch das Prinzip der Subtraktion, indem es in seiner Leere das fehlende Bild sich vor dem Betrachterauge noch verflüchtigen lässt.
Man sieht also keine Ikone dort oben hängen und man sieht auch nichts anderes, das ihr Bild im Rahmen ersetzt – man sieht die Abwesenheit des Gemäldes.
Im Sinne dieser Lesart, der Lesart der Subtraktion, die charakteristisch für den Avantgardebegriff des 20. Jahrhunderts ist, wäre der Name DADA ein Sprachspiel, das nur im Verhältnis zu den großen -ismen der vergangenen Jahrhunderte seine Bedeutung findet, ein Vehikel in einem Kampf, der eher auf politisch-symbolischer Ebene stattfindet. Es wäre damit auch eine ideologiekritische Geste, im Sinne dessen, was Marx im Kapitel zum Fetischcharakter der Ware beschreibt – nämlich, dass der Wert keine natürliche Eigenschaft der Ware ist (die Marx als „sinnlich übersinnliches Ding“ beschreibt), sondern eine Eigenschaft, die sich zurückführen lässt auf Arbeit an ihr. Der Name DADA dechiffriert tatsächlich ein ähnliches Modell auf zwei Ebenen – er ist sowohl Kunstkritik als auch Sprachkritik. Er wendet sich, in seiner und durch seine Naivität, gegen jede Idee der Ursprungslosigkeit. Wichtig ist hier aber, und das unterscheidet DADA von Malewitsch, dass DADA kein didaktisches Programm ist – DADA entzieht sich einer Deutbarkeit im Sinne der Subtraktion. Die Bedeutung DADAs ist nicht allein in der Bezüglichkeit zu vorherigen künstlerischen Schemata zu suchen.
„Dada bedeutet nichts, wenn man es für nichtig hält und seine Zeit mit einem Wort verlieren will, das nichts bedeutet. Der erste Gedanke, der sich in diesen Köpfen wälzt, ist bakteriologischer Art: seinen etymologischen, historischen, wenigstens aber seinen psychologischen Ursprung finden. Man lernt aus den Zeitungen, daß die Cru-Neger den Schwanz einer heiligen Kuh Dada nennen. Der Würfel und die Mutter in einer gewissen Gegend Italiens sind: Dada. Ein Pferd aus Holz, die Amme, doppelte Bestätigung im Russischen und im Rumänischen: Dada. Gelehrte Journalisten sehen darin eine Kunst für die Babys. Andere heiligen Jesusappelantlespetitsenfants des Tags, die Rückkehr zu einem Primitivismus, trocken, lärmend und monoton.“, schreibt Tristan Tzara im Manifest DADA 1918 und zeigt deutlich in welchem Widerspruch sich der Name DADA befindet. Tristan Tzara markiert die Interpretationen, die er spöttelnd und doch erstaunlich interessiert wiedergibt, als etwas, das dem sich verflüchtigenden Bild auf dem schwarzen Malewitschquadrat ähnlich ist. Der Name DADA bedeutet nichts und ist gleichzeitig angefüllter, nach Bedeutung suchender, zum Deuten einladender als jeder andere kategorisierende Begriff.
Je mehr das Wort DADA aber nach Aufladung sucht, desto undeutbarer wird es, desto mehr ist es am Ende vor allem eins: DADA. DADA ist nicht NICHTS, sondern ein NONSENS, ein mit Fragen gefülltes Nichts, ein mit sich selbst angefülltes Nichts, ein manifestiertes, entschiedenes Nichts, ein Zeichen, das auf sich selbst hinweist und damit etwas erschafft, für das es kein Synonym gibt. Es ist ein ketzerischer Akt, einen Nonsens herzustellen, und er erfordert mehr als Ablehnung gegenüber einem veralteten Paradigma – er erfordert Autonomie. Man kann nicht radikal gegen ein Regelsystem sein, ohne nicht auch, manchmal nur insgeheim, eine andere Systematik an die Stelle der Vorherigen zu setzen und sie damit für unwirksam zu erklären. Im Falle von DADA ist es die Systematik DADA, die Systematik des Widerspruchs, das System, dessen oberstes Gebot es ist, seine Systematik abzulegen.
1955, also Jahrzehnte nachdem DADA schon die radikale Überschreitung von Regelsystemen (zumindest) in der Kunst eingeführt hat, wird Rosa Parks in Alabama verhaftet, weil sie sich weigert, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen männlichen Fahrgast zu verlassen. Das politische Moment liegt hier nicht in der Geste des Sich-Weigerns, sondern in der Nonchalance, die Rosa Parks dabei an den Tag legt. Rosa Parks überschreitet eine Grenze ohne die Grenze dabei noch einmal zu markieren, sie wehrt sich nicht gegen etwas, dessen Existenz sie im Moment ihres Protestes noch einmal bestätigt (zum Beispiel, indem sie es benennt), sondern ignoriert das Vorhandensein (und Vorhandengewesensein) einer Gesetzmäßigkeit völlig und entkräftigt sie somit auf eine so tiefgreifende Art, wie als solche definierte Protestformen es kaum könnten.
Auch DADA ist keine Protestbewegung, sondern eine Bewegung der Überschreitung – und auch das ist schon in der Namensgebung DADA angelegt. Der Name DADA nämlich ist wie eine Ephemere. Ephemeren sind Pflanzen, die innerhalb von sehr kurzen Vegetationsperioden Blüten und Früchte bilden, um danach wieder abzusterben. Ihre Samen aber bleiben im Boden und alle paar Jahre, wenn es ganz besonders regnerisch ist, kommen sie wieder hervor und erinnern die anderen Pflanzen an ihre Existenz. Und auch wenn sie sich gerade versteckt haben, weiß man, dass sie sich jederzeit wieder zeigen können, und so sind sie auch in ihrer Abwesenheit immer präsent, präsenter vielleicht als die anderen Pflanzen, die das ganze Jahr über blühen. „Wir sind KEINE Ephemeren“ wissen die anderen Pflanzen und ihr Pflanzenleben ist maßgeblich von diesem Wissen bestimmt.
Auch jede politische Rede ist seit DADA dadurch markiert, dass sie aus Worten besteht, die nicht DADA sind, unabhängig davon, ob auch der Redner sich dessen bewusst ist. In der Historizität und der Intelligenz der Worte selbst ist das Nicht-DADA-sein seit 1916 eingeschrieben.
Die Beschäftigung mit DADA legt eine Denkbewegung nahe, die sich auf auffällige Weise wiederholt und signifikant für Avantgardekunst ist. Fast aufdringlich erscheint einem die Deutung DADAs als einer Bewegung der Destruktion des Vorhergegangenen, als einer Re-Materialisierung von Sprache und Bild, als eine kühle Geste der Verwerfung. Bei etwas näherer Betrachtung der Phänomenalität des einzelnen Kunstwerkes fällt aber auf, dass man DADA nicht auf seinen Verneinungsgestus reduzieren kann – allein der Name DADA in seiner Vieldeutigkeit, seinem Klang, seiner ästhetischen Beschaffenheit, seiner Körperlichkeit und auch seinem Humor legt nahe, dass es sich um ein Kunstwerk handelt, das im positiven Sinne unvollständig, spontan, unkalkuliert ist, das sich also seine Gesetze selbst gibt und deshalb nicht nur in historischer Bezüglichkeit einen Platz findet. Man stellt fest, dass sich die Unterstellung, die man DADA gemacht hat, nämlich dass sich ein Bruch mit den vorhergegangenen künstlerischen Schemata vollzieht, tatsächlich einstellt, aber nicht auf kühle strategische Art, sondern nur durch das Kunstwerk selbst. Das auflösende Moment liegt im Unbeholfenen, Ungelenken, in der nie didaktischen Einzigartigkeit, nur durch sie entsteht die Ereignishaftigkeit, in der die politische Dimension von DADA liegt.
Im DADA-Gründungsjahr 1916 schreibt Walter Benjamin einen Aufsatz über die Sprache. In diesem Aufsatz stellt er die These auf, dass es keinen Inhalt der Sprache gibt, der nicht in der Sprache selbst liegt. „Als Mitteilung teilt die Sprache eine Mitteilbarkeit schlechthin mit“ schreibt er und berührt damit auf fast erschreckende Art das Problem, das sich in den Lautgedichten von Hugo Ball ganz spielerisch entfaltet. Es ist ein Moment des Erstaunens, wenn sich ein Kunstwerk einlöst, ein sinnliches Verstehen, hinter das man nicht mehr zurück kann. Wenn man einmal ein Gedicht gelesen hat, das mit der Zeile „jolifanto bambla o falli bambla“ begonnen hat, wird jedes Gedicht in deutscher Sprache für immer eine andere Bedeutung haben. Vielleicht zerfällt es plötzlich selbst in seine Laute, vielleicht hört man plötzlich die Geschichte der Worte, vielleicht hört man auch lauter als vorher die Geschichte des Landes, dem die Sprache zugeordnet ist. Auf jeden Fall hört man immer auch leise im Kopf „jolifanto bambla o falli bambla“. In der Beharrlichkeit von „jolifanto bambla o falli bambla“ ist DADA also unsterblich, befreit von der Melancholie des Sterben-Müssens, befreit von der Ohnmacht des Benannt-Seins.
Im Jahr 2016, einhundert Jahre nach „jolifanto bambla o falli bambla“, hat sich die Schönheit der Sinnlosigkeit auf die europäischen Supermärkte ausgebreitet. Im Kühlregal stehen nebeneinander acht Flaschen eines Getränks namens „VITAMIN WELL“, Astronautennahrung nachempfunden. Die Flüssigkeiten sind auf acht verschiedene Arten farblos durchsichtig. „VITAMIN WELL“ schmeckt nach Gift und enthält einen für Mineralwasser erstaunlich hohen Anteil an Zucker. Ihre Namen sind „Vitamin D + B“, „Vitamin C + E“, „Vitamin B + D“, „Vitamin C + D“, „Vitamin B + C + E“, „Vitamin B12“, „Vitamin B + C“ und „Vitamin C+ D mit Zink“. Die Ware verspottet ihre Käufer. So wie man heute DADA vorwerfen kann, dass sich das Moment der Störung in Affirmation verwandelt hat, dass DADA kanonisiert -, zum –ismus geworden ist, so wird mit „VITAMIN WELL“ die Affirmation zur Störung: Alle werden zu Astronauten auf der Erde, alle sterben als Astronauten auf der Erde, alle sterben an „VITAMIN WELL“.
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
--