

Embedds¹ - Ausgang
So eingebettet, so tief drin in der komplizierten und unerschöpflichen Konsumapparatur. Der Versuch, sich noch Gedanken über das ungreifbare Ganze zu machen scheint sinnlos. Warum noch die Anstrengung unternehmen, sich über das Spielfeld zu erheben, wenn man dadurch immer nur auf eine andere, besser ausgestattete Version desselben Spiels stößt? Egal wohin man schaut, man ist festgeklebt an seinem partikularen Standpunkt. Das weit verbreitete Mantra „Man weiß ja so wenig“ (dessen beunruhigend beruhigende Wirkung Bettina Gaus vor einigen Monaten in der taz beklagt hat² ) kann vorübergehend die überschüssige Hoffnung besänftigen, die sich gleich darauf wieder damit beschäftigt, zahllose Teillösungen zu portionierten Problemen zu schaffen. Ein schöner Kreislauf, ein angenehmer Drehwurm.
Manch ein Problem jedoch, obwohl durch den Flat Screen in sicherer Distanz aufbewahrt, verwickelt uns in einen Blickwechsel, der für einen flüchtigen Moment einen Gesamteindruck notwendig macht. Die Drohne zum Beispiel. Unbemannter Krieg, eine Irritation, an der man hängen bleibt. Und zwar weniger, weil sich hier unbedingt zu allererst eine moralische Frage stellen würde, sondern vielmehr weil sie faszinierend zwischen Macht und Ohnmacht oszilliert. Weil sie fliegt und trotzdem nicht Freiheit verkörpern kann. Weil der seltsame Umstand, dass die Drohne uns zwar sieht, aber nicht anzuschauen scheint, eine hypnotische Wirkung entfaltet. Die Gleichzeitigkeit von Humanität und Terror, von chirurgischer Präzision und des plötzlichen, erbarmungslosen Einbruchs des Todes in den Alltag.
Taktik – Mimikry
In dieses paradoxe Labyrinth, als das der Drohnenkrieg sich präsentiert, gibt es keinen anderen Eingang, als der Drohne mimetisch zu begegnen, ihren Tanz einzustudieren, indem man ihrem Schatten auf dem Boden nachläuft – in der Hoffnung, irgendwann abzuheben und einen Überblick zu gewinnen, der sie und uns in der Welt verortet.



Metamorphose 1-3
Die Taktik fußt auf der Annahme, dass totaler Überwachung nicht mit dem Schutz der Privatheit, sondern nur mit Gegenüberwachung beizukommen ist. Weil die Technik des Über-die-Verhältnisse-Wachens den Apparaten überlassen wurde, werden wir nun bei ihnen in die Lehre gehen müssen – Die Konstellationen, in denen sich die Drohne bewegt, soweit wie möglich abschreiten, um die inneren Programme an den Zerstörungen abzulesen, die sie hinterlässt. Anderenfalls läuft man Gefahr, beim Versuch sie dingfest zu machen, ihre Botschaft zu verfehlen. Die Suche nach einem bösen Kern, der begründen könnte, dass unschuldige Zivilisten ermordet, die Bewohner ganzer Regionen terrorisiert und am anderen Ende der Welt junge Soldaten und Soldatinnen per Bildschirm traumatisiert werden, zielt ins Leere.
Die Drohne entpuppt sich, wenn man ihr nahe kommt, als Schnittpunkt vieler sich unendlich über den Erdball und in der Zeit ausbreitender Strippen. Die Drohne bleibt leer, beziehungsweise ihr Inneres verweist immer wieder nach außen, auf das System, das Netzwerk, in das sie eingebunden ist. Wenn sie mittels elektromagnetischer Wellen das Relief abtastet, das sie überfliegt, reagiert sie darauf nicht selbstständig, sondern sendet die Daten nach Ramstein oder ein anderes „Distributed Ground System“(DGS). Die Analysten des DGS sind per Chat mit den eigentlichen Drohnenpiloten, die sich wiederum an einem ganz anderen Ort befinden, verbunden. Innerhalb von 24 Stunden interagiert eine einzige Drohne mit ca. 55 Menschen – agieren um die Drohne herum – durch sie hindurch 55 Menschen miteinander – wird sie von 55 Menschen bedient oder dient sie 55 Menschen, rettet oder vernichtet sie 55 Menschen.
Setup
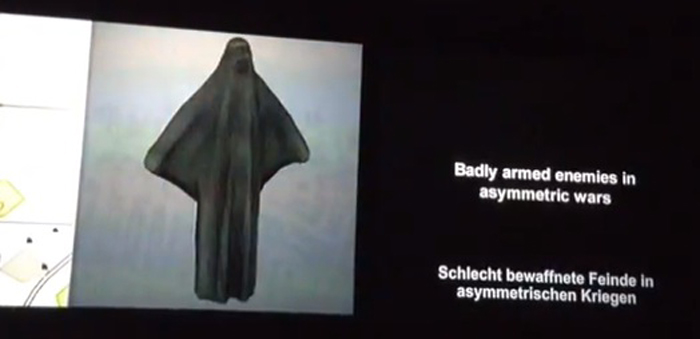
Asymmetrie
In der Drohne verknoten sich Macht- und Ohnmachtsverhältnisse. Ihre Analyse wird dadurch erschwert, dass sich um den Drohnenkrieg ein seltsam legalistischer Diskurs unter Rechtsexperten entwickelt, in den man leicht abrutschen kann. Man beruhigt sich damit, die Gesetze wären dazu da uns darüber aufzuklären, wen und unter welchen Umständen zu töten, richtig oder falsch ist. Als würden sich die Gesetze und vor allem ihre gängigen Interpretationen nicht den jeweils herrschenden Machtverhältnissen anpassen. Und als würde die Verurteilung des einen oder anderen der 55 Menschen die allgegenwärtige Verstrickung in die Schuldfrage auflösen. Als wäre das Problem der Legitimation des Tötungsapparats mit dem Rechtsapparat zu lösen.
So schnell lässt sich aber die Verwirrung nicht abschütteln, die Drohnenangriffe auf Wasiristan genauso hervorrufen, wie der Einsatz von Drohnen zur Überwachung der Schweizer Grenze oder der Zustellung von Amazonpaketen. Die Drohne weist eben über diese 55 angeschlossenen Menschen und sogar über die schwankende Zahl der Todesopfer, an deren Produktion sie beteiligt ist, hinaus. Sie lässt eine Ungerechtigkeit aufblitzen, die sich wie die Drohne selbst, der Reichweite des bürgerlichen Rechts entzieht. Gleichwohl ist sie dem Rechtsprinzip nachgebildet, weil auch sie Teil des Mechanismus ist, der die Ungerechtigkeit der globalen Ordnung in Einzeltäterbiografien bannt und aus der Karte streicht. Dabei müsste sie von oben doch sehen können, in welchem fatalen Verhältnis die Dinge zueinander stehen.
Player 1
Auch, wenn die Technologien, die im Krieg eingesetzt werden (ähnlich denen, die in der Finanzwelt ihr Unwesen treiben), eine scheinbar neue gespenstische Dimension erreicht haben, behält die Analyse, die Walter Benjamin vor fast achtzig Jahren im Nachwort zum Kunstwerkaufsatz gegeben hat, ihre Gültigkeit: „Der Krieg, und nur der Krieg, macht es möglich, Massenbewegungen größten Maßstabs unter Wahrung der überkommenen Eigentumsverhältnisse ein Ziel zu geben. So formuliert sich der Tatbestand von der Politik her. Von der Technik her formuliert er sich folgendermaßen: Nur der Krieg macht es möglich, die sämtlichen technischen Mittel der Gegenwart unter Wahrung der Eigentumsverhältnisse zu mobilisieren.“³
Der Krieg ist es also, der sowohl die Menschen als auch die Maschinen von der dringenden Aufgabe und der offensichtlichen Möglichkeit ablenkt, sich gemeinsam zu einer gerechteren Welt zu formieren. Der Einzelne arbeitet an dieser Ablenkung fleißig mit. Sie verhindert, dass man sich mit der eigenen Ohnmacht konfrontieren muss, indem man sich mit der vermeintlichen Übermacht der Kriegsherren identifiziert. Man glaubt, nur weil man die Unterwerfungsapparaturen sachgerecht bedienen darf, sie auch zu steuern. Der Mythos von der Besonderheit des Krieges verliert seine Glaubwürdigkeit, wo dessen Aufgabe, eine ganz konkrete Macht als Verfügungsmacht über Produktionsmittel zu erhalten, offensichtlich wird. Der Krieg zieht seine Bahnen auch durch den Alltag, er durchwirkt den Securitydienst im Supermarkt, die Softwarelizenzen und Hardwarepatente, die Jobs ohne Arbeitsverträge, Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung. Wenn man dem unfassbar verschlüsselten und zerhackten Weg folgt, den der Tötungsimpuls im Drohnenkrieg zurücklegen muss, bevor er befriedigt wird, bekommt das Bild einer archaische Triebkraft der ewig blutrünstigen Menschheit weitere Risse. Im einen reicheren Erdteil befinden sich Computerspezialisten, die mit viel Fingerspitzengefühl Mikrobefehle per Joystick ausführen und deren Konsequenzen am Bildschirm als Bewegungen abstrahierter Punkte verfolgen, während am anderen ärmeren Ende der Welt eine Rakete vom Himmel fällt und einen Menschen vernichtet, der sich selbst bis zu diesem Moment nicht als Kriegsteilnehmer verstanden hat. Innerhalb des Konzepts der „signature strikes“ überwacht eine Drohne die Einwohner einer bestimmten Region. Wird in deren Verhalten Übereinstimmung mit terroristischen Verhaltensmustern festgestellt, erfolgt der Beschuss. Weder Opfer noch Täter beherrschen die Algorithmen, die sie als das eine oder andere qualifizieren. Hier ist neu variiert, was Hannah Arendt im Begriff der „Banalität des Bösen“ auf den Punkt zu bringen versucht: Die Verkettung scheinbar trivialer Handgriffe und Rechenoperation resultiert in Unmenschlichkeit – Vernichtung.
Player 2

Platzierung des Feindes
Der Drohnenpilot Brandon Bryant versucht seit 2012 in unzähligen Interviews der westlichen Öffentlichkeit die komplizierte Realität der Drohnenoperationen zu vermitteln4. Bei jedem Frage-Antwort-Spiel steht er erneut vor der Aufgabe, den visuellen Code, der seine direkte Erfahrung vom Überwachen und Töten bildete, in uns bekannte Bilder zu übersetzen (sich bewegende und dann verschwindende Pixelpunkte; Farbveränderungen, die Temperaturänderungen von Körpern anzeigen; „Augen“ in der Straßen, die ein Indikator für einen kürzlich eingebuddelten Sprengsatz sind).


Target Destroyed“ im C64 Spiel „Aircombat“; Zielerfassung Predator Drone
Mit den Augen der Drohne sehen, heißt den Krieg als Teil einer Maschine verstehen, die aus einer Reihe mechanisch und reflexartig ausgeführter Bewegungen besteht. Darin gleicht er sich dem Alltag an. Wie jedes Kriegsgerät exportiert die Drohne alltäglich gewordenen Terror oder den Terror des Alltags an entlegene Flecken der verwalteten Welt. In den Inneren Schaltzentralen scheint das ideologische Gedankengebäude der Kriegsschwärmerei überflüssig zu werden, weil man sich dort an das Gesetz der Maschine übergibt, 0 oder 1, Ziel identifiziert oder nicht, Ziel getroffen oder nicht. Die Cleverness im Punktesammeln, die als Konsument im Alltagsleben erlernt wird, findet hier nur ein weiteres Anwendungsfeld. Das Töten muss nicht mehr gerechtfertigt werden, weil es fast wie ein zufälliges Resultat am Ende einer komplexen Rechenoperation steht. Am Ende seiner Dienstzeit erhält Bryant ein score sheet, das seiner Einheit die Beteiligung an 1626 Tötungen bescheinigt.
Rigged Game
Als Drohne getarnt, mit dem Hintergrund verschwommen und mit neuartigen Sensoren ausgestattet, erhalten wir vom Schlachtfeld und dem Platz, den der einzelne darin besetzt, ein neues klareres Bild: Der Übergang vom Menschen zur Drohne ist fließend. Sie bilden zwei Elemente der einen Apparatur, die die Datenströme, die uns durchfließen, in regelmäßigen Abschnitten zu Signalen umwandelt und an das folgende Glied in der Kette weitergibt. Der ganze Komplex gleicht einem Glücksspiel, bei dem die einen mit ihrem Verschwinden in der Maschine bezahlen und die anderen mit dem Leben, bei dem aber vor allem am Ende immer der Automat des Kapitals gewinnt. „Unbemannt“ beschreibt nicht nur die Flugmaschine, sondern auch die in den Prozess ihrer Entwicklung, Steuerung und Wirkung verwickelten Menschen. Sie bildet unendliche Variationen, Wiederholung und Einübung von dem, was Adorno „Mimesis ans Tote“ nennt: Der Versuch der Ohnmacht gegenüber der alles umfassenden Maschinerie zu entgehen, indem man sich ihr angleicht, seine Menschlichkeit abstreift und so vermeintlich an ihrer Macht teil hat. Der bedrohliche fremde Mensch wird durch die Klassifizierung nach Verhaltensmustern rationalisiert und gebändigt, um den Preis, das man sich selbst in den Rationalisierungsapparat einbettet.
Alles verspielt!

Lan-party oder Kampfeinsatz
Es geschieht etwas zusätzlich Bedenkenswertes im seltsam routinierten Bedienen des Joysticks: Die total verwaltete und die total verspielte Gesellschaft gehen ineinander über. Interessanterweise passt sich die Strategie der Rekrutierung neuer Soldaten der Tendenz zunehmender Verspieltheit der Kriegsführung an. Spiel insofern, als dass man sich an Regeln übergibt, deren Befolgung Genuss verschafft, weil es einem erlaubt zu verschwinden. Der „Joystick“ benennt das Versprechen des Knüppels der Disziplinierung am Ende doch noch Genuss bereitzuhalten. Spieler, die durch Computerspiele, die teilweise von den Rüstungskonzernen selbst hergestellt werden, schon als Kinder auf ihr späteres Soldatendasein vorbereitet wurden, bilden den Pool, aus dem Drohnenpiloten rekrutiert werden sollen. Aus beiden Richtungen scheinen sich Unterhaltungsindustrie und Kriegsindustrie einander anzunähern, um schließlich den nahtlosen Übergang von einem Bildschirm zum anderen zu ermöglichen. Die Einübung genormter reflexartiger Reaktionen taktet den Menschen bruchlos ein, in gleich zwei wichtige Komponenten der großen alles umschließenden und durchrationalisierenden kapitalistischen Maschinerie. Harun Farocki erzählt von diesem seltsamen Ineinanderfließen virtueller und realer Welten in seinen Videoinstallationen „Ernste Spiele“. „Serious Games“5 simulieren Kriegsschauplätze, um den Einsatz entweder im Sinne einer militärischen Ausbildung vor- oder im Sinne einer psychotherapeutischen Behandlung des traumatisierten Soldaten nachzubereiten. Irgendwie erreicht man grade durch die Ausbeutung des menschlichen Bedürfnisses nach Steuerung und Selbstermächtigung, die umso lückenlosere Steuerbarkeit des Menschen.
Schuldeneintreiber

Freie Wahlen
Was können wir aus dieser angebrochenen Flugstunde lernen? Die Drohne ist nichts weiter als unser Spiegelbild. Das, was wir für den Himmel gehalten haben, ist nur die buntgestrichene Decke einer riesigen Fabrikhalle, aus der Fabrikhalle kommt man nicht raus, solange man nur stumpfsinnig seinen Teil am falschen Produktionsprozess mittut und für Bedürfnisbefriedigung hält, was innerhalb der Fabrik eigentlich nur die endlose Verlängerung einer sinnlosen Arbeit ist. Die Ohnmacht reproduziert sich unendlich, grade in den Akten, in denen man meint, ihr entgehen zu können. Chirurgische Präzision und unersättliche Kartografie müssen sich so lange auf sie richten, bis sie ihre Macht verliert.
Die einzig sinnvolle Arbeit – die gegenwärtigen Verhältnisse zu überwachen, in sie einzudringen, sie aufzuklären und anzugreifen – hat nur Hoffnung, wo sie den Weg über die Widersprüchlichkeiten des falschen Apparats geht, jedes Stolpern protokolliert und in der Karte verzeichnet, auf der sich später vielleicht mal ein Ausweg abzeichnen könnte. Der Befehl, den Ernst Bloch von Marx, dem ersten Protokollanten der Maschine-gewordenen Gesellschaft übernimmt und an uns weiterreicht, lautet: „Das vorhandene Elend wird nicht bejammert und dabei belassen, sondern es erscheint, wenn es sich seiner und seiner Ursachen bewusst wird, als revolutionäre Macht, sich ursächlich aufzuheben.“6
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
¹Abkürzung für „Embedded Journalist“
²http://www.taz.de/Kolumne-Macht/!135325/
³http://www.textlog.de/benjamin-kunstwerk-aesthetik-krieges-nachwort.html
4http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-90048993.html
5http://www.youtube.com/watch?v=XngMr4uHAj0 und http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/hamburger-bahnhof/ausstellungen/ausstellung-detail/harun-farocki-ernste-spiele.html
6Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/Main 1959, 2. Bd., S. 723.
Also in Basel war ich unterwegs. Interview geben für Rundfunk, Zeitung. Dann Fotoshooting und Videoaufnahmen und Gespräch. Lesung inner Psychohotelanlage, wo sich Patienten und Betreuer mit Hotelpersonal mischen. Ich beim Frühstück am Morgen bei einer Dame am Sechsertisch: Ist hier ein Platz frei? Sie: Welche Gruppe sind Sie denn. Ich: Wie viele gibt es denn hier? Sie: Drei. Ich: Dann bin ich die zwei. Sie: Aber das ist ja gut. Das trifft sich, nämlich bei eins müssten sie da drüben sitzen. Tja, und so bin ich im Gespräch mit der Dame. Sehr bunt angezogen. Sagen wir Buschrose mit hellbraunen, durchsichtigen Kastanienblättern. Alles tief blutig am Stoff und gleichzeitig edel. Eben die Nummer Zwei. Also schön in Gruppe zwei dabei. Sie redet, was ich nicht verstehe, aber mit der Gruppe Zwei zu tun hat. Ich antworte brav auf ihre Fragen: Ja, das meine ich auch, obwohl ich nicht weiß, was mit den Depressiven und dem Ausflug, von dem sie redet, nun ist? Woher sie ihre Methodik nimmt? Oder waren es Tischtennisschläger? Aber das Bad ist gut. Sie mag den Salzgehalt. Sie schlabbert vom Salzwasser im Pool. Aber keinem weitersagen. Na, denke ich, Depressive schlabbern doch nicht oder etwa doch? Wir sollen stark sein, sagt sie. Das wird schon, sage ich. Und wie ich gerade zustimme, was das Starksein betrifft, kommt eine Pflegerin und spricht die Dame-in-bunt, die depressiv nicht länger sein will, an: Das ist unser Autor. Der hat doch gestern gelesen. Der ist nicht von Gruppe Zwei. Und ich schäme mich aber dann sofort ob meiner Lüge, die nun verraten und enttarnt worden ist. Die Dame-in-bunt stört das nun wirklich nicht. Sie drückt mir die Hand und sagt: Tschuldigung. Ich habe Sie nicht gleich erkannt. Wir treffen uns nachher dann in Gruppe Zwei. Nun essen Sie erst einmal was und dann sehen wir weiter so. Und dieses: Weiter so - das nahm ich dann wörtlich. Und weiß zudem nun: Bunte Kleidung hilft gegen Depression. Ja, dann habe ich meine Schwägerin S. besucht. Ja so sieht es aus. Der Wawerzinekpeter hat Verwandtschaft, die in der Schweiz nicht wohnt, sondern arbeitet. Englisches Seminar und so. „Bring mir mal nen Shakespeare und Williams Birne als Schnäperle dazu, Kellner! Wir sind von Basel aus dann nach Lörrach. Wo die Schweiz eben gegen Honduras die machbare Aufgabe übernimmt, zu siegen. Das war toll. Toller aber, dass ich gefragt werde von der Schwägerin: Wo ist denn der Hitzfeld her? Doch nicht etwa aus der Schweiz? Ich: Der ist von hier. Der ist aus Lörrach. (Das sollte nen Witz sein, ein richtiger Joke fürs Englische Seminar in ihrer Person, versteht sich.) Und dann ist der wirklich in Lörrach (Lörr? ach?) gebürtig. Und ich – Kinder nein – ich habe mit meinem albernen Kommentar genau ins Zentrum der Herkunft von Trainern (Tränern?) getroffen. Wir lachen uns herzlich aus und an. Denn die S. glaubt mir, dass ich es auch nicht schon vorher wusste, eben so aus Spaß an Gag nur geraten habe. Es gibt also immer noch keinen Zufall, streng genommen, existiert er nicht. Und nun lese ich eben die Vorankündigung zum Juliheft Rolling Stone, dass der Artikel kommt, in dem ich meinen alten Schulfreund „Kutzing von früher“ beschreibe. Was wir mit Frank Zappa am Triangel-Hut haben. Lesenswert, weil alles in dem Text von mir geschrieben worden ist. Das Ihr es nur wisst, sozusagen informiert seit, wen da einer von euch diesen Text je lesen sollte. Dann schreibt es mir, schreibt dem Wawerzi-Pedder vonner Ostseeküst. In diesem Sinne!
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Anpfiff zur WM, hurra. Ohne Marco Reus, Schockschwerenot. Doch der Reihe nach. Eine bleibende Erkenntnis aus der Testspielphase: Brasilien ist heute das einzige Land, in dem eine Pädagogenauswahl die Fußballnationalmannschaft besiegen kann. Von allen bisher aufgetretenen Protestformen gegen die Copa das Copas die faszinierendste – die zweihundert Lehrer, die Ende Mai bei Rio de Janeiro den Bus der Seleção zum Halten zwangen und mit ihren Parolen beklebten, sich von der Polizei nicht abdrängen ließen. Wohl dem Land, das solche Lehrer hat; man stelle sich daneben nur kurz den in altbackenem Dünkel gegen den Fußball stänkernden deutschen Studienrat vor. Und wehe dem Land, das die WM der FIFA ausrichten muss.
Über das große Turnier kann die ganze Welt jubeln, bloß die Gastgeber nicht. Für die Dauer des Sportfests tritt ein Staat weite Teile seiner Souveränität an ein Monster ab, wofür das Monster ihn Unsummen zahlen lässt. Es schneidet die Sause dann exklusiv auf eine globalisierte Kaste der Wohlhabenden zu. Nur die können sich die Tickets für die nach strengen Vorgaben entseelten Stadien leisten, und nur denen wird nicht übel von der vereinheitlichten Sponsorengastronomie. Ist der neue Weltmeister schließlich ermittelt und das Monster wieder nach Zürich abgezogen, hinterbleibt eine zerstörte Fußballkultur. In der Zeitrechnung des brasilianischen Jogo Bonito wird immer zwischen „vor 2014“ und „seit 2014“ unterschieden werden. Übrigens: Wer sich zum Fluchen auf die FIFA eine solide Grundlage verschaffen will, dem sei zum Einstieg Klaus Zeyringers hervorragender und kompakter Artikel im Online-Magazin des S.-Fischer-Verlags empfohlen –
http://www.hundertvierzehn.de/artikel/wem-gehört-das-maracanã_396.html
Jeder Aspekt der brasilianischen Wut wirft sein Schlaglicht auf eine empörende ideologische Fehlkonstruktion. Dabei spielen sich WM und Protest vor einem schmerzhaft absurden Hintergrund ab. Während der Weltverband sich in korrupter Selbstherrlichkeit übertrifft (und man hoffen kann, dass ihm mit den Protesten in Brasilien sein Geschäftsmodell endlich um die Ohren fliegt), ist der Fußball, den man sich von diesem Turnier versprechen darf, so attraktiv wie nie. Es könnte ein goldener Moment sein. So viel Bewegung in den Spielsystemen, so viele Chancen nicht nur auf schillernde Platzhirsche, sondern auf begeisternde Teams, mehr denn je von dem, was nicht nur der legendäre Bolzästhetiker und Freund großer Worte César Luis Menotti den „schönen Fußball“ nennt. Möge das Paradox sich auf der nächsten Ebene erfüllen: Möge die zügige Entmachtung der FIFA einhergehen mit der spielerisch prächtigsten WM, die wir je erlebt haben!
Und was wird derweil aus Schland? Dass der Schwarzrotgoldrausch, zum „Sommermärchen“ 2006 ausgebrochen und seither in der Entwicklung zum festen nationalen Ritual bei WM und EM, auch heuer nicht nachlässt, garantieren Industrie und Handel. Man kann ja dieser Tage kaum eine Tüte Milch oder eine Tube Zahncreme, geschweige denn eine Zeitschrift kaufen, ohne dann plötzlich einen deutschen Wimpel in der Hand zu halten. Im Nutelladeckel nistet ein schwarzrotgoldenes Schminkset (und hat die braune Masse unter sich), man kann sich das Hoheitszeichen als Flutschfinger-Eis oder in Form von drei Marzipanklötzchen einverleiben, und man kann aus solchen Trouvaillen eine routiniert verkniffene Facebook-Gemeinschaft aufbauen. „Schland-Watch“ nennt sich diese und ist symptomatisch in ihrem Umgang mit Symptomen. Sie versammelt und kommentiert Auswüchse des Flaggenkults mit der bewährten Wellness-Attitüde des „Wussten wir’s doch“, die dir jedes genauere Hinsehen erspart. Ach ja, Schland-Watch: Die drei genannten Beispiele kannst du gerne übernehmen, bisher fehlen sie auf deiner Seite noch.
Linkes Linken-Bashing war vor 30 Jahren ein wichtiger Korrektivmechanismus. Heute gibt es nur wenig Drögeres. Aber manchmal bleibt einem keine andere Wahl. Solange sich die Auseinandersetzung mit den Flaggen zur Fanmeilensaison darin erschöpft, dass man sich in einem geschlossenen Weltbild bestätigt, endet die kritische Analyse an dessen Wänden. Wo die deutschen Farben wimmeln, sammelt der Blut-und-Boden-Nationalismus neue Kräfte – basta. Alle Migranten, die bei der Schwarzrotgoldparty mitmachen, sind verirrt oder verblendet – Punkt. Jeder Troll, der den Schlandwatchers dumpfdeutsche Kommentare an die Pinnwand stümpert, zeigt das wahre Gesicht dieses Landes – Amen.
Dabei könnte dies ein goldener Moment sein. Man könnte all die peinlichen, lächerlichen oder gefährlichen Manifestationen des Schland-Kommerzes auch sammeln, ohne sich vorab in die These von einem Land auf dem Schleichweg in den Faschismus einzumauern. Man könnte auch auf dieser Ebene das Spiel eröffnen. Und man könnte es, ohne dass dabei der Aufwand an utopisch-dialektischer Denkbewegung unzumutbar würde, bis auf Weiteres zumindest für möglich, für eine Chance halten, dass sich in den Flaggen zur WM nicht nur Altbekanntes und zu Recht Verhasstes ausdrückt. Sondern dass mit diesem Ritual vielleicht auch ein neues, eben nicht mehr dem aggressiven Hirngespinst von Blut und Boden zwangsverpflichtetes „Deutschland“-Gefühl eingeübt wird.
Das mag eine zerbrechliche Hoffnung sein und eine nicht ganz einfache Perspektive. Aber sie ermöglicht etwas, das der Name der Facebook-Gemeinschaft verspricht, jedoch nicht einlöst: eine genaue Schland-Beobachtung. Wachsam statt alarmistisch. Und was lehrt uns der Fußball? Auf die Chancenverwertung kommt es an.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Wer Theater an den Mann bringen will, kommt ohne einen Ansatz krimineller Energie nicht aus. Der Dramaturg ist der Gebrauchtwagenhändler zwischen Literatur und Theater, zwischen Publikum, Regie und Schauspielern. Daß er im Dreieck springt sollte niemanden wundern, und daß die Evolution seit Lessing ihn zum Zentauren ausgeformt hat, macht ihm, dem Dramaturgen, alle Ehre. Daß er in Hamburg, der Keimzelle seines Zwitterwesens, als Polizist, der den sittenwidrigen Verkehr der von Brecht domestizierten SCHWESTERKÜNSTE miteinander regelt, angesehen wird, soll seinem Ruf nicht schaden: er ist und bleibt zentaurisch in der überwucherten Landschaft der Kunst, in der er nach Texten jagt, Ideen unterm Fallobst sammelt. Der Dramaturg ist unnachahmlich, kein Schauspieler kann ihn darstellen, sei denn, er ist zu zweit. Mag sein Rückzugsort auch das Theater sein, sein weites Feld gehört der Vergangenheit an, der Ovid so viele Namen und Gestalten gab. Einer von ihnen ist NESSUS, der sein Publikum auf seinem Pferderücken über den Strom des Vergessens ins Theater trägt. Daß er ab und an aus Liebe einen Zuschauer entführt, wird ihm großzügig nachgesehen, und weil er Herkules auf dem Gewissen hat, steht er unter Artenschutz. Sein (griechischer) Worthintergrund ist weniger poetisch: Dramaturg ist eine Zweileibkonstruktion aus Drama und aus Arbeit, ein Bühnenarbeiter. Daß er als solcher wenig körperlichen Einsatz findet, hat sein Überleben bis in alle Gegenwart gesichert.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
-1-
Die digitale Öffentlichkeit ist enttäuscht. Es liegt nicht so sehr daran, dass wir von Google und Konsorten ohne unser Wissen ausgewertet, verwertet und weiterverkauft werden, das wäre noch zu verkraften. Auch dass demokratische Staaten uns alle auf eine Weise ausspionieren, wie es keine totalitäre Diktatur jemals getan hat, ist zwar schwer zu schlucken, lässt sich jedoch noch irgendwie wegerklären. Die eigentliche Schmach ist in etwas anderem begründet. Nämlich in der unterschwelligen Feststellung, all unsere Gedanken und Handlungen können deswegen überwacht und manipuliert werden, weil sie komplett berechenbar seien. Das Determinismus-Team hat über die Mannschaft des freien Willens durch ein technisches KO gesiegt. Individuelle Autonomie war bloß ein Mangel an Algorithmen. Nun sind sie da, die Algorithmen, sie werden immer besser, und alleweil flüstern uns ihre Analytiker zu: „Du bist nichts anderes als ein Nullkommaetwas, eine statistische Schnittmenge, ein durchschaubarer Datenhaufen. Du hast das Privileg, in einer freiheitlichen Ordnung zu leben, weil auf dem Schachbrett der Angebote und Präferenzen all deine Züge vorherbestimmt sind. Du hast die freie Wahl und was du wählen wirst, ist uns schon bekannt.“ Von dieser narzisstischen Kränkung wird sich die liberale Subjektivität schwer erholen können. Ach, wie frei wähnte sich der postmoderne Hedonist! Von allen Traditionen und äußeren Einflüssen losgelöst! Durch die Vielfalt der Singularitäten schweifend! Seine temporären Identitäten nach Gusto wechselnd! War es nicht ein guter deal, seine veraltete Seele gegen einen Teller Conchitawürstchen eingetäuscht zu haben? Wieso hätte sich der user ernsthaft gegen eine Macht aufgelehnt, die ihm gegenüber so großzügig war? Ihm wurde alles geschenkt, Bilder und soziale Kontakte, Unterhaltung und Wissen, Community und Personalisierung, alles für lau. Zu spät erfuhr er, dass er doch einen faustischen Pakt eingegangen war: Was er dafür ausgeben sollte, war die Verfügung über sich selbst.
-2-
Die Wege des Menschen sind ergründlich. Die Erkenntnis ist nicht neu. Ein klassisches Beispiel davon ist jener Stadtplan von Paris, der 1952 von dem Soziologen Paul-Henry Chombart de Lauwe veröffentlich wurde. Darauf hatte er sämtliche Wege verzeichnet, die eine seiner Studentinnen innerhalb eines Jahres durchlief. So zeigte er, wie furchtbar gering die Mobilität der Probandin war: Von seltenen Abstechern abgesehen reduzierte sie sich auf wenige, dafür intensiv benutzte Strecken, alle in einem Dreieck zwischen Wohnung, Schule und Klavierunterricht eingegrenzt. Damit wollte Chombart de Lauwe verdeutlichen, wie eng der urbane Raum ist, in dem jedes Individuum tatsächlich lebt. Wir erfahren nur einen armseligen Bruchteil des Stadtplans. Und nicht nur waren die Wege der Pariserin äußerst begrenzt, auch war deren zeitliche Abfolge derart regelmäßig, dass es ein Kindesspiel gewesen wäre, vorauszusagen, wann, wie und wohin die junge Frau sich am kommenden Tag begeben würde. Das ist lange her, zu einer Zeit, als Autos und Flugzeuge Luxus waren, als die Menschen an ihr Stadtviertel oder Dorf gebunden waren, einen festen Arbeitsplatz hatten und höchstens einmal im Jahr in den (nicht sehr entfernten) Urlaub fuhren. Sechzig Jahre später erforschte das Team des Physikprofessors Albert Lászlo Barabási die Wege, Gänge und Fahrten der heutigen Zeitgenossen. Allein das gewählte Verfahren zeigt, wie sehr sich die Zeiten gewandelt haben. Wo sich der Stadtsoziologe vorsintflutlich mit einer Einzelprobandin begnügen musste, die die eigenen Wege peinlich notierte, trägt jetzt jedermann einen Bewegungsmelder, der ihn permanent verortbar macht. So konnte die Zirkulation hunderttausend anonymer und per Zufallsprinzip ausgewählter Mobilfunknutzer verfolgt werden. Doch nicht nur hat sich die Technik gewandelt; in Zeiten allgemeiner Mobilität sind die Einzelstrecken der Menschen viel differenzierter. Zwar finden sich noch viele, deren Bewegungsradius nicht größer ist, als der der Pariser Studentin von damals. Die gewöhnlichen Wege eines Hartz-IV-Empfängers dürften selten über Jobcenter, Aldi und die Imbissbude hinaus führen. Gleichzeitig aber strömen in Flughäfen Easyjet-Touristen und Business-Class-Angestellte, hoppen Projektmacher von einer Stadt zur anderen, rennen Freizeitbeschäftigte in allen Ecken, um das Angebot der Konsum- und Unterhaltungstempel wahrzunehmen. Auf den ersten Blick herrscht also ein undurchschaubares Chaos. Und doch zeigt die besagte Untersuchung: Ganz gleich, ob die Menschen sich kaum von ihrem Viertel entfernen oder ob sie zweimal pro Woche interkontinental fliegen, ganz gleich, ob sie alt oder jung, männlich oder weiblich, arm oder wohlhabend, Land- oder Stadtbewohner sind, auf alle Fälle können ihre Bewegungen vorhergesagt werden und zwar mit einer Trefferquote von 93%. Die gespeicherte Spur ihrer Funksignale weist auf einfache Muster, die sich erwartbar reproduzieren werden. Das ist nicht weiter erstaunlich, möchte man meinen: Nach wie vor ist das Leben von Arbeit und Konsum bedingt, die Leine ist bloß länger geworden. Aber der Professor Barabási kennt keine sozial bedingten Zwänge. Da er die aktuellen Verhältnisse für unabänderlich hält, zögert er nicht zu sagen, dass „das menschliche Verhalten zu 93% prognostizierbar“ sei. Die Behauptung ist schon deshalb übertrieben, weil sich das Verhalten eines Menschen nicht aus seinen Bewegungen entnehmen lässt. Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit prognostizieren, dass am kommenden Freitag 1,5 Milliarden Moslems in der Moschee beten werden. Doch was sagt mir das über ihr Verhalten? Es bestätigt bloß, dass sie Moslems sind. Ebenfalls bin ich mir dessen absolut gewiss, dass morgen früh um acht Abermillionen ins Büro gehen werden, und das bestätigt nur, dass sie Lohnsklaven sind. Wird ihr Alltag unterbrochen, sei es von einem Generalstreik oder einer Naturkatastrophe, dann werden ihre gestrigen Wege keinen Aufschluss über ihr momentanes Verhalten geben können. Letztendlich laufen solche Untersuchungen auf die Tautologie hinaus: Routine ist voraussehbar.
-3-
Über das Leben der Bewohner des südfranzösischen Dorfes Montaillou um das Jahr 1325 sind wir genauestens informiert. Ihr Klatsch und Tratsch sind in detaillierten Zeugnissen festgehalten worden. Wir kennen die öffentlichen Faseleien jedes Schäfers, die intimsten Wünsche jeder Bauernbraut. Wir wissen, wer es mit wem trieb. Nicht Facebook sind diese Informationen zu verdanken, sondern der heiligen Inquisition, die im Dorf einen langen Ketzerprozess führte und protokollierte. Zu Unrecht wird heute die Inquisition allein mit Folter und Scheiterhaufen assoziiert. Eigentlich wurden diese Mittel nur im äußersten Fall angewendet - also nicht häufiger als heute die von der CIA praktizierten Foltermethoden und gezielten Tötungen. Im Grunde war die Inquisition eine Suchmaschine. Inquirere heisst ja: untersuchen. Wer nichts zu verbergen hatte, der hatte auch nichts zu fürchten. Die Inquisitoren wollten einfach wissen, wie die Menschen tickten und wieso sie zur Sünde neigten. Sie waren im Dienst des Guten, wollten die gottgewollte Ordnung vor schädlichen Häresien schützten. Dabei war das Verfahren sehr modern und rational. Unzählige Zeugenaussagen wurden peinlich genau gesammelt, ehe über den guten oder schlechten Leumund einer Person entschieden wurde. Die Inquisition hat Big Data erfunden. Was ihr noch fehlte, war die Erfindung des arabischen Mathematikers Muhammed al Chwarizmi. Sieben lange Jahrhunderte mussten vergehen, ehe die Algorithmen das inquisitorische Projekt vervollständigen konnten.
Denn ohne Algorithmus sind die Informationen, die von Suchkonzernen über uns gesammelt werden, wenig brauchbar. Sie enthalten keine brisanten Geheimnisse. Sie sind so banal wie ein weggeschmissener Einkaufszettel oder eine belanglose Bemerkung an einer Straßenecke. Doch aus diesem Datenmüll wird dank statistisch korrelierter Muster ein Phantombild hergestellt. Tatsächlich ist dieses modellierte Ich berechenbar, weil aus binären, marktgerechten Entscheidungen gemacht - jetzt kaufen oder später, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ob mein wirkliches Ich wiederum deterministisch agiert, hängt davon ab, inwiefern es sich mit seinem plumpen Doppelgänger identifiziert. Allerdings ist der Anpassungsdruck nicht zu unterschätzen. Nach wie vor hat die Inquisition eine einschüchternde Funktion, wie das Motto von Google deutlich macht -„Don't be evil“- durch die drohende Warnung des Firmenchefs Eric Schmidt ergänzt: "Wenn es etwas gibt, von dem Sie nicht wollen, dass es irgendjemand erfährt, sollten Sie es vielleicht ohnehin nicht tun.“
-4-
Eine algorithmisch geregelte Ordnung kennt keine Kausalität, sondern nur Korrelationen. Im Grunde bringt uns die komplexe Technik, die Amazon-Empfehlungen oder geheimdienstrelevante Profile generiert, auf den Stand der Bauernweisheiten zurück. Hocken die Hühner in den Ecken, kommt bald Frost und Winters Schrecken. Geht der Fisch nicht an die Angel, ist der Regen bald kein Mangel. Solche Sprüche sind Korrelationen. Sie sind das Ergebnis von empirischen Beobachtungen, die über Generationen wiederholt wurden. Ihre statistische Relevanz ist nicht zu unterschätzen. Sie können sich für praktische Zwecke als nützlich erweisen. Nur: Damit wird über Ursache und Logik eines Ereigniszusammenhangs nichts gesagt. Das Warum wird ausgelassen. Vor allem sind Korrelationen nur in einem stabilen System brauchbar (selbst Bauernregeln für das Wetter haben mit der Klimaveränderung an Zuverlässigkeit eingebüßt). Es ist also die Frage, ob unser Verhalten so stabil ist, wie von Steuerungsingenieuren angenommen. Die obskuren Motivationen, ambivalenten Begehren, irrationale Wendungen und zufälligen Bewusstseinssprünge, die einen Menschen von einem Automaten unterscheiden, werden bloß als noise aufgenommen, der beseitigt werden soll. Mit einem Wort, damit das System funktioniert, müssen nicht die Maschinen intelligenter, sondern die Menschen dümmer gemacht werden.
-5-
Symbolisch gesehen ist die digitale Membran, die jedes Individuum umhüllt und seinen Informationswechsel mit der Außenwelt regelt, eine mütterliche. Die Matrix ist ihrer Etymologie einer Gebärmutter getreu. Überwacht und gesteuert werden wir nicht von Big Brother, sondern von Big Mother. Sie sagt: „Ehe du hungrig wirst, werde ich dich stillen. Deine Wünsche kenne ich besser als du. Du brauchst nicht rechnen, ich rechne für dich. Du musst dich nicht orientieren, ich zeige dir den Weg. Du musst nichts fürchten, unter meinen Fittichen bist du in Sicherheit, für immer. Wie könntest du denn eines Tages so undankbar sein, mich verlassen zu wollen?“ Jeder weiss, wie viel schwieriger es ist, sich den weichen Empfehlungen der Mutter zu widersetzen als den harten Befehlen des Vaters. Da spielen emotionale Erpressung, Lockangebote und soft power mit. Dabei geht es nicht um eine Alternative, sondern um die Arbeitsteilung zwischen zwei symbolischen Instanzen, Vaterstaat und Muttermarkt, so wie in jedem Polizeirevier zwischen good cop und bad cop. Mit jeder neuen app und jeder neuen Funktion vollzieht sich die Rückkehr in den sicheren und ereignislosen Mutterschoß. Dazu passt die infantile Grammatik, die Facebook seinen Nutzern auferlegt. „Was machst du gerade? Willst du mein Freund sein? Ich möchte ein Bild mit dir teilen. Gefällt mir.“ Schuld an diese Infantilisierung ist natürlich nicht die Technik an sich und noch weniger der Algorithmus. Bereits 1835 hatte Alexis de Tocqueville in Amerika die Ankunft einer neuen Machtform erblickt: „Unumschränkt, ins einzelne gehend, regelmäßig, vorsorglich und mild“, sie würde die Menschen „unwiderruflich im Zustand der Kindheit festhalten“ indem sie für ihr Vergnügen und ihre Sicherheit sorgen würde, bis der Betätigung des Willens nur noch ein schmaler Raum gelassen wird. Wer zu lange gemuttert wurde und es nicht schafft, sich zu trennen, bekommt ein Knall fürs Leben.
-6-
Relevant ist also nicht die Frage, ob wir determinierbar sind oder nicht. Das eigentliche Problem liegt viel eher darin, dass der staatlich-technisch-marktwirtschaftliche Komplex so handelt, also ob wir determinierbar seien. Das Verhalten von Laborratten ist voraussehbar und reproduzierbar, weil im Labor alle Bedingungen dafür erschaffen worden sind. Dem Zufall ist nichts überlassen. In dem Film „Einkaufswelten“ zeigt Harun Farocki, wie in einem Einkaufszentrum sämtliche Schritte und Blicke der Besucher berechnet und konditioniert werden (zumindest solange die Besucher sich wie Konsumenten verhalten, sobald sie den Laden plündern, funktioniert die ausgefeilte Technik nicht mehr). Ebenso entwickelt sich der virtuelle Raum als ausgedehnter Supermarkt. Da findest du immer, was du suchst, weil das, was du suchst, das ist, wovon du weißt, das es zu finden ist. Vor Zufällen bist du geschützt. Dich erwartet keine böse Überraschung, aber auch keine Gute. Alles ist bequem, schnell, durchoptimiert und langweilig. Es besteht kein Zweifel, dass an einer solchen Konfiguration emsig gearbeitet wird. Ob diese gelingen wird, hängt aber von der Massenakzeptanz ab. Letztendlich muss sich jeder mit der reduzierten Version seines Selbst anfreunden. Kein Algorithmus kann voraussehen, ob die rasante Mutation irgendwann auf Ablehnung und Demotivation treffen wird. Noch steht jedem offen, unberechenbar zu werden.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
77 Tage lang hat Marcus Steinweg seine philosophischen Gedankenstränge vor seinen Hörern über das New Yorker "Gramsci Monument" - einer Installation zwischen Baumhaus, Mahnmal und Sozialkantine in der Bronx - gelegt. Den auf Englisch notierten Entwurf zur siebzehnten der "77 lectures at the Gramsci monument" dokumentieren wir hier.
THE FIGHTER, THE ANIMAL, THE MONSTER, THE DANCER, THE KID, THE ARTIST, AND THE GHOST
A Philosophical Poem
By Marcus Steinweg
1. THE FIGHTER
The fighter has no past.
Like Antigone who first has to fight against her sister Ismene who represents the doxa, the current opinion of her time, the tradition, the fighter does not look back.
It looks forward.
It looks ahead.
The fighter is a headless subject of this blind dynamics towards the unknown, towards contingency.
It is the subject of constitutive blindness.
You have to be blind to be a fighter because everything you see is invisibility as such.
Everything you are in contact with belongs to the future.
Nothing you deal with belongs to your past.
As a fighter you experience the very limit of experience.
You are in touch with your fundamental weakness.
The fighter is another name for the human subject.
It is a subject without subjectivity.
A faceless subject of its ontological poverty.
A nameless subject of an abecedarian nudity.
To fight means to fight against reality.
Reality is not simply a matter of fact.
Its status as incommensurable reveals that it is expansive and distracted.
Toward what does reality open, to what does it expand, with respect to what does it distract itself?
How to think a world without transcendence and yet not substitute for it a phantasm of immanence that negates the possibility of thinking something new, negates freedom and decision, autonomy and the consistency of the subject?
How to back out of the alternative of finitude and infinity, reality and ideality, the possible and the impossible?
How to think an opening that opens toward something not-given — toward the nothing itself?
How to affirm this opening toward closure without depriving it of its characteristic openness?
How to think an opening that is not one?
2. THE ANIMAL
Imagine a sleeping animal.
A sleeping spider that suddenly acts.
Imagine your brother, your sister.
Their movements are incalculable but precise and unforgettable.
Imagine your mother, your father.
Like Arachne they are hanging above the abyss of your life.
Imagine yourself as creature of your past.
You will not recognize yourself.
Imagine a dream without exit.
The animal is the subject of this dream.
The animal opens up to the closure of its world.
True opening is opening toward closure, toward emptiness and absence.
It is a rupturing of the texture of options toward its implicit outside.
Toward the naked there is (il y a) or, as Wittgenstein puts it, toward the miracle of the “existence of the world”.
An opening not toward the world as it is, as a world of facts, but toward the miracle that it is.
3. THE HYPERBOREAN MONSTER
"We Hyperboreans" is how Nietzsche headed a fragment from his unpublished works dated November 1887.
A few months later he wrote The Anti-Christ.
We Hyperboreans, we who live in the "hyperborean zone", in inhospitability or uninhabitability itself, the exterior.
The "hyperborean zone that is far removed from the temperate zones".
We Hyperboreans, we immoderates who only exist in contact with the immeasurable, the unmeasurable or incommensurable.
We who would rather live "in the ice", says Nietzsche, we withdraw from the "fake peace" and the "cowardly compromise" of a certain "tolerance" and "largesse of the heart".
We resist the "happiness of weaklings" and the ethics of compassion which these "weak ones" demand (for themselves, for good reasons) rather than practising it themselves.
We Hyperboreans also means: we, the community of those who are without community, without we-community.
We solitary ones.
We singularities.
We who touch the limits of the logos that represents the principle of the western we-community.
We who have fallen out of the we-cosmos.
We who have separated from the universality of a transcendental community, from the habitable zone of transcendental we-subjectivity.
We homeless ones.
We arctic natures.
We monsters who are in contact with the limits of what is familiar, habitual and habitable.
We contact-subjects, we border-natures, we come up against this limit and accelerate beyond this limit.
We uncanny ones or, as Heidegger also says, we homeless ones.
We who are at home in being homeless in uncanny homelessness.
We over-confident ones, we exaggerated ones.
We are subjects of an always violent self-overcoming.
Subjects of self-overwinding, of self-over-stimulation and self-unbounding.
We who are who we are by betraying the idea of the we and our self through transgression.
We traitors, we non-identical ones without a secured origin or future.
The hyperborean monster is the hyperbolic subject of self-transgression and self-surpassing toward an absolute exterior that is uninhabitability itself, chaos, incommensurability as such.
It is the subject of a non-identity-building self-assertion.
Subject of failed anamnesis, of transcendental non-recognizability.
Subject without name, without memory, without teleological inscription.
Subject of transcendental facelessness — barbaric subject.
4. THE DANCER
The dancer is dancing without stable ground beneath it.
It is articulating its primordial contact to the abyss.
The abyss is the name for a fundamental lack of a fundament.
Dancing means to open up to this lack.
The dancer is floating in the space.
It is floating with the preciseness of its desire.
The dancer is an empty subject of emptiness: an originarily emptied-out cogito.
A subject that affirms itself as the subject of an empty sky, without divine substratum, without transcendent meaning.
A subject without subjectivity because it is the movement of this experience that remains incessant.
A subject without return to itself, beyond self-mediation and self-appropriation in/constituting a present.
An empty subject because it experiences emptiness as the absent ground and absent telos of its existence.
As the desert of a freedom that is so incommensurable that it cannot be experienced as such.
5. THE KID
The kid is constantly laughing.
Nothing is less serious for him than reality.
Think about the kid mentioned by Maurice Blanchot,
describing his “primary scene” (scène primitive) as the experience of a depopulated heaven.
An experience that confronts an infinity he sketches as empty infinity:
“I was a child, seven or eight years old,
I was in an isolated house, near the closed window,
I looked outside — and at once, nothing could be more sudden, it was as though the sky opened,
opened infinitely toward the infinite,
inviting me with this overwhelming moment of opening to acknowledge the infinite,
but the infinitely empty infinite.
The consequence was estranging.
The sudden and absolute emptiness of the sky, not visible, not dark
— emptiness of God: that was explicit, and therein it far exceeded the mere reference to the divine —
surprised the child with such delight, and such joy,
that for a moment he was full of tears,
and — I add, anxious for the truth —
I believe they were his last tears.”
It is the desert of this absenting of meaning, this empty sky, that Nietzsche and Heidegger call upon us to think as, respectively, a growing desert and a now fundamental abyss:
As the point of departure of any thinking that, instead of being religion or science,
remains oriented toward the intractability of its reality by accepting the encouragement of this intractability to a freedom that urges it beyond its certainties toward the domain of truth.
It is here that one of the oldest distinctions philosophy has proposed for its own definition situates itself:
The distinction between meaning and truth, which names the rift between certainties of fact and their incommensurability.
The kid is the joyful subject of this desert.
It represents ontological innocence as such.
In the game of the world, the subject grasps itself as the subject of innocence.
Heraclitus, Nietzsche and Deleuze associate this playing subject with the image of the child.
In the kid, all the necessities of the traditional logos, of reason as world reason are compressed.
Responsibility, beauty, love, freedom, justice and truth only exist as excessiveness, as a ruleless game of innocence, as excess.
6. THE ARTIST
The artist is a dancing animal.
Nobody is able to take him for serious.
The fundamental artistic claim is the claim of autonomy.
Art exists only in the here and now of this one world without an exit, the world of facts.
Art is not an escape from it; it formulates its claim to autonomy in the midst of the world of determinants in order, in an opening to heteronomy, to escape this world’s phantasmagoric mistaking of itself.
Just as there is freedom only under conditions of factual unfreedom, sovereign independence only under conditions of its absence, autonomy becomes a demand and necessity only in the field of factual heteronomy.
Art was never anything other than consent to the fragility of its times.
Art does not come from a stable situation.
It is the experience of the inconsistency of its reality.
Art exists only as the experience of the porosity of the system of facts.
Therefore, for it, there cannot be any alliance with facts, which does not mean that it disputes or misrecognizes their power.
But art does not exhaust itself in demonstrating this non-misrecognition through the analytical power that is also immanent within it.
As long as art does not surpass its knowledge, it is not art.
It would be nothing other than a self-reassurance for the subject within the web of its critically commentated situation.
Only an assertion of form that evades a narcissistic self-reassuring by articulating the transience of the certainty of facts succeeds in confronting the universal inconsistency that is the subject’s proper time and proper place.
7. THE GHOST
The ghost is a subject permanently assuring itself about its impermanence without a stable securing in a firm order of being that puts its trust in its structural or transcendental substantiality.
The ghost is a subject insofar as it extends itself to the dimension of infinity.
It is life related primordially to death.
It juts out into the space of infinity.
Because this is the case, it is a matter of giving the uncanny dimension which death is the status of something self-evident, of taking the non-evidence of death as evidence in order to affirm oneself as a finite subject, for it is this finiteness which lives and bears the infinity which death is.
It is not the human subject that is infinite, but death.
But this infinity only exists for a finite subject.
The ghost moves along a border that separates the sphere of life from the non-world of death — between language and silence, finitude and infinitude, knowledge and truth, life and death.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Die Wörter begannen, in Haut überzugehen, EINS ZWEI DREI, Schreiben für eine Welt, in der es keine Schrift mehr geben wird, keine Leser, wahrscheinlich keine Augen mehr, DIE GESCHICHTE DER EMPFINDLICHKEIT, das Palettenalphabet, PALETTE: Kneipe, Kellerkneipe, verschwunden zwischen den Zeiten, wie H.F., wie ein Stein, ABC ---- Fichte tut uns weh / schwul-schwul-schwul / in der Palette sitzt er auf seinem Stuhl / wer sich zuerst vom Tisch bewegt / hat sich zuerst ins Grab gelegt / Cool, cool, cool...
Eumel, Dergl, Lockenprinz. Dergeln ist die beste Jahreszeit. DIE PALETTE ist der UNGEHEURE RAUM. Es war einmal ein Mann, der trug seinen schön gebogenen, geschwungenen Hirtenstab vor sich her wie ein großes Fragezeichen. „Wann hattest du deine ersten sinnlichen Erfahrungen?“, „Hattest du eine glückliche Kindheit?“, „Glaubst du an Gott?“, „Hatte er einen schönen?“, WENN MAN STERBEN WÜRDE UND ES WÄRE SO ANGENEHM, dann hätte man auch kein Bewusstsein davon. Eine Bewusstlosigkeit, die einem bewusst wird, oder umgekehrt. Das Gefühl ist so angenehm, dass man nicht möchte, dass es wieder aufhört. „Was für ein Gefühl?“, „Wie Gerüche.“, „Verändern sich die Gerüche?“, „Wer hatte den Dicksten?“, „Dieter.“, „Magst du ihn von jedem Mann, mit dem du etwas machst, in den Mund nehmen?“, „Ja. Sonst würde ich ja nichts mit ihm machen.“, „Schluckst du runter?“, „Ja.“, „Die meisten Schwulen spucken aus.“, DIE WÖRTER BEGANNEN IN HAUT ÜBERZUGEHEN, in der Geschichte der Empfindlichkeit, in der PALETTE finden wir den UNGEHEUREN RAUM, den ungeheuren Traum, h.f., H.F.,
Namen wachsen aus dem Stein, DIE BLUME VON SAARON, REIMER RENNAISSANCEFÜRSTCHEN, SCHUDL, LODDL, die Zweimetertranse, der Fischgrätenmann, JÄCKI, JÄCKI, JÄCKI, eins-zwei-drei, Hubert Fichte, Hubert Selby, LAST EXIT TO, „Keine Metaphern!“, „Irmas Achselhöhle.“, „Anscheinend“, „Scheinbar“, „Es sprühten aus dem dunklen Kelch / Elektrisch schon die Funken“.
„Ich ficke eine Frau!“
„Vivaldi! Stephansplatz! Guglhupf!“
DIE WÖRTER BEGANNEN... „Die Toten kommen. Die Welt geht unter!“
Wenn ein Mann einem Mann die Kuppe des Zeigefingers an den Rand des Fingernagels legt, nur für eine Tausendstel Sekunde, brennt es für alle Zeiten unumkehrbar etwas in die Schalen des Hirns – wie Sonne in das Silber der Filme.
HOPPEHOPPE REITER / WENNA FÄLLT DANN SCHREITA
„... dass vielleicht jeder Chronist an der Palette scheitern muss. Eine Analyse der verschiedenen Schichten Wirklichkeit würde sich ins Uferlose verlieren.“
KÖNNTEST DU EIN BORDELL FÜHREN? Träumst du? DIE WÖRTER BEGANNEN IN HAUT ÜBERZUGEHEN. JÄCKI DACHTE: „Die Heiligen leben in der Sonne. / Die Sonne ist das ewige Feuer. / Die Vodun leben auf den Planeten.“
WHO THE FUCK ARE THE vodun. „Das Schlechte ist immer das Schlechte.“
Es sollte die Geschichte der Kräuter werden. / Die Bewegungen der Kräuter. / Und es wurden doch wieder nur die Bewegungen von Menschen...“
EIN SCHLEIER AUS GISCHT. Zehn Meter hoch. Schien es Jäcki. Die Sonne stieß hindurch. Die Wolkenkratzer wackelten.
DER UNGEHEURE RAUM. HOTEL GARNIE: es ist kein Hotel. Es ist eine Sage.
EXPLOSION. Suchen. Wir suchen. HAUT. FLEISCH. „Im Tanzlokal klappten sie schon die Stühle zusammen. / Ich fand ihn nicht. / Ich hätte die Nachtigallen einzeln erwürgen können. ER WEINTE. „Und verließ den Holunderbusch und tanzte Hambo.“
Wir tanzen. Wir tanzen H.F., Hubert Fichte Blues und Rap... MASKEN UND TOTE. SCHWARZER SCHNEE. „Eine Art Tagebuch – Ein Interview mit mir selbst.“
NUR KEINE KUNST. „Er weinte.“ „Ich war ein alter Mann – dreiundzwanzig.“
HUREN? Nein! Man schreit. „Die Haare werden teilweise abrasiert und man wird mit einer Desinfektionslösung eingeschmiert...“ INNENDRIN.
UNSER ALTAR. Da steht das Bild. Hinter uns. HUBERT FICHTE. Da sagen sie, dass das unser Lockenprinz sei. Da will keiner. EINS ZWEI DREI. „Das Schweigen der Ideen. / Ich krieg einen hoch, wenn ich Irmas Bauch fühle. / Es gibt keinen normalen Mann. / Das war, was da war, meinte Jäcki.“
FICHTE FICHTE, Jäcki geht über den Markt.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Geoökonomische und -politische Aspekte des Regime Changes in der Ukraine.
Prolog: „Von entscheidender Bedeutung war … die Ukraine. In der seit spätestens 1994 zunehmenden Tendenz der USA, den amerikanisch-ukrainischen Beziehungen höchste Priorität beizumessen und der Ukraine ihre neue nationale Freiheit bewahren zu helfen, erblickten viele in Moskau – sogar die sogenannten Westler – eine gegen das vitale russische Interesse gerichtete Politik, die Ukraine schließlich wieder in den Schoß der Gemeinschaft zurückzuholen. … Am wichtigsten allerdings ist die Ukraine. Da die EU und die NATO sich nach Osten ausdehnen, wird die Ukraine schließlich vor der Wahl stehen, ob sie Teil einer dieser Organisationen werden möchte. Es ist davon auszugehen, daß sie, um ihre Eigenständigkeit zu stärken, beiden beitreten möchte, wenn deren Einzugsbereich einmal an ihr Territorium grenzt und sie die für eine Mitgliedschaft notwendigen inneren Reformen durchgeführt hat. Obwohl dies Zeit brauchen wird, kann der Westen – während er seine Sicherheits- und Wirtschaftskontakte mit Kiew weiter ausbaut –, schon jetzt das Jahrzehnt zwischen 2005 und 2015 als Zeitrahmen für eine sukzessive Eingliederung ins Auge fassen. … Der springende Punkt ist, und das darf man nicht vergessen: Ohne die Ukraine kann Rußland nicht zu Europa gehören, wohingegen die Ukraine ohne Rußland durchaus Teil von Europa sein kann. … Tatsächlich könnte die Beziehung der Ukraine zu Europa der Wendepunkt für Rußland selbst sein.“
Bei dem Autor dieser höchst präzisen und zugleich eiskalten Analyse handelt es sich um keinen geringeren als Zbigniew Brzezinski, einen der bedeutendsten und einflußreichsten Berater und Akteure im außen- und sicherheitspolitischen Establishment der USA, der sich bis auf den heutigen Tag rühmt, als Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jimmy Carter die Sowjetunion 1979 in die, wie er es ausdrückt, „afghanische Falle“ gelockt zu haben – mit allen bekannten Folgen bis hin zu 9/11. Im Jahre 1997 publizierte er sein vielleicht wichtigstes Werk, das den Titel „The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives“ („Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft“) trägt, und aus dem die oben zitierten Zeilen stammen.
Wie präzise die Prognose des Geostrategen Brzezinski eingetroffen ist, zeigt der Umstand, daß im Frühjahr 2014 mit Arseniy Yatsenyuk ein „mafiöser Ladenschwengel des internationalen Finanzadels, Truppenführer eines ukrainischen Oligarchenclans und Handlanger Washingtons“ (Volker Bräutigam), also quasi eine Art „Karzai von Kiew“, als Ministerpräsident der Ukraine amtiert. Dieser war, wie die für Europa und Eurasien zuständige „Fuck-the-EU“-Abteilungsleiterin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, am 13. Dezember 2013 in Washington vor der „U.S.-Ukraine Foundation“ sich stolz gebrüstet hatte, mit rund fünf Milliarden US-Dollar, welche seitens der US-Regierung seit 1991 für eine „wohlhabende und demokratische Ukraine“ investiert worden wären, von Oligarchenclans im Bunde mit ukrainischen Neofaschisten sowie dem von NATO, EU und Deutschland aufgewiegelten, organisierten und finanzierten Straßenmob an die Macht geputscht worden. Übrigens gegen den von Deutschland massiv unterstützten Vitali Klitschko, den Nuland keinesfalls in der Regierung haben wollte, wie sie in einem abgehörten und danach ins Internet gestellten Telefonat mit dem US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, wortwörtlich klargestellt hatte. Die illustre Schar der hilfreichen Unterstützer des auf diese Weise installierten Statthalters Washingtons erschließt ein Blick auf die Homepage Yatsenyuks und seiner Stiftung, die den programmatischen Namen „Open Ukraine – Arseniy Yatsenyuk Foundation“ trägt, als dessen Kopf er fungiert. Die Partnerliste umfaßt unter anderem die „Victor Pinchuk Foundation“ des gleichnamigen Oligarchen, also Wirtschaftsverbrechers, dann den „German Marshall Fund of the United States“ (GMF) mit seiner Tochtergesellschaft „The Black Sea Trust for Regional Cooperation“ sowie das britische „Royal Institute of Foreign Affairs“, auch bekannt als „Chatham House“, in dessen Rahmen wiederum einzelne Schlüsselprojekte von der Rockefeller-Stiftung, der Bill&Melinda Gates Foundation, der Konrad Adenauer Stiftung, der NATO oder der EU finanziert und gesponsert werden. Mit von der Partie ist auch der einschlägig berüchtigte Großspekulant und Multimilliardär George Soros, als Schirmherr und Financier seiner „International Renaissance Foundation“, des weiteren das „NATO Information and Documentation Centre“, das in Kiew subversive Wühlarbeit geleistet hat sowie das landläufig als CIA-Frontorganisation bekannte „National Endowment for Democracy“. Als weitere Partner des Putsch-Premiers traten die Botschaft der Republik Polen in Kiew, der Hedgefonds „Horizon Capital“, eine klassische „Heuschrecke“, eine Kiewer Möbelfirma sowie die „Swedbank“ in Erscheinung.
Daß der in der Ukraine in Szene gesetzte Regime Change einer seit mehr als 120 Jahren etablierten außenpolitischen Praxis der USA entspricht, ergibt die Lektüre des von dem Pulitzerpreis-gekrönten US-Journalisten Stephen Kinzer verfaßten Buches „Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq“, auf Deutsch erschienen unter dem Titel „Putsch! Zur Geschichte des amerikanischen Imperialismus“. Das Paradigma des Regimewechsels beschreibt er so: „Die Vereinigten Staaten bedienen sich einer ganzen Reihe von Methoden, um sich andere Länder gefügig zu machen. In vielen Fällen greifen sie auf altehrwürdige diplomatische Taktiken zurück, indem sie Regierungen, die Amerika unterstützen, Belohnungen in Aussicht stellen, und denen, die das nicht tun, mit Vergeltung drohen. Manchmal verteidigen sie befreundete Regime gegen den Zorn oder Aufruhr des jeweiligen Volks. In einer Vielzahl von Fällen haben sie stillschweigend Staatsstreiche oder Revolutionen unterstützt, die von anderen angezettelt wurden. Zweimal, im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen, haben sie mitgeholfen Herrschaftssysteme zu stürzen und neue an die Macht zu bringen. … Das erwies sich als musterbildend für künftiges Verhalten. Durch das ganze 20. Jahrhundert und bis in den Anfang des 21. hinein haben die Vereinigten Staaten immer wieder die Macht ihrer Streitkräfte und ihrer Geheimdienste eingesetzt, um Regierungen zu stürzen, die den amerikanischen Interessen ihren Schutz verweigerten. Jedesmal bemäntelten sie ihre Einmischung mit dem schönfärberischen Hinweis auf Sicherheitsbedürfnisse der Nation und den Kampf für die Freiheit. In den meisten Fällen indes lagen ihren Aktionen hauptsächlich ökonomische Motive zugrunde – vor allem der Anspruch, amerikanische Geschäftsinteressen rund um die Welt zu untermauern, zu befördern und zu verteidigen und jede Störung von ihnen fernzuhalten.“ Zu diesem Zweck unterhält das US-amerikanische Imperium der Barbarei derzeit ein Netz von mehr als 800 Militärbasen, das sich um den gesamten Globus erstreckt und die Hardware für die ökonomische Kolonisierung des Planeten mit militärischen Gewaltmitteln, vulgo Globalisierung, bereitstellt.
Das extrem ausgeklügelte und zugleich äußerst perfide Funktionsprinzip dieser Kombination von Außenwirtschafts- und Militärgewaltpolitik beschreibt einer der Insider, der diesem System jahrelang zu Diensten war, nämlich der US-Amerikaner John C. Perkins in seinem Bericht „Bekenntnisse eines Economic Hit Man. Unterwegs im Dienste der Wirtschaftsmafia.“ Darin charakterisiert er den Wirkungsmechanismus, der dem US-imperialistischen Herrschaftsmodell zugrundeliegt, als ein Drei-Stufen-System aus „Wirtschaftskillern (EHM)“, „Geheimdienst-Schakalen“ und Militär: „Die Raffinesse, mit dem dieses moderne Reich aufgebaut wird, stellt die römischen Zenturionen, die spanischen Konquistadoren und die europäischen Kolonialmächte des 18. und 19. Jahrhunderts bei weitem in den Schatten. Wir EHM sind schlau, wir haben aus der Geschichte gelernt. Wir tragen keine Schwerter mehr. Wir tragen keine Rüstung oder Kleidung, die uns verraten könnte. In Ländern wie Ecuador, Nigeria oder Indonesien kleiden wir uns wie Schullehrer und Ladenbesitzer. In Washington und Paris sehen wir wie Regierungsbeamte oder Banker aus. Wir wirken bescheiden und normal. Wir besuchen Projekte und schlendern durch verarmte Dörfer. Wir bekunden Altruismus und sprechen mit den Lokalzeitungen über die wunderbaren humanitären Leistungen, die wir vollbringen. Wir bedecken die Konferenztische von Regierungsausschüssen mit Tabellen und finanziellen Hochrechnungen und halten an der Harvard Business School Vorlesungen über die Wunder der Makroökonomie. Wir sind stets präsent und agieren ganz offen. Oder zumindest stellen wir uns so dar und werden so akzeptiert. So funktioniert das System. Wir greifen selten zu illegalen Mitteln, weil das System auf Täuschung basiert, und das System ist von der Definition her legal.
Aber (und das ist ein sehr starkes »Aber«) wenn wir scheitern, greift eine ganz besonders finstere Truppe ein, die wir EHM als Schakale bezeichnen, Männer, die die direkten Erben dieser frühen Weltreiche sind. Die Schakale sind immer da, sie lauern im Schatten. Wenn sie auftauchen, werden Staatschefs gestürzt oder sterben bei »Unfällen«. Und wenn die Schakale versagen sollten, wie zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak, dann muss doch wieder das alte Modell herhalten. Dann werden junge Amerikaner in den Krieg geschickt, um zu töten und zu sterben. … Economic Hit Man, Schakale und Soldaten werden eingesetzt werden, so lange man nachweisen kann, daß durch ihre Aktivitäten wirtschaftliches Wachstum erzeugt oder gefördert wird – und Wachstum ist fast immer die Folge ihrer Machenschaften.“ Wobei festzuhalten bleibt, daß die Profiteure des Wachstums in den USA und allenfalls noch in deren alliierten Vasallenstaaten sitzen, während die betroffenen Ökonomien in den unterworfenen Regionen in der neoliberalen Schuldenfalle landen. Exakt dies zeichnet sich bereits jetzt in der Ukraine ab, der von westlicher Seite inklusive Internationalem Währungsfonds milliardenschwere Kredite zugesagt und angedreht werden, die jemals zurückzuzahlen absehbar die volkswirtschaftlichen Kräfte des bankrotten Landes übersteigen wird. Auf diese Weise schafft man sich willige Vasallen in der Schuldknechtschaft, die sich – Pustekuchen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und soziale Marktwirtschaft – nach Belieben auf dem Schachbrett der Geoökonomie und -strategie hin- und herschieben lassen.
Die horrenden Effekte für die von solcherart skrupelloser Macht-, Ausplünderungs- und Gewaltpolitik westlicher Provenienz unter Rädelsführerschaft der USA betroffenen Länder rund um den Globus brachte der Literaturnobelpreisträger Harold Pinter in seiner – von den westlichen Konzernmedien symptomatischerweise weitgehend totgeschwiegenen – Preisrede vom 7. Dezember 2005 glasklar auf den Punkt, als er sagte: „In diesen Ländern hat es Hunderttausende von Toten gegeben. Hat es sie wirklich gegeben? Und sind sie wirklich alle der US-Außenpolitik zuzuschreiben? Die Antwort lautet ja, es hat sie gegeben, und sie sind der amerikanischen Außenpolitik zuzuschreiben. Aber davon weiß man natürlich nichts. Es ist nie passiert. Nichts ist jemals passiert. Sogar als es passierte, passierte es nicht. Es spielte keine Rolle. Es interessierte niemanden. Die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, konstant, infam, unbarmherzig, aber nur sehr wenige Menschen haben wirklich darüber gesprochen. Das muss man Amerika lassen. Es hat weltweit eine ziemlich kühl operierende Machtmanipulation betrieben, und sich dabei als Streiter für das universelle Gute gebärdet. Ein glänzender, sogar geistreicher, äußerst erfolgreicher Hypnoseakt. Ich behaupte, die Vereinigten Staaten ziehen die größte Show der Welt ab, ganz ohne Zweifel. Brutal, gleichgültig, verächtlich und skrupellos, aber auch ausgesprochen clever.“
Fügt man an diesem Punkt nun die Analysen und Erfahrungen der zuvor genannten Autoren Brzezinski, Kinzer, Perkins, Pinter – allesamt Angehörige des euroatlantischen Kulturkreises und keineswegs unter die Kategorie „Rußlandversteher“ zu subsumieren – zu einem Gesamtbild zusammen, so erschließen sich die Hintergründe dessen, was in den letzten Monaten in der Ukraine zu beobachten war. Das Drehbuch für den Regime Change war längst geschrieben und bedurfte lediglich seiner Realisierung, die dann auch als weitgehend gelungene Inszenierung für eine erstaunte bis erschreckte Weltöffentlichkeit stattgefunden hat. Mit einem Schönheitsfehler freilich, denn die Krim gehört nun ungeplanterweise zu Rußland – euroatlantische Hybris kam halt vor dem Fall.
Um an dieser Stelle keine allfälligen Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Weder dürfen die Zustände in der mittlerweile ja auf dem Schutthaufen der Geschichte gelandeten ehemaligen Sowjetunion beschönigt werden – worauf auch der schon genannte Harold Pinter schonungslos hinwies: „Jeder weiß, was in der Sowjetunion und in ganz Osteuropa während der Nachkriegszeit passierte: die systematische Brutalität, die weit verbreiteten Gräueltaten, die rücksichtslose Unterdrückung eigenständigen Denkens. All dies ist ausführlich dokumentiert und belegt worden.“ Noch darf darüber hinaus das völkerrechtswidrige Vorgehen Moskaus im Zuge der Wiedereingliederung der Krim und Sewastopols in die Russischen Föderation verschwiegen werden, das weder mit der völkerrechtlich verbindlichen Satzung der Vereinten Nationen noch mit einer Vielzahl völkervertragsrechtlicher oder politischer Vereinbarungen und Garantien, wie sie etwa im Verlaufe des KSZE/OSZE-Prozesses getroffen und gegeben worden sind, zur Deckung zu bringen ist. Ganz klar geht dieser Sachverhalt zudem aus Artikel 3 der von der UN-Generalversammlung bereits 1974 beschlossene Resolution zur „Definition der Aggression“ (A/RES/3314 (XXIX)) hervor. Nur gilt eben, daß, wer über die völkerrechtliche Verfehlung Rußlands reden will, über die in Serie begangenen Völkerrechtsverbrechen des Westens nicht schweigen darf.
Wie und wohin der Konflikt um Krim und Ukraine weitertreiben wird, ist derzeit unabsehbar. Folgt man der geostrategischen Denkschule eines Zbigniew Brzezinskis, dessen Name lediglich pars pro toto für die wohl einflußreichste Fraktion in der US-amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik steht, dann ist mit dem Putsch in Kiew der Job ja längst noch nicht erledigt – auf dem längerfristigen Programm steht nämlich der regimewechseltechnische Dreisprung Kiew–Minsk–Moskau. Konkret heißt das: der „Scherge“ in Minsk sowie der „Verrückte“ in Moskau muß weg und Frieden gibts erst, wenn schlußendlich auch im Kreml kollaborationswillige Marionetten Washingtons residieren. Kurzfristig besorgniserregend muß die momentan unter Leitung einschlägig bekannter Rechtsextremisten mit CIA-Geld und Ausbildungsberatern US-amerikanischer Söldnerfirmen betriebene Aufstellung einer kopfstarken ukrainischen Nationalgarde erscheinen. Was sich hieraus entspinnen könnte, entspräche möglicherweise den in den Balkankriegen der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts erprobten Szenarien. Dort hatten im Sommer 1995 im Rahmen der „Operation Sturm“ 120.000 kroatische Soldaten zunächst die Region Krajina „serbenfrei“ gemacht, um dann im Herbst gemeinsam mit bosnischen Armeeeinheiten die serbischen Streitkräfte im Rahmen der „Operation Mistral“ endgültig zu schlagen – in beiden Fällen waren die Truppen von Söldnerfirmen wie MPRI trainiert und von NATO-Luftstreitkräften unterstützt worden. Nach demselben Muster verlief der sogenannte Kosovo-Krieg 1999, wo die NATO in einem 78tägigen Luftkrieg die von der Terrororganisation zur Freiheitskämpfertruppe mutierte kosovo-albanische UCK an die Macht bombte und damit bewirkte, daß anschließend unter den Augen der KFOR das Kosovo von Serben, Ashkali und Roma sowie Juden ethnisch gesäubert wurde. Nicht auszuschließen ist ein ähnliches Szenario in der Ostukraine, wo die neue Nationalgarde systematisch einen anti-russisch fundierten Konflikt anheizen könnte, der im Falle einer Eskalation in den Bereich ethnischer Vertreibungen oder Säuberungen dann ein militärisches Eingreifen russischer Streitkräfte provozieren könnte. Letzteres bildete dann den Vorwand für die „Vorwärtsstationierung“ US-amerikanischer rsp. NATO-Luftstreitkräfte und deren Intervention in das Bürgerkriegsgeschehen – alles im Namen von Freiheit und Menschenrechten, versteht sich. Die Eskalationsgefahr einer derartigen Konfliktentwicklung ist selbstredend enorm, nicht zuletzt angesichts des Umstandes, daß die USA, wie im Jahre 2006 die sicherheitspolitischen Experten Keir A. Lieber und Daryl G. Press in ihrem Beitrag „The End of MAD? The Nuclear Dimension of U.S. Primacy“, erschienen in der Fachzeitschrift „International Security”, seit Jahren über die Fähigkeit zu einem nuklearen Enthauptungsschlag verfügen, mit dem sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das zusammengeschrumpfte russische Atomwaffenpotential komplett vernichten und zugleich die Gefahr eines nuklearen Gegenschlages ausschalten könnten. Daraus resultiert die Erkenntnis, daß das ehemals stabile System gegenseitiger nuklearer Abschreckung mittlerweile extrem instabil geworden ist und ganz erhebliche Anreize für den Ersteinsatz von Atomwaffen existieren – nichts geringeres als ein sowohl militärstrategischer als auch friedenspolitischer Alptraum!
Was angesichts dessen dringend not tut, sind unverzüglich aufzunehmende internationale Verhandlungen zwischen der Russischen Föderation, der Ukraine, den USA und der Europäischen Union, mit dem Ziel, die Krise zu deeskalieren und auf politisch-diplomatischem Wege beizulegen. Wie das Ergebnis eines derartigen Verhandlungsprozesses aussehen könnte, haben im Laufe des Kalten Krieges geprägte Politiker wie Henry Kissinger oder Helmut Schmidt bereits dargelegt. Im Grunde muß es um eine Neutralisierung der Ukraine nach dem Beispiel Finnlands oder auch Österreichs am Ende des Zweiten Weltkriegs gehen. Zu verhandeln und zu ratifizieren wäre ein Staatsvertrag, in dem die Ukraine immerwährende Neutralität zusichert und im Gegenzug die Souveränität und territoriale Integrität des Landes garantiert wird. Letzteres schließt eine zukünftige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zwingend aus. Darüber hinaus wäre sicherzustellen, daß das Land sich einerseits zwar der Europäischen Union assoziieren darf, ohne allerdings Vollmitglied werden zu können, da es ansonsten Teil der militärischen Integration im Rahmen der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)“ rsp. der „Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)“ werden würde, was wiederum einer Art von NATO-Mitgliedschaft durch die Hintertür gleichkäme, solange dieser überkommene Militärpakt unter Hegemonie der USA noch fortexistiert. Andererseits muß geregelt werden, auf welche Weise die Ukraine den ökonomischen Verbund mit der Russischen Föderation gestalten könnte, beispielsweise im Rahmen des Projekts einer „Eurasischen Union“. Von seiten der Europäischen Union und insbesondere auch Deutschlands wäre eine solche vertragliche Regelung dadurch abzusichern, daß die im Zuge der bewährten Entspannungspolitik aus den Zeiten des Kalten Krieges eingegangene gegenseitige wirtschaftliche Verflechtung mit Rußland nicht, wie momentan von russophoben Schwachköpfen gefordert, etwa aufgelöst, sondern im Gegenteil ausgebaut und vertieft wird – nichts vermag im Jahre 2014 die überragende Weisheit dieses ungemein friedenssichernden Ansatzes so schlagend zu demonstrieren wie die Rückbesinnung auf das Jahr 1914.
Epilog: Abschließend seien all jenen gehirngewaschenen Transatlantikern, die immer noch mit ihrem in den US-amerikanischen Nationalfarben angestrichenem Brett vor dem Kopf durch die Welt torkeln, folgende Erkenntnisse des bereits eingangs zitierten Zbigniew Brzezinskis ins politische Kleinhirn gehämmert: „Kurz, eurasische Geostrategie bedeutet für die Vereinigten Staaten den taktisch klugen und entschlossenen Umgang mit geostrategisch dynamischen Staaten und den behutsamen Umgang mit geopolitisch katalytischen Staaten entsprechend dem Doppelinteresse Amerikas an einer kurzfristigen Bewahrung seiner einzigartigen globalen Machtposition und an deren langfristiger Umwandlung in eine zunehmend institutionalisierte weltweite Zusammenarbeit. Bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie: Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu sorgen, daß die »Barbaren«völker sich nicht zusammenschließen.“
Der Autor war Oberstleutnant der Bundeswehr und ist Mitglied im Vorstand des „Darmstädter Signals“, des Forums für kritische StaatsbürgerInnen in Uniform.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
In den Jahren 1930/31 entwickelten Walter Benjamin, Bertolt Brecht und Herbert Ihering mit wechselnden Beiträgern für den Rowohlt-Verlag die Konzeption einer Zeitschrift "Krise und Kritik". Der Entwurf sah vor, mit den Mitteln der Kritik die "Krise auf allen Gebieten der Ideologie festzustellen und herbeizuführen". Zugleich sollte die Zeitschrift Instrument der Untersuchung "der Rolle der Intellektuellen" sein, und den dialektischen Materialismus als Methode intellektueller Produktion erproben. Eine Zeitschrift, die heute und im Angesicht der aktuellen Krise "Krim" Relevanz hat. Die Bündelung intellektueller Energien unter einem Titelblatt ist heute mehr noch als vor über 80 Jahren eine Seltenheit, und spätestens seit die Utopie des offnen Netzwerks im Terror der Reklame, die dem Terror der Überwachung immanent ist, zerfiel, hat das Internet seine Krise. Sie ist zugleich seine Kritik. Die jederzeit habbare Information, der jederzeit jeden Orts mögliche "Blick" in jeden Winkel der virtuellen Welt, verunmöglicht zugleich die Erfahrung. Netznomaden machen keine Kriege, sie zetteln sie vielleicht an, und wenn der Soldat der Zukunft mit gesenktem Kopf von seinem Smartphone aus das Schlachtfeld justiert, sein vis-à-vis ins Visier nimmt und per Fingerabdruck eliminiert, steht zu erwarten, daß Messer und Beil wieder ins Register der Nahkampfwaffen aufgenommen werden.
Wovon reden wir, wenn wir von Krise reden? Schließlich reden wir dauernd von Krise. Sind wir dabei, den Begriff des Krieges schleichend durch den der Krise – wenigstens in unsren kultivierten Breiten – zu ersetzen? Falls ja: Welchen Nutzen soll dann Kritik haben und wohin soll sie führen, wenn sie keine Friedensstifterin sein kann, Kritik ist Krieg! Welche Formen von Kritik sind nötig, um Krisen zu benennen, sie voranzutreiben in den Qualitätsumschlag zu etwas Neuem, und sei es lediglich ein neues Begriffsystem? Was wollen wir, die wir uns in mehrfach möglicher Auslegung in einer "kritischen Epoche" befinden, erreichen? Haben wir an beiden, Krisen und Kritiken, nicht zuviel? Ist am Ende ein neuer (oder alter) Krieg nötig, um die festgefahrene Begriffskonstellation zu zerschlagen?
Die Krise stellt in den verkürzten Intervallen ihrer Wiederkehr einen gegenwärtigen Normzustand dar. Ob politische, militärische, ob Öl-, ob Umwelt-, Rechtschreib-, ob Bevölkerungs-, ob Wirtschaftswachstumskrise, Klima-, Job-, Globalisierungs-, Bildungskrise, Krise der kulturellen Identität, des Nationalbewußtseins, des kollektiven Bewußtseins (um vom Ich und seiner Krise nicht zu reden) und so fort. Der inflationäre Gebrauch des Krisenbegriffs entspricht der Inflation der Symptome. Naheliegend daher die Frage: Lassen sich all diese Erscheinungsformen als Facetten einer "großen umfassenden Krise" charakterisieren, wie es Brecht und Benjamin versuchten? Falls ja, was wäre diese Krise: Die des Systems? Falls das, dann von welchem? Gerade die scheinbare Vereinheitlichung der Welt durch das Internet in ein System, macht es angreifbar und etabliert die Krise, die als ihr eigner Kritiker auftritt. Ein Endpunkt? Falls ja, was kommt danach? Und was muß gehen, damit überhaupt etwas kommt? Wo bleiben die Widersprüche, die nach Marx doch die gesellschaftlichen Stadien in ihre historische Notwendigkeit der Entwicklung hin zum Kommunismus treiben? Tatsächlich ist der dialektische Materialismus auch nur eine Weltanschauung, kein Zustand, kein Prozeß, kein "real existierendes" Gesellschaftssystem, wie Generationen irrtümlich geglaubt und gelebt haben. Ist er deswegen obsolet? Falls nicht, was ist damit noch anzufangen?
2014 oder 25 Jahre nach dem Zerfall der dualen Systemkonfrontation "Kalter Krieg" bricht mit der Krim erneut ein Stück Landmasse aus der Kartographie des überschaubaren Weltbilds. Wie die Jugoslawienkriege der 90er Jahre den Zerfall eines Systems in unterschiedlicher Zielrichtung als Bewegung kennzeichneten, zeichnet die bürgerkriegsartige Krise zwischen Russen und Ukrainern die anhaltende Umformung des sowjetischen Imperiums aus. Das mag ein Euphemismus sein, aber jenseits aller Moral, ist das russische System eben eines, das wir aus der "westlichen Perspektive" des demokratischen Kapitalismus, der sogenannten freien Marktwirtschaft, nicht auf einen Nenner bringen können. Der Kapitalismus, den wir kennen, ist nicht von Krisen bedroht, er ernährt sich vielmehr davon, und vielleicht ist er ja selbst im wesentlichen nichts anderes als eine einzige Krise. Ob das auf die nach-sowjetischen Strukturen auch zutrifft, muß dahingestellt bleiben; möglich, daß die kommenden Wochen schon etwas anderes zeigen.
In einem Memorandum zur projektierten Zeitschrift "Krise und Kritik" spricht Walter Benjamin von deren politischem Charakter: "Ihre kritische Tätigkeit ist in einem klaren Bewußtsein von der kritischen Grundsituation der heutigen Gesellschaft verankert. Sie steht auf dem Boden des Klassenkampfes." Dieser Boden ist heute kontaminiert, vom Schlachtfeld ist das Minenfeld geblieben, bestückt mit diffundierten Theorien und Begriffen. Ein in Konformismus mündendes Krisenbewußtsein und ein gestörtes, vielfach gebrochenes (gespiegeltes) kritisches Bewußtsein sind Merkmale unsrer Epoche. Fern von utopischen Entwürfen scheint Kritik heute nichts als eine weitere Facette der Krise zu sein. Die Wirkung der Kritik reduziert sich auf ästhetische, bestenfalls ethische Kategorien. Wo Kritik für die praktische Überwindung der Krise ungeeignet ist, rückt die Technik an fürs Grobe: "Krise und Kritik" werden zu "Problem und Lösung" rationalisiert. Technik wird zur Fortsetzung der Krise mit anderen Mitteln. Technik ist Kritikersatz, sie lebt in Gestalt der "sozialen Netzwerke", ein krisenübersättigter befragungswürdiger Begriff mithin. Technik ist die Ethik derer, die der Krise ihren Status zuerkennen: status quo. Die Krise der Netzwerke verschärft sich proportional zur technischen Entwicklung; je größer die Möglichkeiten der Technik, um so geringer ihre Möglichkeiten die Krise zu beheben. Wenn die Gentechnik die humane Reproduktion ermöglicht, wird der materialistische Ansatz, daß alles Neue besser sei als alles Alte, revidiert. Wenn alles wiederholbar wird, weil reproduzierbar, wird der Code civil des Humanismus neu geschrieben werden müssen.
Ausgehend von Brechts und Benjamins ana-chronistischer Idee eines "eingreifenden Denkens" scheint die nähere Betrachtung der Rolle der Intellektuellen unter der Begriffspaarung "Krise und Kritik" zumindest sinnvoll. Was schließlich ist ein Intellektueller andres als ein Kritiker? Heiner Müllers Erkenntnis daß der Intellektuelle in keiner Nation so gehaßt wird wie in der deutschen, fiel ihm nicht zufällig 1990 zu, als Kritik an den Verhältnissen nur Störfaktor und Anschlußfehler im Prozeß der "Wiedervereinigung" bedeuten konnte. Der Begriff eines Wieder-Zusammenschlusses erinnert heute an Marx' Hegelnotiz, daß sich weltgeschichtliche Tatsachen und Personen zweimal ereignen: Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Daß wir die Farce immer noch leben, zeigen Randkuriositäten wie die Steuerbiographie des Fußball- und Würstchenmanagers, der seine Spieler und Würstchen zu nicht geringem Teil aus der Erbmasse des sozialistischen Lagers rekrutieren und verwerten konnte.Zurück zur Frage: Welche Arbeit können Intellektuelle in einer kritischen Epoche leisten, wenn zum Beispiel der Begriff der Arbeit – Lohnarbeit wird für eine Mehrheit zu Lohnarbeitslosigkeit – sich der Begrifflichkeit entzieht? Ist Arbeit nur noch Geschichte oder schon wieder Aneignung derselben, die zur Zeit ohne erkennbares "Ziel" verläuft, deren Richtung doch vom Primat der Arbeit und der Arbeitskämpfe bestimmt war? Hat Geschichte überhaupt ein Ziel? Was ist sie, "die Geschichte", im permanenten Datenstrom der Gegenwart? Nicht mehr als ein Reizfaktor der Unterhaltungsindustrie, wie man vor den Bücherbergen anläßlich der 100 Jahre Erster Weltkrieg oder demnächst 25 Jahre Mauerfall und ähnlichem glauben muß. Wie hat Kritik anzusetzen, wenn sie mehr als Literaturkritik sein soll? Welchen Wert hat eine kritische Theorie, wenn sie keine Praxis findet, von der sie widerlegt werden kann? Zusammengefaßt: Die Frage, welche Form Kritik haben muß, damit sie gesellschaftlich wirken kann, steht im Raum. Falls die Kunst dort etwas tun kann, dann mit der ihr innewohnenden Möglichkeit der Phantasie: Des aus-der-Zeit-Steigens, des die-Zeit-Anhaltens, des gegen-die-Rationalität-Lebens. Daß diese Fähigkeit als reaktionär kritisiert werden wird, soll uns von ihr, der Kunst, nicht abhalten.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Hegels Eule der Minerva, die an seinem Lebensabend ihren Flug begann, flog in die „Nacht des Proletariats“ – nach Paris, für Walter Benjamin die „Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts“. Noch liegen die Strahlen der Gaslaternen mit der Abenddämmerung im Streit, schon bald haben sie gesiegt. Düster und zerfahren wie das Licht selbst erscheint die ruhelose Menge: 'la multitude'. Es ist erlaubt, ab und zu anzuhalten, es ist nicht erlaubt zu schlafen! Müßiggänger streunen herum und Arbeiter, die statt ihre Arbeitskraft zu reproduzieren, sich in Kneipen treffen oder in Kellern, wo sie Texte redigieren, Zeitungen drucken, philosophieren oder den Aufstand vorbereiten, die sog. 'Schwarzröcke', Tag und Nacht in der Tracht der Trauer, denn jeder Tag könnte jemandes Beisetzung sein. Oder das Signal zum Aufstand kommen - jetzt!
Als unsichtbare Polizei der Revolte sorgen sie dann für den Erhalt der Ordnung, also der Nacht, in der die Feuer der Barrikaden leuchten wie die Sterne, für Hegel der „Aussatz des Himmels“. Im Himmel wie auf Erden gibt es nur noch Müßiggänger und Aktivisten, damals wie heute: Das „unergründliche Dunkel des Massendaseins in den großen Städten“ ist es, das die besten und bösesten Dichter der Moderne fasziniert, von Baudelaire bis Brecht; wohl wissend, dass jeder Mensch ein Geheimnis mit sich herumträgt, das, würde es bekannt, ihn überall verhasst machen würde – sei es, dass er oder sie einmal den dunklen Drang verspürt hat, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu gehen, um mit dem elenden Prinzip der Erniedrigung und Verdummung aufzuräumen: einer Welt herrenloser Knechte, die Kollaborateure macht aus uns allen. Zu dieser Stunde der Nacht sind alle großen Wachenden tot - und wir haben sie getötet. Nie war die Nacht von undurchdringlicherem Dunkel für die Intelligenz als jetzt. Jetzt ist die Nacht und langsam dämmert uns, wenn wir in unsre Rechner blicken, dass alles, was wir anschauen, uns anschaut: sämtliches Licht der Welt zieht sich auf den kleinen schwarzen Fleck einer Pupille zusammen und verwandelt es in die helle Nacht eines Bildschirms: Aufklärung hieß immer schon geistige Erleuchtung und militärische Informationsbeschaffung. Souverän ist, wer dem Anderen die Angst vor dem Tod nimmt, der Sicherheit verspricht vor Terroranschlägen, Selbstmordattentätern, Serienkillern, Viren oder Surrealisten, die mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße gehen und blindlings so viel wie möglich in die Menge schießen – jetzt!
Es ist das Milieu der bewaffneten Bohème, das Benjamin in seinem Buch über Baudelaire beschrieben hat, der sowohl der verrufene Dichter als auch der verrufene Kaiser entstammte: die finstere Welt von Berufsverschwörern, die sich unter der schwarzen Fahne der Nacht versammeln. Seit dem Staatsstreich (18. Brumaire) bestanden die alten Arbeiter-Assoziationen nur noch als kommerzielle Compagnien fort, im Verborgenen planten sie den Tyrannenmord. Dem gegenüber steht der dunkle und tiefe Traum eines mystischen Anarchismus à la Gustav Landauer: „Nicht andere umzubringen, sondern sich selbst.“ Souveränität, nannte das der Hegelleser Bataille oder das Denken des Herren. Wie die alten Verschwörer traf sich in den letzten beiden Jahren vor dem letzten Weltkrieg eine Gruppe von Soziologen und versuchte, die Kräfte der Dunkelheit zu entfesseln, um die Mächte der Finsternis zu bannen, die sie von der anderen Seite des Rheins bedrohten. Wie an Horkheimers Institut beschäftigten sie sich mit Sozialforschung und der Dialektik der Aufklärung: Doch anders als die Frankfurter wollten die Franzosen den Mythos, der Aufklärung geworden war, nicht aufklären, sondern beschwören: Sakralsoziologie nannten sie das Ganze und erforschten die dunkle Seite der Macht: das Opfer. Die meiste Zeit nur als dunkles Gefühl empfunden, tritt sein Wesen erst im Licht der Sakralsoziologie hervor als Versuch, im Angesicht des Todes ein klein wenig Haltung einzunehmen. Das Wesen der sakralen Sprache: sowohl grauenerregend, als auch vertraut zu sein, in alltägliche Redewendungen wie Jetzt ist die Nacht! So lautet die Parole der Verschwörung – einer offenen Verschwörung, die sogar so offen ist, dass man gar nicht mitbekommt, dass man Teil von ihr geworden ist. Man spricht den Code (die Redewendung), ohne jemals von irgendjemand in irgendetwas initiiert worden zu sein. Die Macht und die Magie der Sprache: eine Hell-Dunkel-Umkehrung. Nicht durch Aufmerksamkeit gelangen wir zur Klarheit, sondern durch Zerstreuung, dadurch, dass wir die Gedanken schweifen und die Wörter über ihre wortwörtliche Bedeutung hinaustreten lassen, sie ihrem inneren Widerspruch überlassen, ihrer Dunkelheit. Denn nur so werden wir sehen, was wir sonst nicht sehen können: durch den Kontrast zur Dunkelheit. Sie ist unsre einzige Hoffnung im Kampf gegen das von allen Seiten einbrechende Licht – jetzt! ist die Nacht!
Und damit befinden wir uns im Herzen von Hegels Philosophie. Dieser Satz, den ich mir gestern Nacht aufgeschrieben und aufgehoben habe, hat sich heute morgen zwar erhalten, aber als etwas, das nicht Nacht ist; aber ebenso hat es sich auch gegen den Tag, der dieses Jetzt jetzt ist, erhalten als etwas, das auch nicht Tag ist. Es hat sich also dadurch erhalten, dass etwas anderes, nämlich der Tag und die Nacht nicht ist. Es ist weder dieses noch jenes, kann aber ebenso sowohl dieses als auch jenes sein: so beschreibt Hegel die Negativität, die man als Mensch, als handelndes Wesen ist. Handeln heißt negieren, Arbeit verrichten Sachen vernichten. Das ist die ganze Dialektik. Das steckt natürlich alles in diesem einem Wort, von dem Hegel so viel Aufhebens macht: der Aufhebung. Das kann man leicht nachvollziehen, so kann kann man sich ja auch fühlen – gut oder schlecht aufgehoben. Oder man hebt sich etwas für später auf. Damit man noch was zu tun hat. Aber was passiert, wenn es nichts mehr zu tun gibt, wenn mein Bedürfnis zu handeln, meine „Negativität“ keine Beschäftigung mehr findet. Ist das ein Missgeschick oder eine Chance? Wie soll denn der Knecht, der ja bekanntlich derjenige ist, der den Herrn anerkannt hat, vom Herrn anerkannt werden, wenn er nicht mehr arbeiten kann für ihn? Das macht ihn natürlich gemeingefährlich und deswegen muss man ihn Tag und Nacht überwachen. Ich muss also kämpfen, ich muss handeln, damit anerkannt wird, dass es nichts mehr zu tun gibt, dass man nicht mehr handeln kann: ich muss zum Menschen der „anerkannten Negativität“ werden laut Bataille – d.h. es muss möglich sein, dass ich jetzt, am Montagmorgen auf die Straße gehe und zum Nächstbesten sage: „Jetzt ist die Nacht!“ Und der antwortet: Genau! Jetzt ist die Nacht, genau jetzt! Dazu braucht es die Hell-Dunkel-Umkehrung: Dass man lebt, ist ja eben deshalb nicht zu empfinden! Der gelebte Augenblick ist am dunkelsten. Am Fuße des Leuchtturms ist kein Licht. (Auch eine Redewendung.) Es müsste also darum gehen, diese Dunkelzone auszuweiten – zur Zukunft: Das ist ja die Zukunft, dieses Dunkel. Erst vor diesem Dunkel erkennen wir das Jetzt! Und erst durchs Jetzt die Zukunft: Jetzt, Zukunft. Jetzt!
Nicht die Geschichte ist also zu Ende, wie das seit Hegel alle hundert Jahre wieder verkündet wird, sondern die Arbeit, bzw. wenn die Geschichte zu Ende ist, dann deswegen. Die Arbeit wird vom Knecht verrichtet, laut Hegel, der sich auch selbst für einen Knecht hielt, er sprach ja immer von der „Arbeit des Begriffs“ und der „Arbeit des Negativen“ usw. Wie soll also der Knecht als derjenige, der den Herrn anerkannt hat, nun vom Herrn anerkannt werden, wenn es für ihn nichts mehr zu tun gibt? Ist also die bürgerliche Dämmerung, in der wir uns befinden, eine Dämmerung des Knechts? Oder war es nicht von jeher die Knechtschaft, die den Mangel an Licht in die Welt gebracht hat, fragt Bataille in Die Aufhebung der Ökonomie. Ist sie es, die die Sonne verdeckt wie eine dunkle Wolkendecke, ihren Glanz von den Dingen abzieht, so dass sie in aller Deutlichkeit vor uns liegen: grau in grau gebrauchsfertig? Das ist der Fluch der Eule, dass man heute noch der Meinung ist, die Welt sei arm und die Arbeit notwendig. Aber die Welt krankt an ihrem Reichtum! Wir müssen uns verschwenden - wie die Sonne: wir sind im Grunde nichts als ein Ergebnis der Sonnenenergie. Diese Energie kann man nicht ewig behalten, man muss sie wieder abgeben, verausgaben – die Sonne ist das Symbol einer anderen Ökonomie, einer Ökonomie des Verlusts, nicht des Gewinns: des Opfers. Jetzt ist die Nacht Tag.
Nach einem lecture-concert von andcompany&Co. im Rahmen der Konferenz EINBRUCH DER DUNKELHEIT – Praxis und Theorie der Selbstermächtigung in Zeiten digitaler Kontrolle, eine Veranstaltung der Kulturstiftung des Bundes in Kooperation mit der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz – am 25. und 26. Januar 2014.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Rosa Luxemburg nicht primär vor dem Horizont einer möglichen Hollywood-Verfilmung oder pathetischer Geschichtsdokumentationen zu betrachten, sondern vor dem Hintergrund einer Gegenwart, die ohne Unterlass Katastrophen und Widersprüche produziert – das wäre ein erster Schritt ins Leere. Plötzlich Verstrickung in die Frage nach dem Proletariat. Von da an reiht sich nur noch Loch an Loch. Vielleicht weil das Proletariat mittlerweile ein so schmutziges, angegammeltes und leeres Wort geworden ist, erscheint es mit einem Mal viel versprechend …
KEEP ON SAYING THAT!
Am Anfang steht die Aufgabe, Rosa Luxemburg der kulturindustriellen Ausbeutung ebenso, wie der durch bildungsbürgerliche Musealisierung zu entziehen. „Erst wenn er aus dem Mausoleum raus ist. Dann ist der Virus wieder freigesetzt.“, so formuliert Heiner Müller in „Jenseits der Nation“ die Taktik des Grabraubs, die zur Reaktivierung Lenins nötig wäre.
Der Virus Luxemburg hat sich von vornherein der Quarantäne verweigert. So liegt der vorerst leere Sarg gleichsam als Drohung in der Erde. Die Drohung ist eine doppelte: oben wartet der noch unsichtbare Virus auf seinen Ausbruch, während unten die unbeglichene Rechnung die Fundamente aushöhlt. Eine Leere, die sich auch dann noch einschleicht, wenn man versucht sie mit einer, aus dem Landwehrkanal herausgefischten und als Luxemburg identifizierten, Frauenleiche zu stopfen. Der leere Sarg, der das Gespenst ankündigt: Rosa Luxemburg als Bild in dem sich der Gegenstand ihrer Arbeit abzeichnet. Auch das Proletariat ist totgesagt, ohne dass man seine Leiche ausfindig machen könnte. Es entfaltet sich als ortlose, „über das Land zerstreute (...) Masse“1. Doch auch in der Leere seines Sarges verbirgt sich die Möglichkeit der Ansteckung und Aushöhlung. Black Panther Aktivist Fred Hampton, der im Dezember ‘69 in einer von FBI und Chicagoer Polizei gemeinsam geplanten Aktion ermordet wurde, hat – in weiser Voraussicht – die Anleitung zum Umgang mit seinem Verschwinden schon zu Lebzeiten formuliert:
„We might not be back. I might be in jail. I might be anywhere. But when I leave, you’ll remember I said, with the last words on my lips, that I am a revolutionary. And you’re going to have to keep on saying that. You’re going to have to say that I am a proletarian, I am the people.“2
Das ist der Versuch, uns mit seiner Formel zu infizieren. Den Virus abzulösen vom Märchen des tragischen singulären Schicksals und auf uns zu übertragen. Brecht formuliert die Forderung, die Vorschläge der Toten, anzunehmen. Nehmen wir also an …
ZERSTREUUNG – ENTEIGNUNG
Mit dem Eintritt in die Virologie verlassen wir die vertrauten Gefilde der bürgerlichen Kleinfamilie. Die freigesetzten Erreger gleichen weder autonomen Akteuren noch selbstbestimmten Individuen oder gar vernunftbegabten Vertragspartnern, vielmehr existieren sie und vermehren sich wesenhaft in Abhängigkeit vom Wirt. Zurück bleibt anstelle von Stammbaum und Familiensitz ein Loch. Dieser Umschlag kann schrittweise geschehen, vom Eigenheim, zur Hypothek, zur Zwangsräumung. Auch wenn unsere Bemühungen dahin gehen, das Loch zu benutzen, hat sich weder die Leiche Rosa Luxemburg, noch das Proletariat aus freien Stücken für die Ortlosigkeit entschieden.
„Für die besitzende bürgerliche Frau ist ihr Haus die Welt. Für die Proletarierin ist die ganze Welt ihr Haus (...) Auf dem Zwischendeck des Ozeandampfers wandert sie mit jeder Welle, die das Elend der Krise von Europa nach Amerika spült, in der buntsprachigen Menge hungernder Proletarier, um, wenn die rückläufige Welle einer amerikanischen Krise zurückschäumt, nach der heimatlichen Misere Europas, zu neuen Hoffnungen und Enttäuschungen, zur neuen Jagd nach Arbeit und Brot zurückzukehren.“ 3
Alain Badiou bezeichnete diese erzwungene Ortlosigkeit kürzlich in einem Interview mit dem Freitag4 als „Kern der Arbeiterklasse“. Der äußere Mangel, der ihr Inneres bildet, müsse also als „nomadische Kraft“ verstanden werden. Sie sei sogar „eine der stärksten Kräfte in einer Bewegung (...), die mit der kommunistischen Idee liiert ist.“ Es handelt sich bei diesen negativen Kernbestimmungen des Proletariats nicht um eine statistische Erhebung oder die leere Geste einer mitleidigen Verbeugung vor den schwächsten Gliedern der Gemeinschaft. Vielmehr ist diese Perspektive das Symptom der Ansteckung mit einer marxistischen Denkbewegung, die gerade in einem – durch die Ausbeutung hergestellten – Mangel das Potential zur Veränderung erkennt. Weil die Arbeiter jeglicher individueller Eigenart und jeglichen Eigentums beraubt wurden, haben sie „nichts von dem Ihrigen zu sichern“. Dieses Loch, das die Ausbeutung hinterlässt, macht das Proletariat zu dem, was es ist. Das gesellschaftliche Verhältnis, in dem sich der Arbeiter befindet, höhlt ihn so vollständig aus und nähert ihn dermaßen dem individuellen Tod an, dass das Proletariat kein Interesse daran hat, die Verhältnisse bestehen zu lassen. Durch seinen vollständig ausgehöhlten Loch-Kern wird eine ebenso grundlegende Umstülpung der Verhältnisse möglich, dass dabei sowohl Ausbeuter als auch die Ausgebeuteten selbst als solche zu existieren aufhören. Das ist ein wichtiger Schluss der ganzen Marxschen Maschine: das Proletariat ist ein Bestandteil der historischen Erscheinung des Kapitalismus und muss ebenso wie dieser aufhören. Es gibt eben keine Computerviren ohne Computer, auch wenn der Computervirus der Hoffnungsträger für die Zerstörung des Computers sein kann. Bevor wir den Begriff des Proletariats voreilig für widerlegt oder inakkurat erklären und seine Abschaffung fordern, sollten wir sicher gehen, dass dabei nicht Potentiale verschenkt werden, die auch heute noch von Nutzen sein könnten.
LOCH-KERN
So kann das Loch, das vom System erzeugt wird, zur Öffnung für eine andere Zukunft werden. Eine wirkliche Öffnung stellt das Proletariat eben nur dann dar, wenn es nicht als idealisiertes positives Ziel der Bewegung gehandelt wird, sondern als Motor gebraucht wird. Ernst Bloch nennt diese Marxsche Besonderheit der „Offenhaltung“ die „Aussparung des künftigen Feldes“5. Diese Aussparung ist mitbedingt durch die radikale Selbstveränderung des verändernden Elements, sein zwangsläufiges Verschwinden. Dadurch kann zwar aus der gegenwärtigen Situation auf das Mittel zu ihrer Veränderung, nicht aber auf deren Folgen geschlossen werden. Gerade diejenige Schicht der Gesellschaft, die jeder Selbständigkeit beraubt wurde, fürchtet die Zukunft ihres eigenen Verschwindens am wenigsten. Oder kürzer: Wer Schulden hat, wer nichts weiter besitzt, als die Sachen, die er tragen kann, wer für Schlafplätze bezahlt, die anderen gehören, wer aus Materialien, die anderen gehören mit Maschinen, die anderen gehören, Waren herstellt, an denen andere verdienen, der hat nichts zu verlieren, wenn die Welt Kopf steht.
„Der Proletarier ist eigentumslos; sein Verhältnis zu Weib und Kindern hat nichts mehr gemein mit dem bürgerlichen Familienverhältnis; die moderne industrielle Arbeit, die moderne Unterjochung unter das Kapital (...) hat ihm allen nationalen Charakter abgestreift. Die Gesetze, die Moral, die Religion sind für ihn ebenso viele bürgerliche Vorurteile, hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen verstecken.“6
Die Rede vom Proletariat entpuppt sich als eine hohle Phrase im positiven Sinne und wird genau dadurch zur Öffnung. Deswegen gefährden gerade die Versuche, die Position der Ausgebeuteten und Armen (sei es im Falle von Kolonisierten, Arbeitern oder Frauen) zu romantisieren und naturalisieren, die Möglichkeit der vollständigen Umwälzung. Die Basis einer möglichen Solidarität stellt somit eben nicht eine gemeinsame kulturelle, nationale oder milieubedingte Identität dar, sondern das Loch, das ihr Abzug hinterlässt. Ein Beispiel solcher Solidarität, die sich bewusst auf eine Leerstelle bezieht, wäre die Solidarität, zu der das „X“ in Malcolm X aufruft, indem es als Markierung der Entwurzelung fungiert.
„In der Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten, (...) welche einen universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt, (...) welche sich nicht emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphären der Gesellschaft und damit alle übrigen Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren, welche mit einem Wort der völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als ein besonderer Stand ist das Proletariat.“7
Man mag an die historische Zwangsläufigkeit, an eine Garantie der Umstülpung der Gesellschaft durch den Loch-Kern des Proletariats glauben oder nicht, als Strategie eines umstülpenden Denkens bleibt der Loch-Kern auch dann produktiv, wenn die tatsächliche historische Entwicklung Rückschritte zu machen scheint.
UNSICHTBARKEIT – IDEOLOGIE
Der Loch-Kern, das leere Grab, das uns auf den Virus hoffen macht, muss auch angeknüpft werden an die derzeitige Unsichtbarkeit eines Proletariats, bzw. das vermeintliche Fehlen eines revolutionären Trägers. Denn das Festhalten am Loch verrät uns, dass das Fehlen des Subjekts der Umstülpung auf der Karte vielleicht einfach etwas damit zu tun hat, dass wir die falsche Karte in der Hand halten. Oder anders gesagt: Das revolutionäre Subjekt, die hohle Phrase des Proletariats ist nicht nur durch seine mangelnde, weil enteignete Substanz definiert, sondern eben auch durch seine systematische Unsichtbarkeit innerhalb der herrschenden und die Verhältnisse zementierenden Ideologie. Die Ausschnitte, die wir derzeit zu sehen bekommen, sind einerseits entertainment- und konsumorientierte Citymaps, die sich ihrer Peripherie entledigt haben. Andererseits zeigt sich die Karte zerlegt und zerstreut in die mit manischer Akribie verfassten tabellarischen Lebensläufe unserer persönlichen Selbstverwirklichung. Die Ideologie lässt durch ihre nationale Fokussierung gerade diejenigen nicht sichtbar werden, auf deren Kosten wir innerhalb unserer Mauern das Gefühl haben können, in einer funktionierenden Gesellschaft zu leben. Nebenbei wird das Loch, das sich auch im absteigenden Mittelstand ausbreitet, verkleistert mit dem Versprechen einer durch Selbstfindungsarbeit und Optimierungsleistungen zu erreichenden, positiven „authentischen“ Identität.
Wir dürfen uns nicht darüber täuschen, dass die Löchrigkeit, an die uns Rosa Luxemburg erinnert eine ist, die uns selbst betrifft und beleidigt. Während uns die herrschende Ideologie schmeichelt, indem sie uns als heroischen Unternehmer unseres eigenen Schicksals inszeniert, fordert uns der Ideologiekritische Blick dazu auf, unseren Kern als Loch, als Leere, als Krater zu sehen, den der Einschlag der kapitalistischen Gesellschaft in uns hinterlassen hat. Der Virus Luxemburg ist auch Krankheit. Der Blick auf die eigene Gemachtheit, auf die eigene Verwertbarkeit durch die Maschine, auf die eigene Löchrigkeit, verwandelt die Welt in eine Kraterlandschaft, in der sich Loch an Loch und leeres Versprechen an leeres Versprechen reiht. Aus dem sicheren Gang des Selbstverwirklichers, der von seinem Ziel immer nur ein letztes unbezahltes Praktikum weit entfernt ist, wird das schmerzhafte Stolpern eines verarmten Schwarzsehers, dem das iPhone des Nachbarn zum Blick des Gefängnisaufsehers wird. Für die Öffnung auf eine radikal andere Zukunft braucht es eine Solidarität der Durchlöcherten. Diese aber wird nur dann möglich, wenn hinter der Ideologie das eigene „beschädigte Leben“ sichtbar wird.
LEERE – DROHUNG
Von der Formel infiziert, auf den Ausbruch des Virus bedacht, weisen wir unermüdlich darauf hin, dass die falsche Karte gerade dort Löcher aufweist oder endet, wo die Möglichkeit ihrer Infragestellung durch ein real bestehendes Loch unsichtbar bleiben soll. Der Hinweis auf den Loch-Kern, oder wie es Hito Steyerl formuliert, das Hören des „gemeinsamen Schweigens“8 , sind keine Denkfiguren, die dazu gemacht wären, uns zu befriedigen, sondern „Aussparungen des künftigen Feldes“ – Eröffnungen von Möglichkeitsräumen. Deswegen lassen wir das Loch schön da und infizieren uns gegenseitig mit der blinden Hoffnung des in die Löchrigkeit verstrickten Revolutionärs: Das Gespenst Luxemburg als Vorschlag lesen und den Loch-Kern – die drohende Leere – als viralen Kampfstoff gegen die Verewigung kapitalistischer Gleichschaltung zu benutzen, anstatt sie zu leeren Drohungen verkommen zu lassen …
--
1 Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei: http://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/1-bourprol.htm
2 www.democracynow.org/2009/12/4/the_assassination_of_fred_hampton_how
3 Rosa Luxemburg zitiert nach Frigga Haug: Luxemburg und die Kunst der Politik. S. 30.
4 http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/nomadische-kraefte
5 Ernst Bloch, Freiheit und Ordnung, Abriß der Sozialutopien, Leipzig, 1987, .S. 188.
6 Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei: http://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/1-bourprol.htm
7 Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie: http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_378.htm
8 http://translate.eipcp.net/strands/03/steyerl-strands02en?lid=steyerl-strands02de#redir
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
--
#3, 3. März 2014
Wir haben in Deutschland nicht das Glück, eine Politik wie in Russland ganz auf das Heraussprudeln immer schon vorhandener Erdgeschenke – Öl und Gas – zu setzen. Unsere Ressourcen, um weiterhin unser kleines Lebensglück im hedonistischen Friedensparadies zu sichern, lauten: Innovation und Effizienz. Wir sind zum Entwickeln, durchkalkulierten Herstellen und Verkaufen des Entwickelten verdammt. Als eine Art ökonomisches Supplement, quasi als Nahrungsergänzungsmittel, um Käuferappetit auch jenseits des aktuellen Einflusses zu wecken, müssen neue liberale Handels- und Produktionsgebiete erschlossen werden.
So unterschiedlich der Hauptmotor von Wirtschafts- und Staatseinnahmen in Ost und West, so unterschiedlich fallen die die jeweiligen Systeme ummantelnden Ideologien aus. Seit gut einem Jahrzehnt forciert und zementiert der Kreml die enge Verzahnung von Nationalismus und orthodoxer Religion. Danach ist das russische Volk das Gottesträgervolk! Auserwählt und mit besonderer Menschlichkeit und kollektivem Mitgefühl ausgestattet, rein geblieben und erhaben über alle Verfälschungen, die das Christentum im Abendland in den letzten 1000 Jahren genommen hat. Im Wissen um die eigene tellurische und spirituelle Besonderheit, verachten viele Russen westliche Werte und belächeln die Regierungsform, die wir Demokratie nennen. Nationale Ausschöpfung der Bodenressourcen korrespondiert derart mit einem nationalistisch-religiösen Überbau, der sensibel feindlich auf alles reagiert, was gegen die territoriale Integrität und “ursprüngliche Reinheit” gerichtet ist. Die Diskriminierung von Homosexuellen, die bisher all unsere Aufmerksamkeit absorbiert, ist lediglich ein Baustein der gesamten Schichtung.
Wird im Kreml gern Fjodor Dostojewski zitiert, um die Architektur der Macht zu legitimieren, versagen bei uns Künstler und die Politiker müssen ganz allein die schweißtreibende Arbeit affirmativer Philosophie erledigen. Erfrischend wider aller klebrigen Bonbonsüße offizieller Politikerverlautbarung, profiliert sich aktuell als Denk-Avantgarde des Staatsapparates Bundespräsident Joachim Gauck. Zwei seiner Aussagen, im Abstand von 14 Tagen getätigt, geben unserer gegenwärtigen ideologischen Leitlinie, die ganz anders als die russische strukturiert ist, klare Konturen. Zunächst stellte er sich Mitte Januar in einer wirtschaftspolitischen Grundsatzrede janz dumm und beklagte im Feuerzangenbowlenstil, dass der Begriff Neoliberalismus so negativ besetzt sei. Und die Münchener Sicherheitskonferenz eröffnete er mit der Forderung, dass Deutschland in der Welt mehr Verantwortung übernehmen müsse. Damit meint er Militäreinsätze, ergo Krieg. In der Kombination ergibt sich das offene Bekenntnis für ein wirtschaftlich imperiales, militärisch sekundiertes Agieren. Überzogen ist dieser nicht auf die Nation sondern in die Welt gerichtete Vektor von einem Vokabular, das nicht religiös sondern mit Begriffen der Aufklärung wie Freiheit und Menschenrechte operiert. Sie formen einen politischen Geist des Guten (respektive eine Kampfstimmung), der uns ein universales Überlegenheitsgefühl gibt, und wir in einer Mischung aus Empörung und Ekel auf solche in unseren Augen chauvinistischen und diskriminierenden Systeme wie in Russland reagieren.
Mitte Februar konnten wir an unseren Fernsehschirmen und via der Live-Berichte im Internet Zeuge eines Ideologietausches in Kiew werden. War die Ukraine zur Unabhängigkeit des Landes 1991 nahezu zu 100 Prozent sowjet- und russifiziert, versuchte Moskau besonders in der letzten Dekade Bestandssicherung in der Pufferzone mit der Ukraine-Russland-Idee: eine Geschichte, eine Kultur und zwei Länder. Diese Anschauung hatte nach über 20 Jahren Unabhängigkeit im Westen des Landes sowie in der Hauptstadt kaum noch Träger und wurde dort von der patriotischen ukrainischen Antwort – zwei Länder, zwei Kulturen, zwei Geschichten – zurückgedrängt. Die ideologischen Spannungen und Widersprüche, die sich daraus vor allem mit dem Osten des Landes ergaben, entluden sich vergangenen Monat in Kiew und führten zu der Tragödie fast 100 getöteter Demonstranten und dem Putsch der Regierung.
Das Drehbuch der Februar-Ereignisse hatte dabei eine perfide Dynamik: Schon als die Demonstrationen in Kiew lange nicht mehr friedlich waren und sich der Protest bereits auf der Ebene von Schlagstöcken, Pflastersteinen, Brandsätzen und Krankenhaus abspielte, orchestrierte die Achse Washington, Berlin und Brüssel, dass Kiew das Recht auf freie Meinungsäußerung wahren müsse. Das war der transatlantische Schutzbrief zur Eskalation der Gewalt; im Fahrwasser der westlichen Deckung hat der paramilitärische Flügel der Regierungsgegner grünes Licht für die Attacke erhalten. Wenngleich nicht repräsentativ für den gesamten Majdan, so sind es doch der militante “Rechte Sektor” und die neofaschistische “Swoboda-Partei” sowie eine entsprechende sympathisierende Masse, die Fakten der Gewalt geschaffen haben.
Interessant ist, dass die Majdan-Revolution nicht unter einer spezifisch ukrainischen sondern nun unter der für den Westen typischen hegemonialen Erzählung subsumiert wird: “Ein Volk lehnte sich gegen den Herrscher auf, der Menschrechte und Freiheit mit Füßen trat. Der reagierte mit Gewalt und ließ auf das Volk schießen. Nun sind die Repräsentanten der Freiheit an der Macht.” Diese, unsere Deutungsperspektive übergeht ein brisantes Detail, das Abgründe in die Zukunft zeichnet. Die Büchse der Pandora wurde am 18. Februar geöffnet. Es ist der erste Tag, an dem sich die Demonstrationen in Kiewer Stadtzentrum ins Blutige und Tödliche kehrten. Tödlich, für ermordete Demonstranten, aber tödlich auch für die bewaffneten und uniformierten Organe der Ukraine. 10 Polizisten wurden an diesem Dienstag erschossen, über 80 mit Schusswunden hospitalisiert, ca. 300 landeten schwerverletzt im Krankenhaus. Oppositionelle Fernsehsender in der Ukraine ebenso wie regierungsnahe Medien in Russland zeigten paramilitärisch agierende Demonstranten, die nicht nur gezielt mit Gewehren und Pistolen feuern, sondern die auch Gefangene der Staatsorgane machten.
Der Ausblick, der sich daraus ergibt, ist düster und zur Überprüfung unserer moralischen Aufrichtigkeit sollten wir die Ereignisse gedanklich zu uns spiegeln: Eine Milliardenindustrie von Kalifornien bis Potsdam Babelsberg produziert Filme und Serien, von Blockbustern bis hin zum Sonntags-Tatort, die uns exakt mit einer einzigen Gehirnwäsche-Botschaft versorgen: Menschen in Uniform sind die Garanten unseres Lebensglückes und Copkiller, nee nee, das geht gar nicht. Muss man viel Phantasie besitzen, um sich auszumalen, wie die Reaktion des Weißen Hauses aussehen würde, wenn an einem Tag knapp ein Dutzend amerikanische Polizisten er- und knapp 100 weitere angeschossen würden? Hätte die Bundesregierung eine bewaffnete Erstürmung des Kanzleramtes locker als legitimes Recht auf Meinungsäußerung gewertet?
Der hypothetische Selbstbezug zeigt, dass wir heuchlerisch und mit zweierlei Maß messen. Was bei uns undenkbar ist, wird von uns im Osten kalkuliert geschürt und befürwortet. Die Ereignisse vom 18. Februar sind für die nahe Zukunft der Ukraine Sprengstoff. Denn wenn Waffen und Mord ein probates Mittel sind, eigene Überzeugung zu artikulieren, wo ist und wer setzt die Grenze? Legitim ist der Einsatz gegen einen zwar gewählten, aber korrupten und betrügenden Präsidenten. Gekauft - so läuft das eben bei Revolutionen! Aber was ist mit den Menschen, im Süden und Osten des Landes, die ihre Zukunft nicht in einem prowestlichen Staatenbündnis sehen. Dürfen sie nun auch zunächst zum Knüppel und dann zur Kalaschnikow greifen, um sich in Kiew Gehör zu verschaffen oder um sich gegen Drohungen militanter Rechtsradikaler zu wehren? In Simferopol, der Hauptstadt der Krim, spielten die Menschen die Ereignisse von Kiew mit entgegengesetzten politischem Vorzeichen nach und besetzten zunächst das Parlament der Autonomen Republik; in Sewastopol stimmten die Menschen mit den Füßen ab, versammelten sich auf dem zentralen Nachimow-Platz und bestimmten einen eigenen Bürgermeister. Es ist bezeichnend, dass der Übergangspräsident Alexander Turtschinow diese Ereignisse und die von ihm und seiner Partei selbst ein paar Tage zuvor benutzten Methoden, nun als illegitim und Terror bezeichnet. Souverän – so die bekannte Formel von Carl Schmitt – ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. In Kiew ist es eine Regierung, deren Legitimität vor allem auf der Anerkennung durch den Westen beruht; auf der Krim ist es inzwischen das russische Militär, das sich auf eine breite wenn auch nicht grenzenlose Akzeptanz der Halbinselbewohner stützen kann. Beide Formen der Ordnungssetzung sind hoch hochproblematisch.
Wie von Beginn des Konfliktes an, greift Deutschland keineswegs neutral und helfend ein. Der diplomatische Erfolg der drei westlichen Emissäre unter Führung von Frank-Walter Steinmeier entpuppte sich schon nach Stunden als Pyrrhussieg. Kunststück: Wenn man lediglich Fürsprecher einer Seite zum Kompromiss bittet, und nicht auch mal eine Reise in den Heißkessel Sewastopol, oder nach Charkow oder Odessa unternimmt, dann ist klar, dass hier nur Scheinlösungen gefunden werden. Denn das Problem der Ukraine ist ja gar nicht, Volk gegen Janukowitsch. Den wollten ja ohnehin alle loswerden. Das explosive Gemisch ist die faktische Pattsituation der ideologischen Zonen, wo jede weitere Reibung eine Katastrophe entzünden kann.
An den Frontlinien der Ideologie, sehen wir Russland nicht als eine Art Partneropponent mit legitimen Interessen an, mit dem man sich trotz aller Unterschiede demokratisch verständigt. Vielmehr definieren wir die andere Seite, getreu der imperialen und neoliberalen Leitlinie, die der deutsche Wolfowitz, Joachim Gauck, herausgegeben hat, als Feind. Dass wir selbst diesen Feind durch unsere fehlende Bereitschaft der Kooperation und qua Definition geschaffen haben, entzieht sich komplett unserer Bewertung der Situation. So wie Russlands religiöser Nationalismus fundamentalistische Züge aufweist, verknotet sich unsere Ideologie immer mehr zum hermetischen und kriegerischen Block. Haben wir den 2. Irakkrieg mit dem Argument der US-amerikanischen Hegemonialphantasie abgelehnt, sind wir inzwischen komplett auf die Hardlinerposition der USA geschwenkt. Wir haben einseitig in den Ukraine-Konflikt eingegriffen und entschieden zur Eskalation der Gewalt beigetragen; wir haben eine hochproblematische Regierung in Kiew legitimiert, die gegen die Interessen großer Bevölkerungsteile des Landes handelt. Wenn wir uns in Deutschland weiter allein mit dem Design unserer Persönlichkeiten und unseres Alltages beschäftigen und Frieden weiter für etwas selbstverständliches ansehen wollen, ist es allerhöchste Zeit, dass wir uns Rechenschaft über die Methoden und Gründe unseres Handelns im Osten ablegen und schleunigst anfangen, Russland als europäischen Partner zu behandeln. Niemand hat welthistorisch so viel Schaden in der Ukraine angerichtet, wie Deutschland. Das sollte Mahnung sein - ansonsten wird die von uns geschürte Ent-grenzung der Gewalt sicherlich nicht an den Grenzen der Ukraine halt machen, sondern den Weg zurück in ihr Epizentrum finden.
#2, 30. Januar 2014
Vielleicht ist ja alles nur ein Übersetzungsfehler, ein sprachlicher und kultureller. Oder was meint Außenminister Frank Walter Steinmeier, wenn er den Ukrainischen Botschafter einbestellt und ihn ermahnt, dass die Regierung im Problemland am Dnjepr Freiheit und das Recht auf Meinungsäußerung tolerieren müsse? Hat er die folgende Szene im Sinn, in der Anhänger der „Freiheit“ in der Administration der Provinzstadt Winnyzja mit Knüppeln auf sich nicht wehrende Milizionäre eindreschen und sie krankenhausreif schlagen?
Freiheit heißt auf Ukrainisch „Swoboda“. Und „Swoboda“ ist in der Ukraine auch der Name der Partei, die a) bei den letzten Parlamentswahlen etwas über 10 Prozent der Stimmen erhielt, die b) seit Beginn der Proteste mit Vitali Klitschkos „Udar“ (Schlag) die Oppositionskoalition gegen Präsidenten Wiktor Janukowitsch auf dem Maidan bildet und die c) in ihrem eigenwilligen Geschichtsverständnis Stepan Bandera als Helden verehrt. Bandera, in Deutschland weniger bekannt, ist der ukrainische Nationalist, der bereits vor 1941 und dem Überfall auf die Sowjetunion mit der Wehrmacht kooperiert, in Lemberg ein Massaker an Kommunisten anrichtet und der in ganzen Dörfern im Westen des Landes eine brandschatzende Blutspur hinterlässt. Wenn Guido Knopp Wehrmachtspanzer bei grenzüberquerender Fahrt zeigt, von ukrainischen Frauen und Männern bejubelt, kann man davon ausgehen, dass hier „Banderovzi“, also Fans des Killers Bandera euphorisch winken; in der – wie sich herausstellte sehr kurzlebigen – Hoffnung, gemeinsam mit den Faschisten das Joch des Bolschewismus abzuschütteln. Wen wundert es daher, dass die geistige Schwesterpartei von „Swoboda“ in Deutschland die NPD ist; das Internet entbirgt zahlreiche Bilder von Funktionärstreffen der Ost- und Westrechtsradikalen auf Spitzenebene. Ein bizarrer Kreis zu Frank Walter Steinmeier schließt sich, der als Sozialdemokrat im eigenen Land sicherlich nicht mit den Neo-Nazis sympathisiert, der in der einseitigen Wahrnehmung des Konflikts in der Ukraine – wir hören hier allein von den Gewaltexzessen der regierungstreuen Berkut-Spezialeinheiten – aber plötzlich auch zum Sprachrohr einer in jeder Hinsicht inakzeptablen Bewegung wird.
Das Beispiel zeigt einmal mehr, dass in der Ukraine nicht nur Janukowitsch, der das Volk im Sinne der Oligarchie-Eliten regelrecht betrügt und nicht nur der russische Anspruch auf Einfluss auf den südlichen Nachbarn (mit seiner beträchtlichen Population ethnischer Russen), einen Problempol innerhalb des Gesamtkonfliktes bildet, sondern ebenso unsere Politik. In der russischen Presse bspw. mahnt Moskaus Außenminister Sergei Lawrow persistent an, der Westen solle nicht weiter Öl ins ukrainische Feuer gießen. Es ist exakt die gleiche Formulierung, mit der unsere Politiker den Kreml kritisieren. Die Situation erinnert an eine Psychiatrie, in der einem dritten Beobachter nicht klar ist, wer Arzt und Patient ist und sich das Bezugssystem der Realität allmählich auflöst, schreien sich zwei Personen wechselseitig an: Du Wahnsinniger! Fehlte der Mediator zwischen den Staaten, begannen in dieser Sackgasse der Argumente welthistorisch oft Kriege.
Wir Deutschen rufen in letzter Zeit auffällig oft ins Ausland “wahnsinnig” und gerieren uns als Weltmeister im Solidarisieren von Regierungskritikern, egal wo auf dem Planeten. Ob in Russland, wo wir unter anderem unser aufrechtes Mitgefühl für inhaftierte Ex-Milliardäre entdecken oder in den arabischen Ländern, wo wir Aufbegehrer unterstützen, bspw. in Ägypten gegen Husni Mubarak – der vom Westen erst Jahrzehnte als Freund und Sicherer der Ölhandelsstraßen sowie Partner im gemeinsamen Kampf gegen den militanten Islam geführt wurde und der dann, quasi über Nacht, erfahren musste wie es ist, von der transatlantischen Ethik-Agentur zum undemokratischen Diktator und Willkürherrscher heruntergestuft zu werden. Was ist das für ein seltsames Volk, das als globaler Moralpolizist auftritt, aber selbst nicht mehr auf die Straße geht? Ist bei uns denn alles im Lot, kein Grund mehr da, für oder gegen irgendwas zu protestieren (außer bspw. gegen einen zu teuren Bahnhof oder ein zu schließendes Kulturzentrum; beides tastest das politische Fundament nicht an)? Sind wir nun – nach einem düsteren historischen Kapitel – selbst der Maßstab aller politischen Zukunft? Die letzten Systemrüttler und Straßenkämpfer der 68er Generation haben wir mit ihren emanzipatorischen Impulsen im buchstäblichen Sinne zu Tode erinnert und in Talkshows zerquatscht, bis nur noch der Gestus des Quatschens übrig blieb. Eine neue gesellschaftliche Vision ist so fern wie noch nie und das einzige Begehren des Volkes scheint das Verbleiben im Trott des Mittelmaßes.
Vielleicht haben wir deshalb soetwas wie eine romantische Sehnsucht danach, auch einmal zu protestieren; und weil wir das selbst eigentlich nicht machen wollen, verbrüdern wir uns stellvertretend mit anderen Kritikern und deligieren damit auch gleich, in einer Art postmoderner Sicherheitsrochade, jede Art des Risikos. Was, wenn unsere Solidarität mit Pussy Riot weniger etwas über bestimmte geteilte ästhetische Positionen, einen gemeinsamen Musikgeschmack oder – sei´s drum – auch der Werte aussagt, sondern eher etwas über unsere Feigheit? Denn egal, ob man dem (NGO-Formel)-Denken von Tolokonnikowa & Co zustimmt oder nicht: die Frauen riskieren etwas und sind notfalls bereit, Sanktionen hinzunehmen oder im Gefängnis zu sitzen. Vor allem das, neben großer Analysemüdigkeit, wollen wir nicht; aber sofort schrillen unsere sensibel kallibrierten humanitären Alarmglocken, wenn in der Ukraine im Eilgang Gesetze erlassen werden (inzwischen auch genauso eilig wieder zurückgenommen), die sich auf das Versammlungsrecht auswirken. Wir, die Nachfahren der Leidgeprüften der Geschichte, wissen, wie die Konsequenz solcher Gesetze zu nennen ist: Diktatur und Totalitarismus. Und wir sagen das umso lauter, je mehr uns klar ist, dass große Teile von Janukowitschs Panik-Erlassen bei uns hingenommene Praxis sind. Warum zieht unser Volk der Rechtschaffenden, der Demokratieliebenden nicht auf die Straße und prangert an, was wir im Ausland doch so gut als Unrecht dedektieren? Warum wird der Deutsche Botschafter in Kiew nicht einbestellt und ihm eingehend erläutert, dass man auch in Deutschland als Minderheitspartei das Recht haben sollte, Ministerien zu besetzen? Die Bannmeile übrigens, die in Berlin jede Form von Demonstration und Protest in Parlaments- oder Regierungsnähe verbietet, reichte ab 1933 aus Angst vor unschönen Szenarien bis über die Volksbühne und den roten Bülow-, später Horst Wessel Platz hinaus. Es sind revolutionsunverdächtige Gestalten wie Matthias Reim oder Scooter, die von den Ämtern dieser Stadt die Genehmigung erhalten, am Brandenburger Tor in Fühlweite des Kanzleramtes aufs Volk einzuwirken. Für die doppelte Figur aus Verlogenheit und Feigheit, die unser gutes politisches Bewußtsein ausmacht, kann man sich vor jedem Ukrainer auf dem Maidan, der eben ähnlich wie Pussy Riot mit seinem Körper für etwas einsteht, nur schämen.
Um nicht mit hochrotem Kopf und Buratinonase den Janukowtisch-Gegnern in Kiew gegenüberzutreten, sollten wir offen über die Motive unseres politischen Handelns sprechen: In der Ukraine liegt das Angestelltengehalt bei ca. 10,- Euro am Tag; Kranken- und Rentenversicherung sind faktisch nicht existent und die Last des kommunistischen Gespenstes „Lohnnebenkosten“ ist für einen Unternehmer hinter Czernowitz damit praktisch nicht mehr wahrnehmbar. Und nicht nur die Bukowina sondern auch das industrialisierte Schwergewicht Donezk-Becken liegt unter dem Gesichtspunkt billiger Transportwege deutlich günstiger als Schwellenländer jenseits der Seidenstraße. Zudem: der ukrainische Staat ist komplett pleite – die Staatsbank bspw. zahlt ihren Angestellten seit Monaten nicht nur sehr unregelmäßig Lohn, sondern zwingt sie bei Androhung von Kündigung Anleihen zu zeichnen, also Gespartes wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen abzugeben. Schande über den, der da Böses denkt. Aber künftiger Einfluss und die Erschließung liberaler Wirtschaftsterritorien ist gerade zum Ramschpreis im Osten zu haben. Vergünstigt durch die Tatsache, dass eine erhebliche Anzahl der Ukrainer auf dem Maidan – die ja nicht wie im Februar oder Oktober 1917 für eine neue politische Selbstorganisation und Selbstexploitation des eigenen Landes kämpfen – durchaus bereits sind, die Spielregeln des Westens zu übernehmen. Ein Blick vom Unabhängigkeitsplatz in Kiew nach Athen könnte Auskunft darüber geben, wie erpressbar ein Land im Anschluss an staatliche Finanzhilfen ist und wie es praktisch die Hoheit über sämtliche Strukturentscheidungen in den eigenen nationalen Grenzen verliert. In Griechenland ist von Freiheit keine Rede mehr, sondern allein von Rückzahlung.
Vielleicht können wir und die Ukrainer gemeinsam unser Denken am Beispiel Afrika schulen. Historiker und Philosophen aus Ghana und Togo, die sich intensiv mit der – auch deutschen – kolonialen Vergangenheit beschäftigen, konstatieren klar, dass der Begriff Postkolonialismus die Situation in ihren Ländern nicht trifft. Zwar sind die Menschen formal frei, der fremdländische Einfluss aber, habe nie aufgehört. Die Staaten, die buchstäblich ihre Ketten abgeworfen haben, sehen sehr genau ihr Verhältnis zum ehemaligen Herren: die in der Subsahara aktiven Banken und Unternehmen, haben ihre Eigner in den transatlantischen Zentren. Die Afrikaner selbst, ohne große politische Befugnis, sind einerseits Rohstofflieferant, andererseits Warenimporteur, einerseits zu Niedriglöhnen arbeitender Produzent, andererseits zu global üblichen Preisen kaufender Konsument. Sie stellen das Reserveheer von ausgebildeten Arbeitskräften (und Sportlern), die in den Westen abwandern und im eigenen Land ein Spezialistenvakuum hinterlassen. Die jungen Mitglieder der EU, Bulgarien und Rumänien, spüren gerade sehr genau solche Auswirkungen des Beitritts, die Theoretiker in Afrika schon lange offen diskutieren und beschreiben.
In unserem Verhältnis zur Ex-Kolonie Ukraine aber, wollen wir soweit nicht gehen und an Szenarien wie in Afrika oder an die Nebenwirkungen der EU-Ost-Erweiterung erinnern. Wir handeln vielmehr so, wie in dem Film „Matrix“, identifizieren uns mit dem Helden Neo, nachdem wir die rote Kugel geschluckt haben, und nun im Besitz des Blickes für die Wahrheit sind. Was aber, wenn die Realität keine solche Pillenwahrheit kennt? Und wir also im Osten nicht immer wieder aufs Neue neutral analysierend, sondern ehe wie auf Drogen, interessengeleitet und konfliktverschärfend eingreifen? Irgendwie bekommt man aktuell eine dunkle Ahnung davon, dass der nächste deutsche Militarisms nicht im Namen einer Überrasse oder des Herrenmenschen geschehen wird, sondern allein im Geiste des Guten.
#1, 20. Januar 2014
Um es vorweg zu sagen: es gibt nichts Positives zu berichten über Wiktor Janukowitsch, Präsident des zweitgrößten Landes Europas, der Ukraine. Es gibt tausend gute Gründe, Unmut gegen dessen Politik im Zentrum Kiews und auf der Straße vorzutragen. Das gescheiterte Assoziationsabkommen mit dem Westen ist nur einer davon, vielleicht nicht der Wichtigste. Es geht auch nicht darum noch einmal zu erzählen, dass die Ukraine tief gespalten ist und dass wir uns bei den vom Maidan gelieferten TV-Bildern für jeden Fahne schwenkenden Demonstranten einen anderen Ukrainer denken müssen, der zu Hause erzürnt in der Küche sitzt und über den aktuellen Protest flucht. Das prowestliche und das prorussische Lager sind mit nahezu exakt 50 Prozent von einander getrennt; die Parität markiert die große Gefahr in einem Land mit hunderttausenden Polizisten, einem ukrainischen Heer und eben auch der russischen Flotte, die auf der Krim nicht nur ein paar Kreuzer und Fregatten konzentriert, sondern ebenso Artillerie und schweres Gefechtsgerät. Momentan zeichnet sich für diese inneren, äußeren und ausländischen Kampforgane nur ein Feind ab: das eigene Volk.
Um was es hier geht, sind wir, unsere Meinung, unsere Geschichte, unsere gegenwärtige Politik. Zumindest die Bundesregierung – als Leittier der EU – hat sich, ohne ein öffentliches Abwägen von Argumenten, in dem Konflikt klar positioniert und produziert eindeutige mediale Gesten; beispielsweise durch den Besuch von Ex-Außenminister Westerwelle auf dem Unabhängigkeitsplatz, zwischen den Protestlern und beim Händeschütteln mit Box-Weltmeister Vitali Klitschko. Die Selbstverständlichkeit und Deutlichkeit, mit der Deutschland seine Haltung vorträgt verwundert – zunächst angesichts der Geschichte: Ein maßgeblicher Teil des 2. Weltkrieges gegen die Sowjetunion wird auf ukrainischem Boden ausgetragen. Nicht nur die Wehrmacht und die Heeresgruppe Süd, unter anderem unter dem Kommando des Generalfeldmarschalls Erich von Manstein, auch das Sonderkommando D unter der Leitung des SS-Generals Otto Ohlendorf zeichnen sich für Millionen kombattanter Opfer, hunderttausendfachen Mord an Zivilisten sowie zahlreiche Pogrome verantwortlich; während der Okkupationszeit werden zehntausende Menschen aufgrund von Verstößen gegen die Besatzergesetze standesrechtlich erschossen, im ganzen Land kommt es zur millionenfachen Zwangsrekrutierung für Arbeitsdienste im Reich und zur Abfuhr von Nahrungsmitteln aus der „Kornkammer“ Europas nach Deutschland.
Weniger bekannt ist, dass bereits etwas über 20 Jahre vor der Operation Barbarossa das Deutsche Reich die Ukraine okkupierte. Die Intervention von 1918 findet in einem geopolitischen Kontext statt, indem das osteuropäische Land – ähnlich heute – als Spielball zwischen die Interessen Russlands und der Mittelmächte bzw. West-Europas gerät. Denn zwar gesteht damals Deutschland Russland ein ihm gegensätzliches politisches System zu: den Kommunismus. Doch ist dieser Deal klar an Bedingungen gebunden. Berlin unterstützt Lenin und die Oktoberrevolution, damit der Revolutionsführer im Gegenzug einen Friedensvertrag unterschreibt, deutsche Truppen an der Ostfront entbunden und nach Frankreich ins Feld geschickt werden können. Die Ukraine hat kein solches „Verhandlungsargument“ gegenüber dem Westen. Mit der Unabhängigkeit des Landes gründet sich 1917 in Kiew, ähnlich wie nach der Februarrevolution in Petrograd, eine Rada bestehend hauptsächlich aus gemäßigten Sozialisten. Sie setzen recht zügig eine Landreform durch, die unter anderem den deutschen (und polnischen) Großgrundbesitz gefährdet. Auch um der bolschewistischen Expansion aus Russland entgegenzutreten fördert die deutsche Seite die reaktionäre Bewegung; der adlige Pawlo Skoropadskyj wird in Kiew als Hetman abhängig von Deutschen Gnaden eingesetzt. Die Okkupation und die anschließende Förderung eines in der Bevölkerung verhassten Regimes sichern deutsche Wirtschaftsinteressen und schaffen den gewünschten politischen Korridor, der durch das kommunistische „Zugeständnis“ gegenüber Russland opportun wurde. (Michail Bulgakows Theatertext „Weiße Garde“, angeblich Stalins Lieblingsstück, erzählt genau von diesem für die Ukraine ereignisreichen Jahr.)
Wichtig für die Invasion von 1918 ist dabei die Kontinuität einer kolonialen, expansiven Logik, übernommen aus dem 19. Jahrhundert. Denn die Besetzung der Ukraine unter der militärischen Leitung von Wilhelm Groener ist – nachdem das Deutsche Kaiserreich mit Beginn des 1. Weltkrieges Teile seines afrikanischen Kolonialbesitzes, bspw. Togoland, verloren hat – die erste deutsche Kolonialnahme auf europäischem Festland. Ähnlich wie vorher in Afrika (Lüderitzbucht, Voltaregion, Kamerun etc.) geht es um eine Herrschaft zum Schutz deutscher Interessen und Geschäftsleute; bspw. 60 Prozent der Nutzfläche der Krim sind 1918 in der Hand deutscher Kolonisten und der Schriftsteller Alexei Tolstoi berichtet bereits lange vor Hitlers Überfall auf die Sowjetunion von dem Fernziel der Reichsregierung, der Kontrolle des Schwarz-Meer-Raumes bis hin zum ölreichen Kaukasus. Aber auch Plünderung spielte schon eine entscheidende Rolle: Groener war, bevor er die Oberste Heeresleitung übernimmt, Chef des Reichsernährungsamtes und lässt nach der Einnahme Kiews mit der Eisenbahn Getreide nach Deutschland liefern – und wendet so eine Hungerkatastrophe zwischen Berlin und München ab.
Zweimal haben unsere deutschen Vorfahren in den letzten 100 Jahren die Ukraine – der administrative Status des Landes lautete auch zwischen 1941 und 1944: Kolonie – okkupiert, ein Blutbad angerichtet und die Ressourcen des Landes zu unserem nationalen Nutzen bis zu einem skeletthaften Rest ausgebeutet. Zwar leiten wir in der offiziellen, politisch-korrekten Lesart aus den Schreckenstaten in der Vergangenheit eine Handlungsoption für die Gegenwart ab. Egal ob von Wirtschaftsinteressen – die sich jenseits des Symbolischen und des Moralischen ihre Wirkungskanäle suchen – unterminiert, pflegen wir ein intensives Opfer-Täter Erinnerungsverhältnis, was sich in solchen Beziehungen wie Frankreich-Deutschland, England-Deutschland, Israel-Deutschland zeigt. Eine von Deutscher Seite direkt vorgetragene Einmischung in Israelische Politik ist auf der Folie der Vergangenheit undenkbar. Obwohl Holocaust und Vernichtungskrieg (27 Millionen sowjetische Kriegstote) in der Naziideologie dem gleichen Überlegenheitsquell entstammen, gilt für die Ukraine ein anderer Maßstab und wir überspringen offizielle Respektrituale des politisch Korrekten. Wie einem kleinen Kind, legen wir den Arm um die Schulter des Landes und spenden autoritäre, wegweisende Ratschläge.
Das markiert, unabhängig davon, ob die Position der Demonstranten im Zentrum Kiews tatsächlich unsere Unterstützung verdient oder nicht, einen weiteren historischen Bruch und lässt ein ideologisches Symptom aufscheinen. Das Vorspiel für veränderte Ableitungen aus der eigenen Geschichte, lieferte die deutsche Beteiligung an der Intervention im Balkan und der komplett sinnlose Einsatz in Afghanistan. (Sinnlos, weil die Bundeswehr 2002 ihre Stellungen in Kundus und Masar-e Scharif und damit im friedlichen, terror- und talibanfreien Norden des Landes bezogen hat. Die reine Präsenz der westlichen Streitmacht hat jedoch Taliban und Terror angezogen und die Bundeswehr rückt nun, nach einem über zehnjährigen und 14 Milliarden Euro verschlingenden Selbsterhaltungsexperiment aus Afghanistan ab und hinterlässt einen vormals friedlichen Landstrich im Chaos und unter dem tendenziellen Einfluss der Taliban.) Bei dem Kampfeinsatz im Hindukusch ging es „lediglich“ um das Versenden eines Invasionsheeres, das partikular in ein Land eingedrungen ist.
In der Ukraine wird eine nicht minder effektive Waffe zum Einsatz gebracht, die uns alle als Wertekrieger einbindet und mit der wir uns mental an der osteuropäischen Front positionieren.
Zwar ereigneten sich bereits die „heißen“ Interventionen des Westens der letzten 20 Jahre – teilweise von der UNO legitimiert – im Namen der Freiheit und Menschrechte. Jedoch wurde dieser Versuch der Legitimation oft als Heuchelei und Tarnkappe durchschaut und die Kriege, die natürlich trotzdem stattfanden, von den Bevölkerungen der Invasionsländer weitestgehend abgelehnt. Damals wie aktuell lautet das befürwortende Argument der Einflussnahme durch die deutsche Seite: Wir kennen die Geschichte und unsere schlimme Rolle darin; heute aber haben wir uns zum Guten gewandelt, haben die Gültigkeit universeller Rechte erkannt und wissen, wo in der Welt die Bösen – egal ob in Europa, Asien oder Süd-Amerika – diese missachten. Die 20-Uhr TV-Nachrichten zementieren das dichotomische Raster, mit dem das Übel von uns weg auf die Seite der Anderen rückt. Im unbezweifelten Bewusstsein das Richtige zu tun, arrondiert der Apparat des europäischen Hauses mit der Führungskraft Deutschland nun sein Territorium im Osten. Stehen im Süden der Festung Europas überwacht durch die FRONTEX-RABITs (die Grenzkrieger der EU, quasi die westeuropäischen Kosaken) große Mauern und Zäune, um Flüchtlinge aus den einst kolonialen Gebieten der Subsahara abzuhalten, wird nun über Galizien und Lemberg hinweg die Handelskampfzone im Namen der Freiheit ausgedehnt. Weil wir diesmal nicht direkt mit Mord und Verbluten drohen, ist es für uns nicht nachzuvollziehen, warum jemand einen Pakt mit uns ausschlägt, haben wir, die Guten, doch aktuell offenbar allein das Lebensglück von Individuen im Sinn! Expansion und die Sicherung eigener Interessen verorten wir nun beim Anderen – nicht bei uns selbst. Aber ist es nicht in der Wachstumslogik unseres Wirtschaftssystems begründet, dass immer wieder neue Absatz- und Produktionsmärkte erschlossen werden müssen? Ist Ausdehnung – gleichermaßen von Betrieben und Handelsgrenzen – nicht genuin und konstitutiver Bestandteil dieses Systems, egal ob mit Waffengewalt oder Ideologie durchgesetzt?
Wenn es allein um das Argument der Freiheit ginge, könnte Europa sehr einfach ein Signal setzen und gleich heute die rigide Visapolitik ändern, die es den Ukrainern nahezu verunmöglicht, den Westen und unsere humane Wertewelt in einer Art touristischem Schnupperkurs zu besuchen. Aber in der Logik der aktuellen Visaregelung sind die Ukrainer – wie einst Rumänen und Bulgaren, bevor sie der EU beigetreten sind – in erster Linie Kriminelle und Prostituierte, die die abendländische Grundordnung gefährden. Sie werden für die EU und die Behörde am Werderschen Markt erst zu freiheitsliebenden Menschen, wo die materielle Basis der Ideologie von Freiheit zum Tragen kommt, Territorien liberalen Wirtschaftens erschlossen (dafür aber nicht auch soziale Verantwortung, wie in den südosteuropäischen EU-Staaten, übernommen) und geopolitischer Einfluss gegenüber Russland geltend gemacht werden sollen.
Die Situation heute erinnert an 1918. Wieder verfügt Moskau über ein von uns verschiedenes politisches System. Hier transeuropäischer Wirtschaftsliberalismus und die hegemoniale Ideologie der Freiheit, dort ein nationaler Öl- und Gaskapitalismus in fundamentalistisch-orthodoxem Gewand. Und wieder markiert die Ukraine den Korridor, um den gerungen und wo der eigentlich europäische Riss abgebildet wird. Das osteuropäische Land ist so von ideologischen Schützengräben durchzogen, in denen wir – genau wie die russische Seite – narzisstisch im überhöhten Glauben an die Richtigkeit des eigenen Systems, Stellung beziehen. Eine unbewusste und unbedingte Konfliktdisposition, für die gerade in seiner 100sten Jährung der so intensiv erinnerte Beginn des 1. Weltkrieges guten Anschauungsunterricht liefert. Obwohl als Hauptargument immer wieder ins mediale Zentrum gestellt, dürften die Menschen in der Ukraine beiden Seiten mehr oder weniger egal sein. Und es ist fraglich, ob die Verbindung des Protestes gegen Janukowitsch und sein korruptes, nepotistisches System mit der Lagerzugehörigkeit zum Westen wirklich sinnvoll ist – anstatt auf eine emanzipatorische Politik und oligarchiekritisch auf die Ressourcen des eigenen Landes zu setzen. (Die Utopie der Protestler auf dem Maidan übrigens und ihre Affirmation Westeuropas artikuliert sich im buchstäblich Verborgenen. Denn die Demonstrationen mit ihren archaischen Symbolen von Barrikaden und wärmendem Feuer – all das findet auf einem Asphalt statt, der das Dach einer riesigen unteririschen Shoppingmall bildet, mit dem Namen „Globus.“ Die Mehrheit der Bevölkerung Polens, Bulgariens und Rumäniens wollte unter dieses Dach. Im östlichen Präzedenzfall Ukraine steht es landesintern unentschieden.)
Kurzfristig wird sich das heterogene Gegenlager durch den Protest verbünden und die Ausgangsposition für den alles andere als geliebten Janukowitsch für die nächsten Präsidentenwahlen deutlich verbessern. Aber noch weniger als von Janukowitsch, fühlen sich die Hälfte der Ukrainer eben von den Versprechungen des Westens angezogen. Und das ist für uns, die moralisch entlastete Guido-Knopp Jugend, schwer nachvollziehbar; nichts scheint uns unmöglicher und unverständlicher, als der Kern der Demokratie: das Anerkennen der Legitimität einer von uns verschiedenen Position. (Umgekehrt verhindert unsere so tiefe wie blinde gymnasiale Liebe für die literarischen Exkursionen der russischen Seele, bspw Dostojewskis aktuell im Kreml-Umfeld viel zitierte Apologie der Orthodoxie und seine Konzeption des Panslawismus, sie als das zu sehen, was sie sind: eine offene, an uns gerichtete kulturelle Kriegserklärung!) Dass wir von einem „Wunschkandidaten“ in der Ukraine sprechen, sagt etwas über uns, unser Begehren und die Grenze unserer Toleranz aus.
Dieser Wunsch wiegt, unter invasiv-strategischen Gesichtspunkten, als Waffe die ausländischen russischen Kräfte in der Ukraine und die Flotte mit ihrem Artillerieanhang in Sewastopol locker auf. Wir müssen uns klar machen: So, wie wir bspw. im Irak die Motive des militärischen Handelns als Heuchelei einstuften, bewerten Menschen in der Ukraine die Ideologietarnkappe, unter der unsere historische Rolle, die Kontinuität invasiven Denkens und liberale Handelsinteressen versteckt werden. Für uns markieren die Triebkräfte unseres Engagements im Osten einen blinden Fleck bzw. die Nasenspitze, der dieses Denkzeichen gewidmet ist und an die wir uns fassen sollten, bevor wir uns wieder uneingeschränkt (und eskalierend) solidarisieren oder mit dem Finger allein auf Andere zeigen.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
1.
Als ich vor ein paar Wochen im ICE von Nordrhein-Westfalen nach Berlin unterwegs war, wurde mir auf einmal klar, dass Heiner Müllers Metapher von der „Grammatik der Erdbeben“ auch Ereignisse wie den Einsturz der Türme 2001 oder den Crash 2008, zu denen er sich nicht mehr persönlich äußern konnte, inkludiert. Die Gegenmacht der Kunst meldet sich per Funkspruch aus dem Orbit, wo jener Engel kreist, für den die Katastrophe das natürliche Element darstellt, und der müllert: „Mein Himmel ist der Abgrund von morgen!“ Eine Stimme, die überall wo die globale Konsensmaschine von Betroffenheit und Krisenangst geschüttelt wird, die Erschütterung des übermächtigen Systems und seiner neoliberalen Einbahnstraße feiert. Vielleicht ist diese Botschaft für alle, die sich intensiver mit dem Dramatiker beschäftigen, eine Banalität, trotzdem stellt sich die Frage, wie dieser poetische Überschuß in Hinblick auf Müllers Generalthema die Geschichte gedacht werden kann.
Eric Hobsbawn hat in seinem Essay über das kurze „Jahrhundert der Extreme“ (1914 - 1989) festgehalten, dass auf einen Schlag die Bedeutung der Geschichte und mit ihr ein Großteil der historischen Positionen annulliert scheinen: „Am Ende des 20. Jahrhunderts war es zum erstenmal möglich, sich eine Welt vorzustellen, in der die Vergangenheit (auch die Vergangenheit der Gegenwart) keine Rolle mehr spielt, weil die alten Karten und Pläne, die die Menschen und die Gesellschaften durch das Leben geleitet haben, nicht mehr den Landschaften entsprachen, durch die wir uns bewegten, und nicht mehr das Meer, über das wir segelten. Eine Welt, in der wir nicht mehr wissen können, wohin uns unsere Reise führt, ja nicht einmal, wohin sie uns führen sollte.“ An vergleichbare Überlegungen knüpfte Müller im öffentlichen Gespräch mehrfach an, indem er sich nach 1989 auf die Nietzsche Formel: „Wir brauchen ein neues Wozu!“ berief. Eine nachvollziehbare Postion, doch sprechen seine Texte eine andere, eine radikalere Sprache.
Die Trägerin des Friedenspeises des Deutschen Buchhandels Swetlana Alexijewitsch kommt angesichts des Reaktorunglücke von Tschernobyl zu dem Schluß, dass wenn bislang „der Krieg das Maß des Schreckens“ darstellte, jetzt die „Geschichte der Katastrophen“ angebrochen ist. Sie erfasst damit, nach dem Alphabet des Zufalls orchestrierte Unfälle wie Tschernobyl 86 oder Fukushima 2011, die für Ewigkeiten das Schicksal ganzer Landstriche entscheiden. Ihre geschichtsphilosophische These erhärtet sie an der Analogie, dass im endlosen Zeitalter der Kriege die Kombination von Ortschaften zusammen mit einer Jahreszahl eine blutige Völkerschlacht aufrief, während im frisch angebrochenem Zeitalter der Katastrophen sich diese Verbindung als Bezeichnung für die kontinuierlichen Waterloos des wissenschaftlich technischen Komplexes eingebürgert hat.
2.
Obwohl mir die Nähe von Swetlana Alexijewitschs These und Heiner Müllers Sprachbild schlüssig erschien, das Zeitalter, dass sich Geschichte nannte vorläufig vorüber scheint, und wir uns in einen Seitenarm der Zeit oder den Blinddarm der Geschichte verirrt haben, versuchte ich vergeblich eines Spannungsbogens zwischen den beiden Polen habhaft zu werden. Addierte ich weitere aufsehenerregende Eruptionen wie Bhopal 1984, das Tankerunglück an der Südküste Alaskas 1989, die Ölkatastrophe im Golf von Mexico 2010 dazu, kam ich keinen Schritt voran. Ebenso wenn ich neben diesen lautstarken Explosionen – Klaus Theweleit titelt sein Buch über 9/11 mit „Der Knall“ – zugleich andere viel stiller, geradezu lautlose in Betracht zog und textete: „Die Erdgeschichte verzeichnet mehrere tiefe Zäsuren in Form gewaltiger Artensterben. Wir befinden uns inmitten des Heftigsten. Noch nie löschte eine Gegenwart soviele genetische Codes in so kurzer Zeit. Die Furie des Verschwindens wütet on the long run, ohne medial wirksame Bilder freizusetzen. Ähnlich wie die Aktivität der NSA. Nur die Erhebungen der Statistik lassen Rückschlüsse auf das Drama zu, dass sich vor unserer Nase abspielt und vielleicht irgendwann als das folgenreichste Einschnitte im Hier und Jetzt klassifiziert wird.“
Die Verklammerung der beiden Positionen, die mit der Katastophe doch einen gemeinsamen Nenner aufweisen, wollte keinen Funken freisetzen. Ich ging daher nochmal einen Schritt zurück und fokussierte mich statt auf das Katastrophische auf den Terminus der Grammatik. Grammatik hat etwas mit Sprache, Konjugation, Hervorbringung von Bedeutung und dessen Regeln zu tun. Doch ob sich einer Grammatik der Erdbeben tatsächlich Sinn entnehmen lässt, schien mir fraglich. Also schrieb ich: „Die Ereignisse 2001 und 2008 sind zwei Bausteine eines über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte verstreuten Mosaiks, das niemand mehr zusammensetzen wird. Splitter eines blinden Spiegels. ‚Wir sterben alle unerkannt!’, schreibt Honoré de Balzac bezogen auf die Menschen seiner Zeit und nicht auf Epochen.
2001 oder 2008 – zwei zusammenhanglose bzw. unabhängige Konjugationen jener von Heiner Müller apostrophierten seismischen Grammatik, die sich nicht zu einer verständlichen Sprache fügen will, seitdem uns die Zukunft abhanden gekommen ist. Mit einer nicht zu entziffernden Ecriture verfasste Bruchstücke eines asymmetrischen Vokabulars, bei dessen Deklination ein Ruck die Welt durchläuft mit mal mehr, mal weniger folgenschweren Richtungswechseln.“
Zwar ließ sich auf diese Weise mittels Müllers Metapher eine unberechenbare, aber enorm wirksame Größe in den Blick nehmen, aber das Entscheidende schien mir noch immer nicht auf den Punkt gebracht. Wo Hegel, Marx & Co. geschichtliche Bewegungsgesetze nachwiesen, ähnelt die Flugbahn von Müllers Engel mehr der einer Fliege und deren chaotischen Mustern. Sein Verhalten lässt sich kaum vorhersagen und nicht in Formeln, Termini oder Episteme bannen.
So what? Für die Erkenntnis, dass sich Fliegen von Drohnen unterscheiden, bedarf es kaum einer solch angestrengter Metaphorik, mag man sie von meiner Seite auch rhetorisch noch so großtönend mit Derridas „gespenstischer Geschichte“, Byung-Chul Hans tellurischen „Burn Outs“, oder der von Friedrich Kittlers postulierten „Allmacht der Datensätze“ aufgerüstet werden.
3.
Erst durch eine fiese Frage von Thomas Martin, bekam ich die Hörner des Stiers doch noch zu fassen. Die übereinstimmenden Befundn von Alexijewitsch und Müller, liegen in der Diagnose, dass Katastrophen das traditionelle Bild von Geschichte perforieren, ergänzen, ersetzen. Wurden die Brüche und Einschnitte der Geschichte bislang in Revolutionen und Systemwechseln erfasst und wurden sie von Mächten wie Krieg, Nation, Staat und vergleichbaren Eminenzen signiert, kommt der Katastrophe schon aufgrund ihrer Ausmaße im Global Village ebenfalls Subjektstatus zu.
Zweifelsohne hat es schon immer Katastrophen in Gestalt von Seebeben, Vulkanausbrüchen, Seuchen, Schuldenkrisen, Verrat von Staatsgeheimnissen etc. gegeben, aber erst unter den gegenwärtigen technologischen Bedingungen gefährden sie nachhaltig, wie das Beispiel Edward Snowden zeigt, die Mikrophysik der Macht. Vor diesem Horizont wird zugleich das Anarchische an Müllers Formulierung „Grammatik der Erdbeben“ im Arsenal politischer Strategien sichtbar. Es ist die Perspektive von Brechts Anarchisten Fatzer. Ein Votum für den Terrorismus des Systems, auf seine selbstzerstörerischen Erschütterungen zu setzen. Katastrophen, die das auf Eigenblutdoping angewiesene System selbst hervorbringt. Während der Bürger in Müller über ein neues Wozu rätselt, akklamiert sein Fatzeranteil jeden Kollaps des Systems, offenbar seine einzige Hoffnung, dass die übermächtig erscheinende neoliberale Einbahnstraße jemals wieder verlassen wird. Mit dem Schlußsatz setzte ich dem Text beim letzten Versuch einen leuchtenden Feenhut auf, der auch hier nicht fehlen soll: „Anarchisches Zeugs von einem torkelnden Planeten, der sich mit Ordnungen blendet“.
Das ist nun natürlich alles viel zu lang, kann ich aber nicht mehr ändern. Man möge mirs verzeihen – jetzt, wo Heiner auch schon 85 ist.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
„Wie bannt die Literatur das Gespenst des Kapitals?“ So hieß es kürzlich überaus optimistisch in Anlehnung an ein Buch des Philosophen Joseph Vogl. Es scheint mir doch eher umgekehrt zu sein und ganz und gar ohne Fragezeichen. Oder wie die Schriftstellerin Taiye Selasi in einem Interview sagte: Einige Menschen haben mich gefragt, warum ich nach der Universität als Fernsehproduzentin gearbeitet habe und nicht sofort als Schriftstellerin. Ganz einfach. Ich musste Geld verdienen.“ Sind nicht gerade wir Künstlerinnen und Künstler Teil der neoliberalen Paktes, ohne dass wir es wollten, nämlich sein bevorzugtes Rolemodel? Ein Mindestlohn von 8,50 Euro? Für die meisten Künstlerinnen und Künstler ein Wunschtraum.
Ende der 90er Jahre, als der Contract Social brüchig geworden und auch nicht mehr notwendig schien – war doch der Gegenblock, dem man die soziale Überlegenheit des Kapitalismus beständig beweisen musste, längst in sich zusammengebrochen –, geriet ein Modell in den Focus der Ökonomie, das sich seit Jahrhunderten bewährt hatte, das des freien Künstlers. Ein Werktätiger im besten Sinne des Wortes, der ohne Urlaubsanspruch, dreizehntes Monatsgehalt, 35-Stunden-Woche und eine genügende Absicherung im Alter trotzdem weitestgehend klaglos, überaus flexibel und ohne dem Staat auf der Tasche zu liegen, seiner Arbeit nachgeht. Künstler heißt im besten Falle, produktiv zu sein bis ins hohe Alter und danach hoch dekoriert zu sterben. Manche schaffen es sogar noch, ohne alle Absicherungen Nachwuchs großzuziehen, der dann oft, risikobereit und das schlechte Beispiel der Eltern vor Augen, in die Wirtschaft geht. Warum, fragte man sich in den ökonomischen think tanks, ließe sich dieses Modell nicht auch auf Postboten, Friseurinnen, Eisverkäufer und Sicherheitspersonal übertragen? In Form z.B. von Werkverträgen, die den Arbeitgeber zu nichts verpflichten als zur Zahlung eines vereinbarten Lohns für eine im Zeitraum x zu erledigende Arbeit? Waren Friseurinnen nicht auch sowieso Künstlerinnen, die mit voller Absicht ihren Wunschberuf ergriffen hatten, von dem doch klar war, dass er nichts bringen würde, bis auf ein bisschen Trinkgeld? War überhaupt nicht jeder Mensch ein Künstler? Kritiker warfen den Ökonomen Zynismus vor, es fehle doch bei Friseurin, Postbote und Securityman das Entscheidende, das zum Glück des Künstlers beiträgt: Der Mehrwert, zwar in unsicheren Verhältnissen, aber doch frei und selbstbestimmt seinen Talenten nachgehen zu können. Inzwischen hat aber auch der ideelle Wert der Arbeit des Künstlers zu schwinden begonnen. Mit Hilfe der neuen Technologien und aus Mangel an Alternativen hat die Anzahl der Künstler sich vermehrt, das Geld für die Kultur aber, die nicht zu den Pflichtaufgaben des von den Finanzmärkten erpressten Staates gehört, dagegen nicht. Inzwischen sind die meisten von uns Teil einer Armee kreativer Dienstleister. Immer auf der Suche nach neuen, förderbaren Projekten, Verträgen, Vorschüssen, mit denen wir unsere angehäuften Schulden bezahlen. Teil einer sogenannten Kreativwirtschaft, die auch immer mal wieder in Projekten ihre eigene Rolle wie in einem Spiegelsaal sitzend hinterfragt, ohne messbare Konsequenzen bis hin zum Zynismus. So ungefähr, wie empört zu sein über die unmenschlichen Arbeitsbedingungen von Näherinnen in Bangladesh, in Klamotten, die von Näherinnen unter unmenschlichen Bedingungen in Bangladesh hergestellt sind. Es ist ungefähr so ein Gefühl, wie in einem der Jobs, die ich gemacht habe, um zu überleben. Anfang der 90er Jahre spielte ich die Hexe auf einem Mittelaltermarkt. Eines Tages machte der für das Schüren des Feuers Verantwortliche einen Fehler und ich stand, angebunden an einem Pfahl, mitten in den Flammen. Ich schrie, aber je lauter ich wurde, desto mehr johlten die Leute. Sie wollten eine Hexe brennen sehen und sie sollte ordentlich schreien dabei. Zum Glück war es nur ein Strohfeuer und ich kam mit Verbrennungen 2. Grades davon. Der Veranstalter war nicht versichert. Sie engagierten danach eine Hexe aus Osteuropa.
Am Ende bleibt „Angst, dass es nicht gelingt, neue Verbindungen zu knüpfen oder zumindestens die alten zu erhalten, also marginalisiert und ausgeschlossen zu werden, und die Sorge, sich in der unüberschaubaren Vielzahl von Aktivitäten zu verlieren und damit die Einheit des eigenen Lebens, ja die eigene Existenz zu riskieren.“, wie Luc Boltanski in seinem Essay „Leben und Projekt“ schrieb.
Kein Geld verdient mit dem letzten Roman? Muss man halt nach Brot gehen. Das Brot schwebt in einer Wolke, Cloud genannt. Cloudworker heißen die Proletarier des 21. Jahrhunderts, gut ausgebildet, meist mit Hochschulabschluss, „irgendwas mit Medien“. Sie recherchieren in Bibliotheken und im Netz, transkribieren und verfassen Texte und speisen sie ins System. Zielorientiert, schnell, qualitätsgesichert, in großer Zahl und natürlich günstig, heißt es bei einem der weltweit agierenden Anbieter intellektueller Dienstleistungen. Die Proletarierin des 21. Jahrhunderts loggt sich ein in das System und je nach Talent und Ausbildung schafft sie den Soundtrack der Zukunft, optimiert ein Produkt durch Sprache oder Philosophie, gestaltet und bastelt virtuell für einen unsichtbaren Vertragspartner irgendwo auf der Welt. Es gibt keine Sozialausgaben, keine Rentenversicherung. Es gibt keine Grenzen, also auch kein mitteleuropäisches Arbeitsrecht. 300 Worte bringen 3 Euro. Dieser Text hat nicht mal 700.
Unveröffentlichter Diskussionsbeitrag für die Hamburger Begegnung im Literaturhaus Hamburg im Mai 2013
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin
--
Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist vielleicht, dass man in eine Schule geht, in der man all die Jahre nur wartet, dass es vorbei ist. In den Berichten über den Leistungsvergleich der Bundesländer im Sommer 2013 hieß es in der Berliner Zeitung vom 11. Oktober: „Die noch zu DDR-Zeiten ausgebildeten Lehrer machen offenbar den besseren Unterricht. In Chemie, Physik, Biologie und Mathematik schlagen die Ost-Schüler ihre Klassenkameraden im Westen klar.“ Die noch zu DDR-Zeiten ausgebildeten Lehrer? Da fängt man an zu rechnen, Lehrerkollegien sind oft überaltert, es gibt immer noch zu wenige Neueinstellungen. Wer im Osten studiert hat und 2013 dort noch im Schuldienst ist, der wäre heute so zwischen 46 und 64 Jahre alt.
Schöpfen die Lehrer im Osten noch ein wenig Kraft aus der Verteidigung ihrer Qualitäten, die gegenüber westlichen Standards doch so lange als zurückgeblieben und dirigistisch angegriffen wurden? Bessere Lehrer im Osten? Aber nur in den Naturwissenschaften und in Mathematik! Das ist einsichtig, denn die ideologiebelasteten Lehrer für Deutsch oder Geschichte, die Pionierleiter und Jugendklubleiter, die Lehrer für Politikwissenschaft, was einst Staatsbürgerkunde hieß, die wurden wegen ihrer Systemnähe oft ausgeschieden. Vielleicht hat den im Osten ausgebildeten Naturwissenschaftlern sogar die verhasste, verordnete Vorlesung historischer und dialektischer Materialismus eine Handhabe gegeben, um später das Begreifen ihrer Schüler zu erleichtern, weil man noch wie im 19.Jahrhundert nach Hegel trainiert worden war, alle Detailerkenntnisse in größere Zusammenhänge zu setzen. Zusammenhänge fehlen? Inhalte fehlen? Es gibt bundesweite Rhetorikwettkämpfe für Schüler. Wie hatte ich mir so etwas früher gewünscht. Als ich aber in Weimar 1999 einmal einen solchen Wettbewerb besuchte, war ich erschrocken über die Leere und die völlige Abwesenheit inhaltlicher Verantwortung der Übungen.
Es kann ein solches Phänomen der besseren naturwissenschaftlichen Leistungen in den neuen Bundesländern nicht allein an der früheren Ausbildung der Lehrer liegen. Schule und Studium hatten in der DDR gravierende Mängel. Neuste wissenschaftliche Zeitschriften in englischer Sprache für Weiterbildungen waren für Lehrer fast unerreichbar. Außer Russisch gab es Sprachunterricht nur in höheren Klassen. Die Denkschule, die die Beschäftigung mit alten Sprachen bringt, wurde als elitär abgelehnt und höchstens für Mediziner für nötig befunden.
Privilegien der Eltern, Besitz und gute Erbanlagen zu betonen, widersprach den offiziellen Dogmen. Das wurde aber natürlich unterlaufen, auch von mir. Ich habe mich als junge Lehrerin für Deutsch und Kunsterziehung in den Sechzigern und Siebzigern gefreut, wenn Pfarrerstöchter Literatur und Kunst kannten. Ich habe mich empört, wenn ein Schüler, der das Abitur kaum bestand, nur weil er der Sohn eines hohen Funktionärs war, in den diplomatischen Dienst kam. Ich erinnere mich, es hieß damals: „Jeden mitnehmen, keinen zurücklassen!“ Bessere Schüler wurden im Osten von den Lehrern direkt verpflichtet und danach beurteilt, ob sie den Schwächeren helfen. In Lerngruppen zu arbeiten war normal. Als ich in Mathe die Algebra nicht beherrschte und Ableitungen langweilig fand, erkannte ich immerhin sofort die Problemstellung einer Textaufgabe. Ein anderer in unserer Gruppe stellte die Gleichung auf, einer suchte die Ableitungen, einer rechnete fehlerlos. In den Prüfungen war man allein, aber man hatte von den anderen gelernt.
Der war ein schlechter Lehrer, der ein Versagen nicht bemerkte und nicht Abhilfe schuf. Klagen im Lehrerzimmer über die Blödheit der Schüler, verächtliches Abwenden, hoffnungsloses Axelzucken war verpönt, und es war klar, dass es nicht unbegabte sondern nur unterschiedlich begabte Schüler gibt. Diese Haltung haben Lehrer eigentlich von Berufs wegen. In einer Gesellschaft des absoluten Wettbewerbs aber und sehr großer Besitzunterschiede sieht die Realität oft anders aus. Ich erschrecke, wenn sich heute herausstellt, dass Kinder mit dem Urteil „Du nicht!“ ausgestoßen werden und wenn sie von Mitschülern keine Telefonnummern bekommen, um sie fragen zu können, wenn sie nicht weiter wissen. In „Campus und Karriere“, Deutschlandfunk, gibt es Diskussionen über die Chancen von Studienanfängern an den Hochschulen. Man sagt ihnen, sie sollten die Nähe der Mitstudierenden suchen, aber immer die Nähe der Besseren, natürlich. Dass man sich um jemanden, der Schwierigkeiten hat, kümmern könnte, wird gar nicht erwähnt. Gute Verbindungen nutzen und möglichst viele Mitbewerber hinter sich lassen, ist angesagt.
Die Gleichheit in der DDR, sie tat gut und sie lähmte. Peinlich bewusst wurde mir ihr Mangel, als ich in den DDR-Filmen bemerkte, dass alle Dialoge von einem gleichen Bildungsstand ausgingen, in jedem Film kamen die gleichen literarischen und kulturellen Beispiele vor. Autoren und Darsteller waren alle mit dem gleichen Lehrplan unterrichtet worden. Heute lernt nicht jeder Schüler in der 10. Klasse Goethes Hauptwerk kennen und merkt sich dann gerade noch, dass Mephisto “Faust nicht befriedigen kann.“ Ich bedaure das auch ein wenig.
Welche anderen Faktoren könnten zu jenem besseren Ergebnis in den Naturwissenschaften und in Mathematik geführt haben, die nichts mit der alten Lehrerausbildung zu tun haben müssen? Vielleicht ist in den neuen Bundesländern auch die Einsicht noch gar nicht akzeptiert, dass man als Besitzloser endgültig zu einer „unteren, bildungsfernen Schicht“ gehört, weil es bei den Großeltern und Eltern noch lebendige Erinnerungen an Gleichheit gibt. Die nicht ganz abgetötete Hoffnung, die gleichen Chancen zu haben wie jeder andere auch, macht diese Enkel möglicherweise noch etwas hoffnungsvoller als ihre Mitschüler im Westen. In der DDR wurde während der 9. Klasse entschieden, wer weiter lernen und das Abitur machen darf. Da waren die erreichbaren Stufen einer Karriere in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre aber auch schon nach oben hin zu. Die Netzwerke waren geknüpft, die Stellen waren besetzt. Nach der 10.Klasse, die nahezu alle Heranwachsenden gemeinsam abschlossen, durften immer weniger Kinder das Abitur machen.
Aber der klassische Grundsatz, alle fünfzig Jahre ändere sich eine Gesellschaft, der stimmt im deutschen Bildungssystem irgendwie nicht. Alle Schul-Reformen scheinen wenig genützt zu haben, wenn das reiche Land in Bildungsfragen immer noch zu schlecht abschneidet. Ein ungefährdeter Reichtum auf der einen Seite zwingt einen Teil der Nachkommen nicht, in eine Karriere durch Anstrengungen zu gehen, auch weil viele Eltern in Überfürsorge ihren Kindern alle Widerstände aus dem Weg räumen, während andere Teile, darunter besonders Immigrantenkinder, gewohnheitsmäßig schnell aussortiert werden. Chinesische, vietnamesische und russische Kinder seien manchmal sehr fleißig, höre ich von Lehrern. Weil ihre Eltern aus ehemals sozialistischen Ländern kommen? Hier sollte kein neues Vorurteil gezüchtet werden, denn nicht die Rasse trennt sondern die Klasse. Und eine junge Frau aus Süddeutschland sagte zu mir mit einer unerschütterlichen Bestimmtheit, sobald sie ins Gymnasium kam, sei das Zwei-Klassen-System eindeutig und die trennenden Gräben erschreckend erfahrbar geworden.
Ostdeutsche Schüler sind heute besser in Mathe und Naturwissenschaften? Ja, weil sie eine Arbeit haben müssen, eine mehr technologische, die gut bezahlt wird, in den Industrien, die immer noch meist im Westen liegen. Den harten Weg einer Karriere als Künstler, Journalist oder Lektor zum Beispiel, wer soll den wagen, wenn da keine Vermögen sind und auch wenig Traditionen eines Bildungsbürgertums? Warum sind die ostdeutschen Schüler und Studenten nicht auch besser in den Geisteswissenschaften? Müssten sie nicht aus fühlbarem Mangel wieder danach verlangen? Warnen die Eltern ihre Kinder vor „Weltanschauung“, weil sie die alte noch haben, oder weil sie jede für hinderlich halten? Ist die Regel aus der Diktatur „Schweig von deinem Denken in der Schule, rede zum Mund, aber öffne dich nicht!“ im Osten weiter gültig, erweist sie sich als immer günstig?
Lerninhalte von Deutsch oder Geschichte und Erdkunde sind heute viel differenzierter und gründlicher in den Lehrmaterialien aufbereitet, als das in der DDR der Fall war, der Anspruch an Wissen und Können ist in diesen Fächern gestiegen. Die Lehrbücher haben Quellenmaterial, die Fernsehkanäle und Computerspiele arbeiten immer stärker mit Versatzstücken aus Wissenschaft und Geschichte. Tiefere Geschichtskenntnisse vermitteln sich dennoch nicht. Das Wissen zur Zeitgeschichte sei außerordentlich gering, das erwies eine Studie des Otto-Suhr-Institutes. Heranwachsende hielten Demokratie und Diktatur für gleichwertig. Sie würden glauben, dass es direkt aus der DDR zu einem vereinigten Deutschland kam und wüssten so gut wie nichts von der alten Bundesrepublik.
Und der Unterricht ist ideologiebestimmt wie in jeder Gesellschaft. Es gibt zwar jetzt beeindruckendes Quellenmaterial in den Geschichtsbüchern, dennoch kommt am Ende immer heraus: Schuld an der Teilung Deutschlands war der Osten, der Reichstagsbrand war irgendwie doch ein kommunistischer Anschlag, und für den Spartakus-Aufstand im alten Rom reichen 13 Zeilen. Gerade über Bildung und Ausbildung gibt es keine Verständigung zwischen den politischen Parteien. Während Siegmar Gabriel auf dem Parteitag der SPD pathetisch ausruft: „Früher waren die Schulen unsere Kathedralen der Gesellschaft, jetzt sind die Banktürme unsere Kathedralen, das muss wieder anders werden“, bestehen andere Kräfte auf Elite-Förderung, Privatschulen und Privat-Universitäten, auf der frühen Auswahl zur Gymnasialstufe, und sie beharren auf dem Kooperationsverbot der Kultusministerien der Länder.
Neben kaum glaubhaften Behauptungen wie jene, dass ein Viertel aller Schulabgänger in Deutschland so geringe Grundfertigkeiten in Deutsch und Mathematik habe, dass es keine Berufsausbildung beginnen könnte, gibt es einen hohen Prozentsatz von Schülern, die ein Gymnasium besuchen, und zwischen 25 und 35 Prozent, je nach Bundesland, schließen heute ihre Schulbildung mit dem Abitur ab – mehr als einst in der DDR. Dennoch, Schule sei oft nicht wirklich der Ort, wo es um eine Chance des Aufstieges ginge, um eine Überwindung von Ausgrenzung und von sozialen Schranken. Die Schranken stünden in Deutschland mehr als in anderen Ländern schon durch das Elternhaus fest, so sagen die Statistiken.
Die alte Gewöhnung an Gehorsam und Anpassung im Osten konnte nach '89 vielleicht zu einem Funktionieren in einem neuen System, mit neuen Hoffnungen, führen. Wogegen Ideen von Widerstand gegen ein veraltetes System der Schule im Westen eine längere, inzwischen ermüdete Reform-Entwicklung durchgemacht hatten. Ein zynischer Widerstand gegen Schule als Staatseinrichtung entstand danach sowohl beim Prekariat, bei antiautoritären Intellektuellen und auch bei den durch Reichtum und Einfluss über demokratische Einrichtungen sich hinwegsetzenden Eliten. Dieser Widerstand führt zu Leistungsverweigerungen der Jugend in den angeblich „exakten Wissenschaften“. Zynisch gewordene Schüler lernen wegen ihrer Abwehr immerhin das Dagegen-Denken und Dagegen-Reden. Die so Aufgewachsenen setzen auf den autarken, autodidaktischen, nicht institutionellen Weg, wenn schon nicht zum Genie, dann doch zum schnellen Geld, zu einer Nischenexistenz und unter Umständen sogar zu modernerer Bildung als der verordneten? Das Internet, die Computer-Spiele, Freunde mit neuen alternativen „Geschäfts“- Ideen? Sie sind ihre Schule.
Kathedrale muss Schule nicht sein. Es reicht, wenn sie lebendig ist und pädagogische Errungenschaften nicht ablehnt, nur weil sie in ideologisch umstrittenen Gesellschaftsformen praktiziert worden sind. Finnland, wie wir wissen, immer wieder auch „Testsieger“ von PISA-Studien, hat sein Bildungssystem am hierzulande so umstrittenen DDR-Schulsystem orientiert. Nein, PISA, das ist auch nicht alles; 5000 deutsche Schüler nahmen an den neuesten Studien teil, deren Ergebnisse am 3. Dezember bekannt wurden. Die Deutschen schnitten besser ab als vor 10 Jahren. Wie viele Schüler mögen davon aus den neuen Bundesländern gewesen sein? Es gibt allerlei Lob: Mehr Gesamtschulen, verbesserte Integrationspolitik und allgemein verbindliche Standards hätten geholfen. Und es gibt allerlei Tadel: Die sozialen Unterschiede seien immer noch Bremsklötze der Bildung, eine Drillschule wie in Asien wolle man nicht, häufiger als in anderen Ländern wären Mädchen schlechter in Mathematik als Jungen.
Was ist das? Liegt vielleicht immer noch eine Nachwirkung reaktionärer Frauenbilder aus der alten Bundesrepublik vor, dem Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches? Aus dem Osten, aus Sachsen Anhalt, vom SPD-Kultusminister kommt jedenfalls die Bemerkung, dass sich das deutsche Bildungssystem als „lernfähig“ erwiesen habe. Und lernt es auch vom Schulsystem einer Geschichte gewordenen Arbeiter-und-Bauern-Republik? Aus Geschichte lernen ̶ auch ein Weg.
Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin.
--
Mit nachfolgender Dechiffrierung
Wenn ich an Glück denke, denke ich zunächst an Lydia. Lydia war eine große Anhängerin positiven Denkens, jenseits jeglicher Aggression, während ich die selbstverordnete Verpflichtung, positiv zu denken, für ziemlichen Stress hielt, der mich, schon wenn ich an ihn dachte, aggressiv machte. Außerdem besuchte sie allwöchentlich einen Zirkel, in dem die Teilnehmer zur gegenseitigen Beglückung Tiere nachahmten. Ich hatte den Eindruck, Lydia bewegte sich im Laufe unserer Beziehung mehr und mehr wie ein Huhn. Doch unsere Beziehung war nicht lang genug, um das mit Sicherheit sagen zu können. Sie währte nicht mal ein Jahr.
Einige Jahre später war ich für drei Monate in Südafrika. Ich fuhr mit dem Mietwagen von Kapstadt nach Johannesburg. Es war die vierte oder fünfte Tour zwischen diesen beiden Städten, und zum ersten Mal sah ich das, was die Südafrikaner Roadpizza nennen: Einen platt gefahrenen Hund, der von anderen Tieren aufgefressen wird. Das hätte mich nicht geschockt, wenn die Tiere nicht Hühner gewesen wären. Waren Hühner denn überhaupt Fleischfresser? Und wenn ja, wie konnte es sein, dass sie derart aggressiv an dem Hundefleisch herumzerrten und darauf einpickten, dass es mir durchaus Angst bereitete?
Bis heute bin ich dieses abendliche Bild nicht los, und irgendwie bin ich glücklich, dass ich Lydia nie mehr begegnet bin. Stattdessen ist mir vor kurzem ein Hund zugelaufen, ein räudiger Dackel mit langen grauen Haaren an der Schnauze. Überflüssig zu sagen, dass ich ihn hüte wie ein kleines Kind, das jeden Moment weglaufen und unters Auto geraten könnte.
Diese Skizze schrieb ich im Auftrag eines Radiosenders, der ein Buch zum Thema „Glück“ herausbringen wollte, auf der Zugrückfahrt von N., wo ich eine Lesung aus meinem Roman „Nilowsky“ gehabt hatte, nach Berlin. Ich rechnete damit, dass mich der Sender – so war schon mal eine Andeutung der zuständigen Redakteurin gewesen – zu einem Interview einladen würde. In der Nacht nach Anfertigung des Textes träumte ich ein Interview. Eine Frau war es, die mir die Fragen stellte. Ich sah sie nicht, und ihre Stimme kannte ich nicht. Das Interview ging nach meiner Erinnerung in etwa so:
Warum fangen Sie den Text gleich mit dem Glück an?
Das ist dem Auftrag geschuldet. Anders gesagt: Das dem Text zugrunde liegende Thema wird gleich angeschlagen. Der Kern des Textes indes …
… ist die Roadpizza. Haben Sie die tatsächlich gesehen?
Nein. Aber ich habe davon gehört. Ich bin nicht mal mit dem Auto von Johannesburg nach Kapstadt gefahren. Ich bin geflogen.
Ich schließe daraus, dass es auch keine Lydia gibt.
Nein, es gibt keine Lydia. Aber es gibt eine H., die gewissermaßen Vorbild stand. In indirekter Weise ist diese H., mit der ich zirka sechs Jahre zusammen war, auch Vorbild für die Figur Carola aus meinem Roman „Nilowsky“. So richtig klar wurde mir das allerdings erst nach Beendigung des Romans …
Lydia als große Anhängerin positiven Denkens - verbirgt sich bei ihr dahinter Angst?
Ja, das tut es wohl. Es kam mir, wenn ich wiederum an H. denke, schon regelrecht wie ein Selbstzwang zum positiven Denken vor.
Angst und Selbstzwang gebären Aggression. Wie war es darum bestellt?
Sie meinen bei H.?
Ich meine bei H. Bei wem sonst?
In diesem Moment wurde mir klar, dass es sich bei der Interviewerin, obwohl ich sie nicht sehen konnte und mir ihre Stimme nicht bekannt war, um meine Freundin F. handelte. Ich bemühte mich, mir nichts anmerken zu lassen.
Nun, die Aggressivität eines Huhns. (ich lachte)
Sie flüchten in Ihr Bild, mit dem Sie die Sache zum Ausdruck bringen wollen. Ich meinte aber den authentischen Hintergrund.
Ja, ich weiß, dass Sie den authentischen Hintergrund meinten. Doch das Bild dokumentiert diesen Hintergrund.
Können Sie näher darauf eingehen?
Ich überlegte, ob und inwiefern ich mich auf die sogenannte Künstlerposition zurückziehen konnte, derzufolge die Interpretation eigener Erzähleinfälle höchst schwierig und begrenzt ist. Ich wollte mich schon mit der Floskel herausreden: Der Text ist klüger als der Autor -, aber F. (ja, sie war es, ohne Zweifel) insistierte, meine Ambition wohl ahnend, weiter:
Ich meine, ein Huhn steht landläufig nicht für so etwas wie Aggression. Allerdings handelt es sich dabei um eine Fehleinschätzung, durchaus. Denn das Huhn ist, beispielsweise gegenüber einem Regenwurm, von einer derartigen Aggressivität, dass es wohl nicht nur Ihnen, sondern auch mir Angst bereitet. Und überhaupt: Hühner sind nicht nur Alles- und also auch Fleischfresser, sie sind sogar Kannibalen. Ist eine Artgenossin am Sterben, so stürzen sich die Hühner auf diese, zerren Fleischfetzen unterm Federnkleid hervor und schlingen die gierig hinunter. Und ist das elende Huhn dann gestorben, besser gesagt: ermordet worden, geht das Gezerre und Gepicke und Gefresse um so mehr weiter. Genauso wie es Ihrem armen Hund in Südafrika ergangen ist. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass diese Hühnerschar den Hund überfallen und getötet hat, um ihn dann auf die Straße zu legen, sodass es für alle Welt so aussieht, als würden sie den Menschen die Verwesung eines Tiers ersparen, das vermeintlich überfahren wurde? Als wären sie nichts anderes als aufopferungsvolle Ordnungshüter, die sich zudem auf der Fahrbahn selbst noch der Gefahr aussetzen, überfahren zu werden?
So über H. zu denken, war mir noch nie in den Sinn gekommen. Es beunruhigte mich. Doch bevor ich mich darin vertiefte, fragte F. weiter:
Und meinen Sie eigentlich, ein Hund würde sich das bieten lassen: Von einer Hühnerschar überfallen, getötet und aufgefressen zu werden? Meinen Sie nicht, ein Hund würde stattdessen die Flucht ergreifen, so schnell, dass nicht mal das hühnerhafteste Huhn daran denken würde, sofern es denken könnte, die Verfolgung aufzunehmen? Und meinen Sie ebenfalls nicht, dass ein Hund überhaupt nicht flüchten, sondern sich auf das erstbeste Huhn stürzen und es im Nu auseinandernehmen würde wie nur irgendetwas? Und jetzt konkretisieren Sie den Hund und denken sich tatsächlich einen Dackel – meinen Sie nicht, der Dackel, und sei er noch so alt und räudig und lang- und grauhaarig, würde sich nicht halbtot lachen, wenn er lachen könnte, über solcherart Hühnergebaren?
Nun, es wird nicht wundern, wenn ich an dieser Stelle verrate, dass F. einen Hund, genauer gesagt: einen Dackel besitzt. Einen Dackel namens K. Und F., die Besitzerin des Dackels namens K., wollte sich noch nie im Leben als Opfer fühlen. Wir waren nicht mal ein Jahr zusammen, aber das wusste ich längst.
Mit diesem Gedanken wachte ich auf. F. schlief neben mir, während K. im Flur vor sich hinknurrte. Damit er aufhörte, ging ich zu ihm und gab ihm sein Schüsselchen mit Hühnerfleisch. Dann ging ich aus dem Haus und schaute ins Hühnergehege. Nichts Außergewöhnliches. Alles friedlich. Doch so genau, dass ich dafür meine Hand hätte ins Feuer legen können, schaute ich nicht hin.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
1. Nennen wir die Prüfung des Realen seine Berührung durch ein Denken, das künstlerisches oder philosophisches Denken sein kann, während es Realität als ein Konsistenzversprechen erfährt, das nicht eingehalten wird, weil es nicht eingehalten werden kann.
2. Das Reale – um mit Jacques Lacan zu sprechen – ist nicht die Realität. Oder: Es ist die Realität – das Universum etablierter Gewissheiten und Evidenzen –, indem es ihre Wahrheit indiziert, ihre ontologische Ungewissheit und Fragilität.
3. Realität ist das ökonomisch, historisch, kulturell, ästhetisch, sozial, politisch etc. kodierte Konsistenzmilieu, das unsere geteile Welt ohne Hinterwelt ist: die zuletzt brüchige, auf Konventionen und Agreements beruhende Tatsachenzone, die letzter Fundierung in einem absolutem Grund oder Prinzip entbehrt.
4. Sie ist der nicht mehr begründete Grund, der unser Logos-Universum – die Domäne instituierter Sinnhorizonte und Bedeutungsversprechen – darstellt.
5. Hier bewegt sich das menschliche Subjekt wie auf dünnem, aber nicht gänzlich unverlässlichem Eis.
6. Das Eis kann brechen, doch damit es brechen kann, muss es einen Boden bilden, auf dem das Subjekt sich einen Moment lang (vermeintlich) sicher bewegt.
7. Es ist dieser brüchige Boden, den Friedrich Nietzsches Formel vom Tod Gottes der Selbsterfahrung des Subjekts hinterlassen hat.
8. Nietzsche hat seiner Zukunft einen Boden ohne Boden vererbt.
9. Dass der Boden ohne Boden ist, heißt, dass er eine Art fliegender Teppich ist.
10. Er ist über den Abgrund ontologischer Inkonsistenz schwebende Architektur.
11. Realität nenne ich dieses Konsistenzgewebe, das durchlässig für jene ontologische Inkonsistenz bleibt, die Nietzsche den dionysischen Ungrund, Sartre das Loch der Freiheit, Deleuze & Guattari das Chaos, Lacan das Reale nennen.
12. Realität ist der Index ihrer eigenen Brüchigkeit.
13. In Ludwig Wittgensteins Denken ist Realität als Sprachspiel oder Lebensform adressiert und entspricht etwa dem, was Lacan die symbolische Ordnung nennt.
14. Das Subjekt ist in die Realität eingelassen wie in ein alternativloses Milieu.
15. Dass Realität alternativlos ist, heißt nicht, dass sie notwendig ist, wie sie ist.
16. Die Wahrheit der Realität ist ihre Kontingenz.
17. Kunst und Philosophie sind Denkformen, die den Kontingenzcharakter der Realität indizieren.
18. Es geht darum, einen Widerstand gegen die Realität zu generieren.
19. Nicht um realitätsflüchtig zu sein, sondern um im Gegenteil den Kontakt zur Realität – zur sozio-bio-öko-politischen Norm – zu intensivieren, indem man Abstand zu ihr hält.
20. Nennen wir diesen Abstand den Freiraum von Kunst und Philosophie.
21. Freiraum ist subjektive Freiheit in objektiver Unfreiheit = Distanz von der Realität inmitten der Realität.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Zum Tod von Mitko Gotscheff
Er starb am 20. Oktober. Zur Trauer um den Menschen, seine Freundlichkeit, seinen Witz, die Menge an Geschichten mit und ohne Heiner Müller, seine Vielfalt an Gesten und Grimassen, die seine Erscheinung ausgemacht haben, gehört die Trauer um den Regisseur und die Gewißheit, daß es eine neue Arbeit mit ihm an der Volksbühne nicht geben kann. Sein im Sommer diesen Jahres mit Katrin Brack in Flammen konzipierter RICHARD III. liegt auf Eis für immer. Gotscheffs Tod reißt eine Lücke in die Kunst der Kollektive, die Theater nicht nur im Idealfall ist; im Idealfall wird das Kollektiv Familie. Kunst ist ein Widerstand gegen die Realität. Der bulgarische Widerstandskämpfer Dimiter Gotscheff war im deutschen Sprachraum ein Gastarbeiter, der Literatur und Theater ebensoviel zu verdanken hat wie Literatur und Theater ihm. Die sprachliche Trennwand war ein Gewinn für diese Arbeit. Gotscheffs Qualität als Regisseur war seine unbedingte Neugier, das Lernenwollen, er war ein naiv Vergrübelter, ein neugieriger, selten zufriedener Zuschauer, der Schauspieler zu fröhlichen Sprengtrupps im Rohbau des Theaters umrüsten konnte, die ein Jenseits im Diesseits mit Gelächter und Entsetzen möglich machten und der Horizont flog in die Luft. Oft genug war es das Schweigen und die Stille, die den Bau erschütterten. Daß das Schweigen dieses Regisseurs jetzt ein endgültiges ist, macht traurig und neue Hoffnung zugleich auf Arbeit in der Kunst und Theater nach ihm. Die Hoffnung kann die Stille sein, das Schweigen des Theaters, von dem Müller anläßlich Gotscheffs 1983 schreibt, nämlich der Grund seiner Sprache, die es über die Realität hinausgehen läßt. Auch der Tod ist ein Beitrag zur Realitätsverweigerung, ob wir an ein Leben danach glauben oder nicht. Wo der Teufel alle Hände voll zu tun hat und Gott vermutlich in Bulgarien lebt, dreht sich die Welt als Scheibe im Trockeneisnebel über dem Abgrund der Schöpfung.
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Das Schloß, zu Bauzeiten und die folgenden Jahrhunderte in abgelegener Gegend, liegt an einer Hauptverkehrsstraße am Rand einer (vielleicht schottischen) Großstadt. Der Baukörper könnte ein leeres Theater sein, die Pforte der verrammelte Bühneneingang. Nacht, ab und an ein Auto, sonst jede Menge LKWs.
PFÖRTNER
Ich, ich will nicht von Lektüre reden … aber es ist eben doch und genau so, daß seit ich das Lesen lernte, und mir ein ernsthaft verschrobener Lehrer diesen Dichter vor die Füße warf, mich die eine Stelle seines Stücks berührt hat wie sonst nichts: das Klopfen an die Pforte am Südtor vom Schloß des finsteren Macbeth, das Klopfen an ein unerschütterliches Holz, das seinen Mann steht, wie das, an dem ich stehe, ein Holz, das der Hölle standhält, die sich auftut vor ihm, der davorsteht, genauer steh ich hinter ihm, das Tor vor mir, weil zwischen Welt und Unterwelt gefiel dem Herrn, ein Tor aufstehn zu lassen wie er Wälder aufstehn ließ aus seiner Unerforschlichkeit hier oder dort, und er ließ Engel wachsen davor mit gewaltigen Nasen, die bewachten das Tor mit gewaltigen Schlüsseln, genau mit einem, den ich in der Hand halte hier (Klopfen) … ja, war es das, ein Klopfen, oder der Wurmfraß vor oder in mir, wer als der Herr will das wissen …(Klopfen) … also doch … ja, klopft nur, klopft, wer immer ihr seid, und wenn die Welt voll Teufel wär, ihr kämt nicht hinein, weil vorbei nicht an mir, und ihr, ihr Himmlischen, auch ihr hättet Eingang nicht allezeit, außer wenn der Herr es will, und der Herr dieser Schwelle genaugenommen bin ich, und wer als ich hat derart viel gehört an Klopfen, Klopfen treibt den Holzwurm aus, Klopfen hält die Zeit im Zaum, Klopfen ist Musik, die zwingt den Gang der Nacht zum Tanz, das von einem gesagt, der weiß wovon er spricht, wo Klopfen ist, da ist kein Spuk, Klopfen bringt Glück auf den Weg, wer klopft, kann hoffen, daß geöffnet wird – nur was sich ihm eröffnet, ob Frau und Kind auf ihn warten oder ein Schlag mit der Axt, wie genau will er es wissen – wer klopft, der wartet, seis auf ein Echo …(Klopfen) … ja klopft nur, klopft, Klopfen, ja, das kann ich auch, klopft euch die Haut von den Knöcheln, klopft, ihr müßt doch warten, bis euch aufgetan wird von wem als von mir, ja, Warten will gelernt sein, wer nicht warten kann, den straft das Leben irgendwann, und wer immer da klopft, ein Mensch muß es sein, denn der Mensch kann nicht warten, er hat seine Zeit, die ihm Frist nach Jahren Tagen Stunden undsoweiter ist, bis hinter ihm die Pforte ins Schloß fällt, wozu ist ein Tor sonst da, als daß dran geklopft und aufgetan wird oder, genau: eben nicht …(Klopfen) … klopft, klopft wie ihr könnt, diese Mauern sind gestopft mit Klopfen oder anderem Geräusch, wenn diese Mauern Ohren hätten, sie wärn taub längst wie bald ich, daß sie nicht stumm sind liegt an mir, wer sonst in der Nacht hat Ohren zu hören, was die, denen der Schlaf nicht kommen will, zu reden haben in der Nacht mit Grund, wie ihr Schöpfer es ihnen in die Münder schrieb, daß sie, was einmal ausgesprochen, oft und gern und gegen jeden Preis zurück ins Schweigen klopfen würden … (Klopfen) … ja, klopft und klopft, klopft die Schläfer aus den Betten, klopft die Toten aus der Erde, die Zeit aus ihren Fugen, könntet ihrs, heut Nacht haben wir den König innerhalb, nie hab ich einen schnarchen hörn wie den, und seine Herren Dienerschaft nicht weniger, euer Klopfen ist das Ticken einer Sonnenuhr dagegen, der Schlag des Schmetterlings gegen den der Glocken vom Turm oder das Zwitschern der Lerche am Morgen gegen den Aufmarsch der Truppen von Schottland oder wem sonst gegen wen immer, ein Nichts … Stille jetzt, warum … warum auch nicht, solang es die Stille der anderen ist und nicht meine, und abgesehn davon, daß wir von Lektüre hier nicht reden, bleibt doch noch zu sagen, daß ich, nachdem ich seine Sprache lernte, anfing, ein wenig von der phantastischen Verwirrung dieses hingebungsvollen Dichters zu empfinden, der, uns unsern Zustand der Entfremdung vorführend, dazu verurteilt ist, zu versagen je erfolgreicher er ist, denn je wahrheitsgemäßer er die Lage malt, um so undeutlicher nur kann er auf die Wahrheit deuten, von der sie sich entfremdet hat – tatsächlich ist das Hinter der Tür so fragwürdig wie das Davor – und je klarer seine Enthüllung der Wahrheit in ihrer Ordnung und Gerechtigkeit ist, um so schwächer zeigt sich sein Bild unsrer Lage in ihrer vollkommenen Erbärmlichkeit, ja schlimmer noch, je präziser er die Entfremdung definiert – und was sonst wäre sein Talent, wenn nicht, uns die ungeschönte Kluft zwischen dem, was wir so fragwürdig sind und dem, was ohne Frage uns befohlen ist zu werden, mit Schönheit und mit Schmerzen ins Bewußtsein zu hämmern – um so mehr täuscht er uns in aller Klarheit vor, daß die Erkenntnis der Kluft in uns selber eine Brücke ist, unser Interesse an unserem Gefangensein in unsrer Lage eine Befreiung, über die und in die hinein ein Schritt führt wie der durch dieses Tor, an dem ich steh … ja, Türhüter sein heißt ein Hohes Geschäft, manch einer kommt nie vorbei an dem, mancher nur den einen Weg, herein und nie heraus, wenn einer weiß, wovon er redet, bin es ich, zwar mächtig, gut, doch nach mir kommt einer mächtiger als ich und nach dem kommen welche, denen sagt ein Klopfen gar nichts mehr … warum jetzt schweigst du, Klopfen … ja, du schweigst … es schweigt! … dann will ich schweigen wie jetzt du, denn jedes Tun, wohin es führen mag, von wem es ausging, seis im Wachen, seis im Schlaf geschehn, egal, wird kenntlich erst und meßbar durch das Echo drauf … nun gut, dann schweige, schweigen wir alle, auch du, Herr König, schlaf du wohl, dein Schnarchen war mir Trost in einer nur zu stillen Nacht (Klopfen) … ja, klopf nur, klopf, Geduld ein wenig und ich laß dich ein, Geduld, sag ich, Geduld, halts Maul!
Alle Rechte am Text liegen beim Autor.
--
Dosenlöwe, Panzerfahren, Leichenessen – Tigersprung rückwärts
Mit Ausschnitten aus dem Faltblatt „The canned lion oder Der Herr mit dem dicken Kopf“ von Caroline Böttcher
Die Arbeit an und mit Erinnerung und Geschichte ist ein gefährliches Unterfangen. Entweder verstrickt man sich im Netz der individuellen biografischen Nabelschau und verharrt in der melancholischen Selbstvergewisserung der eigenen Identität oder aber man wird von einer apologetischen Geschichtsschreibung in den Dienst genommen, die sich zum objektiven Überblick aufschwingt und über die folgerichtige und ordnungsgemäße Aufreihung der Ereignisse und die Zementierung der gegenwärtigen Zustände wacht. Sowohl die eine als auch die andere Tätigkeit stellen nicht mehr als besonders geschäftige Formen des Stillstands dar.
Um diesen Formen der Ausbeutung und Stillstellung der Erinnerungsarbeit zu entgehen, gilt es zu versuchen, zu ihrem revolutionären Kern vorzustoßen und Erinnerung als etwas zu verstehen, das man produzieren, verteidigen und als Waffe begreifen kann.
Um in diese Gebiete des strategischen und taktischen Umgangs mit Erinnerung einzudringen, braucht es erfahrene Kampfgenossen, derer es sich jedoch erst einmal zu erinnern, die es aufzuwecken, zu entdecken und freizusetzen gilt. Zwei solcher Kampfgenossen haben mich im Verlauf der Arbeit an der Erinnerungsarbeit quasi aus dem Hinterhalt und aus der Erinnerung heraus angefallen. Beide Gefährten haben sowohl an der Produktion als auch am Produkt der Erinnerungsmaschine – um deren Bauplan ich mich hier bemühe – entscheidenden Anteil. Bei dem einen handelt es sich um einen Sprössling, der aus Walter Benjamins inniger Beziehung zu Karl Marx hervorgegangen ist: jener Tiger, der sich als Produzent des „Tigersprungs ins Vergangene“1 einen Namen gemacht hat. Der andere Komplize, „Der Dosenlöwe“, lauerte in dem Faltblatt „The canned lion oder Der Herr mit dem Dicken Kopf“, das die Künstlerin Caroline Böttcher vor einem Jahr produziert und in kleiner Auflage unter Leute gestreut hat.
 |
|
| Caroline Böttcher: "The Canned Lion". Aus: "The canned lion oder der Herr mit dem dicken Kopf", 2012 |
Benjamin beschreibt den Tigersprung in die Vergangenheit als Erinnerungsbewegung mit Zähnen und Krallen, als eine Jagd, die eine Beute im Visier hat und vom Hunger der Gegenwart getrieben wird. Als ersten Schritt halten wir also fest: Wer Erinnerung produzieren – eine Erinnerungsproduktions-Maschine konstruieren will – muss mit dem Tiger arbeiten oder Tiger werden.
Diese Kollaboration mit dem Tiger in der Maschine ist jedoch nicht ganz einfach. Der Tiger ist als Raubkatze kein Tier, das in den Kreis der besten Freunde des Menschen gezählt wird. Die Form einer solchen Zusammenarbeit muss also erst einmal gefunden werden.
An dieser Stelle nimmt der Dosenlöwe seine Arbeit auf. Auf seinem Rücken begegnet die aufmerksame Erinnerungsarbeiterin ihrer Vorreiterin und Großmutter: der Löwenbraut. Aus der Begegnung mit der Dompteuse erfahren wir im zweiten Schritt: „Große Geduld, Ruhe, Ausdauer, eiserner Wille, Kraft und Kaltblütigkeit sind (...) die unerlässlichen Tugenden einer guten Dompteuse“. Sie warnt uns: „Für die Dompteusen waren jedoch nicht die Verletzungen am schlimmsten, sondern die Enttäuschung und die nicht erwartete Unberechenbarkeit ihrer Löwen“. Die Löwenbraut verkörpert eine zwiespältige Beziehung zum Raubtier: Einerseits erzieht sie den Löwen durch zahme Dressur, Liebe und Freundschaft wie ein Kind. Wodurch sich die gezähmte Gefährlichkeit als eine Form der geliehenen Potenz, Imposanz und Freiheit auf die Dompteuse überträgt. Andererseits jedoch setzt sie sich Kräften aus, die sich gegen sie richten können. Denn sie ist für den Löwen eben nicht nur Freundin und Genossin, sondern auch potenzielle Beute und Unterdrückerin des Dosenlöwen.
 |
| Caroline Böttcher: "Löwenbraut". Aus: "The canned lion oder der Herr mit dem dicken Kopf", 2012 |
Für unsere Kollaboration bedeutet das: Der Tiger springt nicht nur als unsere dressierte Erinnerung in die Vergangenheit, sondern er kann sich sehr wohl, einmal in der Vergangenheit angelangt, umdrehen und uns mit dem Hungerbauch der Vorkämpfer und Vorfahren anfallen. Die Beziehung zum Tiger, zur Erinnerung ist also nicht nur von einem Hunger geprägt, der mit unserem identisch ist, sondern auch von Hungerbäuchen, die in der Vergangenheit auflauern, die uns fremd sind.
Wenn wir uns der Gefahr aussetzen wollen, die uns vom Hunger der toten Menschen, Dinge und Visionen her entgegenspringt, dann heißt das womöglich selbst so hungrig zu sein, dass man trotz aller Gefahren mit dem Tiger springt, dass man also lernt, die Fremde, in die man springt und die zurückspringt, auszuhalten.
Beim Blick in die ausgehungerten Augen des Tigerfreundes stellen wir fest, dass die Sehnsüchte, Wünsche und Träume der Toten noch lange nicht verwirklicht sind, dass der Kampf nicht gewonnen ist. Die Hungerbäuche unserer Vorfahren lassen sich als widerspruchsvolle Konstellationen, Quellen und Artefakte, nicht einfach in einen kontinuierlich fortschreitenden Geschichtsverlauf integrieren. Denn weil die alten Ziele eben nicht erreicht, die Wünsche nicht erfüllt sind, stehen sie im Widerspruch zu der herrschenden Anordnung von Informationen, in der alle Wünsche und Träume als erfüllbar gelten. Die aus der herrschenden Geschichtsschreibung herausgebrochenen Splitter zeugen davon, dass der alte Hunger noch immer unbefriedigt ist. Er richtet sich mit dem Tigersprung nun auf uns und belästigt uns als Lebende mit der Verantwortung und der Aufforderung, ihn gefälligst ernst zu nehmen und uns um Befriedigung zu kümmern.
Mit diesen "Vorfahren“ verbindet uns weder Blut noch Genetik sondern eine Familiengeschichte des Hungers und der Waisen, wobei die Aufgabe darin besteht, solchen Splitteropas und Omas zu Ersatzenkeln zu werden und sich von ihrem Hunger fressen zu lassen.
Von den Hungerbäuchen gefressen werden und sie fressen, in die Vergangenheit springen und aus ihr angesprungen werden: Der fremde Hunger, macht uns auf eine besondere Weise mit dem eigenen Hunger bekannt. Dieser Hunger geht über die privaten Träume und Visionen von einem besseren Leben hinaus. Löwenhunger ist das Produkt einer Vermischung. Soll der Hunger Kraft gewinnen, dann muss er sich stärken, indem er frisst und gefressen wird, indem er seine eigenen Wünsche mit denen der Toten vermischt.
Eine solche Form der Verwandtschaft und Vermischung der Beute mit dem Jäger ist im Falle des utopisch-revolutionären Hungers, der mit dem Tigersprung geweckt werden soll, kein Verschlingen, das zur Auslöschung führt. Als Beute eines solchen Hungers verschwindet man nicht. Sondern man wächst am Hunger des anderen und kann dann mit einer Armee von Toten und Tigern im Rücken die Gegenwart sprengen, indem man von der Zukunft Befriedigung und Reparationen fordert.
 |
| Caroline Böttcher: "Bräute als Beute". "The Canned Lion". Aus: "The canned lion oder der Herr mit dem dicken Kopf", 2012 |
Das Potential für eine Verständigung mit den Toten liegt also in der Nekrophagie, im Fressen von Leichen. Dieselbe Dompteuse ist man danach sicher nicht mehr. Diese Erfahrung bringt die Löwenbraut Mademoiselle Louise auf den Punkt: „Bei jeder Vorstellung kam ich in die Manege mit der fixen Idee, dass ich nicht wieder heraus käme – oder zumindest nicht ganz vollständig.“
Um die Sache der katzenäugigen Komplizen jetzt aber noch ein weiteres mal zu verkomplizieren, muss auch der Ort ins Visier genommen werden, an dem sich solche Wunder ereignen: Was ist das für eine Gegenwart, von der aus wir zum Sprung ansetzen? Der Tiger, den Benjamin aufweckt, springt selbst von einem nicht ganz unproblematischen Raum aus los: „Sein Sprung findet in einer Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert.“
Als angefallene Löwenbraut stellen wir fest, dass wir im selben Käfig sitzend den Käfig sprengen und uns von Freunden fressen lassen müssen. Denn nur das Sich-Fressen-Lassen von Freunden und das Freunde-Fressen maximiert den Hunger bis er einen kritischen Punkt erreicht, also eine Sprengkraft entwickelt, die etwas ausrichten kann gegen die Eisenstreben des Käfigs.
Was aber ist der Käfig? Der eine Block, das ist eine Geschichtsschreibung, die aus den alten Kämpfen Wachsfiguren macht und sie in ihren Verlauf einordnet. Sie beraubt die Alten ihrer potentiellen Sprengkraft, indem sie ihre Träume, ihren Hunger als veraltet beschriftet und in Museumsschaukästen einbüchst. Das Produkt dieser Geschichtsschreibung, die das Gewesene feststellt und einreiht, wodurch uns die immer gleiche Fortschrittsgeschichte präsentiert wird.
Der andere Block ist einer, dem wir nicht so einfach begegnen können, weil er als falscher Freund auftritt und statt des Gewehrs Süßigkeiten mit sich führt. Zu diesem Block stehen nicht nur die Alten und die Löwen in einem Ausbeutungsverhältnis, sondern auch wir. Ausgebeutet wird nicht hier unsere Arbeit, sondern noch viel grundlegender der Hunger selbst, der uns zur Erinnerungsarbeit drängt. Heiner Müller beschreibt eine Form des Stillstands, die dem Tigersprung entgegengesetzt ist: „Der Trend ist doch, dass die Leute nicht mehr (...) mit alten Erinnerungstücken reden, sondern mit dem Fernseher. Aber der hat auf alles eine Antwort, kann alles erinnern. Das ist mörderisch, denn das höhlt das Subjekt erst langsam aus und frisst es dann auf.“ Es geht darum, ob wir dem Fernseher glauben, ob wir unseren Hunger von ihm stillen lassen, uns von seinen alarmistischen Ablenkungsmanövern und beschwichtigenden Antworten ruhig stellen lassen.
Wenn wir uns jetzt also in diesem Kampf mit diesen Käfigstreben befinden und die Erinnerung als Tiger unsere Waffe werden soll, die uns aber frisst, weil uns der Tiger mit dem Hunger der Toten anspringt, sind wir selbst dann nicht auch als Gefressene ruhig gestellt? Macht dann die Sache mit dem Tiger, mit der Erinnerung als dann Waffe noch Sinn? Was machen wir mit dem Fernseher, mit den Einheitsgeschichten?
| 1972: Nick Pallat, Schlagzeuger von Ton Steine Scherben zertrümmert den Tisch im WDR. „... was passiert objektiv? An der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts! Fernsehen ist ein Unterdrückungs-instrument in dieser Massengesellschaft! Man muß parteiisch sein. Das muß man hier einfach sagen. Und deswegen mach ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt. Ja, damit man mal genau Bescheid weiß! ..... So, jetzt können wir weiterdiskutieren!“ |
Fressen und Gefressen-Werden sind keine so endgültig voneinander geschiedenen Verhältnisse. Als Gefressene ist man nicht verschwunden, sondern geht in den Organismus des Fressenden ein und kann von dort aus wirken. Der Hunger fragt nicht nach Identität und Moral der Dompteuse, er fragt nach ihrem Nährwert. Bei all diesen Mischungsverhältnissen, die aus der Tigersprungmaschine hervorgehen, kommt es nicht darauf an, was das gefressene in seinem Wesen war. Es geht um Hunger, um Nährwert. Insofern gilt der Feind nicht als besiegt, der Käfig nicht als überwunden, wenn man sich von ihm trennt, ihn betäubt oder aussperrt, sondern erst dann, wenn man ihn auffrisst.
An dieser Stelle kommt, um dieses Verhältnis zu klären oder auch nicht, eine andere Großkatzenart ins Spiel, die eine seltsames Mischwesen ist, dessen Geburt irgendwo in den 60er Jahren im Schoß Westdeutsch-Amerikanischer Freundschaft, deutscher Wiederbewaffnung und Erinnerungsverweigerung verortet werden kann: Der Leopard 2, Kampfpanzer und deutscher Waffenexportschlager.
Dieser Leopard 2 ist sicher nicht ohne weiteres auf der Seite der Ausgebeuteten zu verorten. Aber wie im Löwen steckt im Leoparden die Möglichkeit, sich gegen seine Herren zu wenden, wenn er nur den richtigen Hunger hat. So fiel der Großvater des Leopard 2 – der Tiger-Panzer, der ab 1942 in der Wehrmacht eingesetzt wurde – dadurch auf, dass mehr Fahrzeuge durch mechanische Defekte und Selbstzerstörung als durch direkte Feindeinwirkung verloren gingen. Hier materialisiert sich auf seltsame Weise jene Dynamik der "Doppelnatur“ von Gefährlichkeit und Verwundbarkeit, die Mao Z als Umschlag des richtigen – also gefährlichen – Tigers zum Papiertiger beschreibt.
Der Mechanismus des Fressens und Gefressen-Werdens ist keine Logik des reinen Ausbruchs in die totale Freiheit. In der Mechanik des Hungers macht es keinen Sinn, den Käfig hinter sich zu lassen, sondern er muss gefressen werden, und dadurch kann man schließlich seine eigene Panzerung und aufbessern. Und da der Unterschied zwischen Jäger und Beute, zwischen Magenträger und Mageninhalt jederzeit umkehrbar ist, kann also der Tiger ganz ohne Ausbruch vom Inneren des Käfigs her, quasi aus dem Magen des Fernsehers heraus, beginnen, Löcher in seine Wände zu reißen..
Wir brauchen also einen Hunger, der so groß ist, dass unser Löwe nicht nur die Dompteuse, sondern die Eisenstreben gleich mitfrisst und so zum metallisch glänzenden tarnfarben angestrichenen Leopard 2 wird. Die Löwenbraut im Magen des Löwen, sitzt letztendlich also im inneren des Leopard 2 und wird durch diesen Kniff zur Panzerfahrerin befördert und mit der Lenkung der Geschütze betraut. Mit dieser 2. Umkehrung des Leoparden, richtet sich die Löwenbraut – halb Löwe, halb Braut – auf das Eisen, auf die materiellen und informationstechnischen Möglichkeiten der Gegenwart. Indem der Hunger sich zu guter Letzt auch noch an den Maschinen vergeht und sich ihren Hunger einverleibt, rollt der Panzer aus dem Käfig und als Tiger-Dompteusen-Freundschafts-Dosen-Revolutions-Maschine geradewegs auf die Stadtschlösser zu.
Nachweis:
1) „Die Geschichte (...) ist der Tigersprung in die Vergangenheit. Nur findet er in einer Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische, als den Marx die Revolution begriffen hat.“ Zitiert aus: Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 1/2. Frankfurt am Main 1991. S. 700.
Alle Rechte am Text liegen bei den Autoren.
--
Der Kulturwissenschaftler, Medienphilosoph und Germanist Friedrich Kittler wäre am 12.6.2013 siebzig Jahre alt geworden. Im Oktober 2011 starb er und hinterließ ein umfangreiches Werk – vor allem Texte, die einigen Zündstoff boten. Die einen unterstellten, dass er nestbeschmutzend seine Wissenschaftsdisziplin abschaffen wolle und/oder dass er Schüler um sich schare, deren Verehrung an Jüngerschaft grenze, die Anderen, dass ein einmalig scharfsinniger Geist und rebellischer Denker kleinlichen Anfeindungen und fachimmanenter Versteifung auf Hergebrachtes ausgesetzt sei. Keine dieser Positionen ist gänzlich von der Hand zu weisen. Mit „Aufschreibesysteme 1800/1900“, seiner Habilitation, brachte er einst die Germanistik gehörig durcheinander – heute fällt es niemandem mehr ein, medientheoretische Auslassungen aus der Literaturwissenschaft fernzuhalten. Viele Universitäten haben die Medienwissenschaft in ihrem Fächerkanon etabliert. Unter diesem Label verbergen sich ganz verschiedene Zugänge, aber kaum jemand würde bestreiten, dass die medialen und technischen Voraussetzungen für die Gestaltung und das Nachdenken über das, was unsere Welt ausmacht und was wir selbst sind, eine Schlüsselrolle spielen.
Diese Schlüsselrolle der technischen Entwicklungen, neuen Wissens, etwa in der Mathematik, und der jeweiligen Medien einer Epoche – im Buch „Grammophon, Film, Typewriter“ beispielsweise für die Zeit um 1900 – hat Friedrich Kittler in allen Bereichen der Kultur und Wissenschaft interessiert. Wie verändert sich das Theater mit der machtvoll eingesetzten Bühnentechnik Wagners? Was macht die Fotografie mit der Malerei? Was verändern die technischen Möglichkeiten von Radio und Funk? Was provoziert die Schreibmaschine und das zu ihr gehörende Tippfräulein (nicht nur) in der Literatur? Und vor allem: Wie verändert der Computer, die universelle Turingmaschine, unsere Welt, unser Wissen, die Kunst, die Sprache, unser Denken...
Mit seiner lebenslangen Leidenschaft wissen zu wollen hat Friedrich Kittler diese Spuren akribisch über die Grenzen von Universitätsfächern hinaus verfolgt – die Spuren des von General Guderian im zweiten Weltkrieg eingesetzten Panzerfunk in die „Rockmusik – ein Mißbrauch von Heeresgerät“ hinein, die Spur der laterna magica fand er bei E. T. A. Hoffmann. Den Zusammenfall von einer um die Mutter zentrierten Kleinfamilie, deren Mitglieder einander in Liebe zugetan sind, mit einer neuen Pädagogik, deren Subjekte diese Mutterbindung immer suchen werden in ihrem Begehren und Dichten, fand er bei den Dichtern um 1800, bei Goethe, bei Schiller nachgerade.
Dem Theater hat sich Friedrich Kittler von unterschiedlichen Blickpunkten her genähert. Als Kind wusste er, so hat er es erzählt, den Faust auswendig und rezitierte gern daraus. Seinen Habilvortrag hielt er zu Lohensteins Agrippina, einem Trauerspiel aus dem 17. Jahrhundert, Friedrich Schillers „Don Karlos“ hat er als ziemlich exakte Beschreibung der Zustände an der Hohen Karlsschule, die Schiller als Stipendiat der Herzogs Karl Eugen besuchte, gelesen, in einem seiner letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Büchern beschreibt Kittler die Aufgaben und Effekte des Theaters im stadtstaatlichen Athen und übersetzt hinreißend schön die Chorlieder in Sophokles' „König Ödipus“. Noch zu Zeiten des Kalten Krieges begegneten sich Heiner Müller und Friedrich Kittler, eine Freundschaft verband sie über Jahre. Zu gern hätte Friedrich Kittler einmal in Bayreuth seinen Richard-Wagner-Ring inszeniert, mit dessen Musiktheaterzauber, scharfsinnig analysiert und technisch verortet, er in höchst spannenden Seminaren selbst Wagnermuffel begeistern konnte. Ebenso wie in seinen Seminaren zu populärer Musik, zu Pink Floyd, den Rolling Stones und Beatles, in denen Verstärkertechnik, Vocoder, Mehrkanaltonstudio und E-Gitarrenriffs als technische Nachwirkungen zweier Weltkriege diskutiert wurden.
Sie lesen, Friedrich Kittler war durchaus ein schillernder Autor, Lehrer und Denker – auch im Wortsinn, neben dunklen, sehr minimalistischen edlen Anzügen erschien er auch schon mal in einem skarabäusfarbenen Seidenjacket zu öffentlichen Vorträgen, in denen er dann auf die Zuhörer und Zuhörerinnen ein so kenntnis- wie assoziationsreiches Gedankenfeuerwerk in schnellen, geschachtelten und immer präzisen Sätzen abschoss.
Friedrich Kittler und die Kunst also, oder wie hier im Textfragment aus seinem im Deutschen Literaturarchiv Marbach bewahrtem Nachlass, „Die Grenzen der Kunst“. Dazu gäbe es zu sagen, dass er sich eigentlich gar nicht so sehr für die Kunst interessiert hat, seltsamerweise aber viele Künstler sich für seine Schriften begeistern konnten. Wohl aber hat er sich für die Techniken und Praktiken interessiert, die Kunst ermöglicht haben. Schaut man in das Buch „Unsterbliche“, dass eine Sammlung von Nachworten, Geburtstagsfestschriften und -artikeln zu Persönlichkeiten versammelt, findet man gleich zu Beginn ein Lob des uomo universale Leon Battista Alberti. Der steht neben Mathematiker (und Parlamentsrat) Pierre Fermat, neben Gottfried Wilhelm Leibniz, dem Erfinder der Binärithmetik – Voraussetzung für die Computerprogrammierung, neben dem „zerstreuten Mathematiker“ Norbert Wiener und neben dem Vater der Computerarchitektur, Alan Turing. Was auch etwas damit zu tun hatte, dass Friedrich Kittler eben nicht nur vom Hörensagen wusste, wie man eine Fourrieranalyse macht, sondern auf karrierten Spiralblöcken mathematische Probleme durchgerechnet, Schaltungen gelötet und Graphiken programmiert hat. Dazu gesellen sich der Ingenieur Claude Shannon und Denker wie Jacques Lacan, Michel Foucault und Niklas Luhmann. Letzterer sagte einmal zu Friedrich Kittler: Wenn ein persischer Bote von A nach B reitet, frage ich nach dem Inhalt der Botschaft, du aber nach dem Pferd, auf dem er geritten ist. Anders gesagt, hat sich Friedrich Kittler nicht so sehr für einen Künstler oder ein Werk oder eine Epoche oder einen Stil interessiert als für das, was Kunst und den Künstler oder die Künstlerin ermöglicht hat, was in dem Text oder Bild aufgerufen wird und wirkt. Gerade dieser technisch anmutende Zugang hat ihn nicht daran gehindert, Texte, Klänge und Bilder tief zu empfinden. Friedrich Kittler liebte gute Dichtung, von Homer über Gottfried von Straßburg über Ingeborg Bachmann bis Thomas Pynchon, schöne oder kluge Bilder und vor allem Musik – er hat sich im Schwelgen in Sprachklängen, Tonfolgen, Farben aber auch immer gefragt, welche technische, wissensgeschichtliche oder auch institutionelle Welt dahinter steht.
Friedrich Kittlers Schriften sollen in den nächsten Jahren erscheinen, als „Gesammelte Werke, Schriften, Stimmen, Hard- und Software“. Diese Ausgabe wird versuchen, sich diesem vielschichtigen und vielseitigen Denker auch in verschiedenen Medien zu nähern – die Schriften werden beim Wilhelm Fink Verlag gedruckt erscheinen, von Friedrich Kittler geschriebener Code sowie entworfene und montierte Schaltungen werden zudem auch im Internet veröffentlicht und in einer emulierten Hardware benutzbar gemacht, ebenso werden Ton- und Filmaufnahmen von Vorträgen oder Gesprächen präsentiert und kommentiert. An diesem innovativen Editionsprojekt werden ehemalige Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kittlers und auch ganz neu an diesem Projekt interessierte Forscher/innen beteiligt sein.
Tania Hron, 2013
Friedrich Kittler
Die Grenzen der Kunst, von denen ich zu sprechen versuchen werde, sind älter und schlichter als ihr Ende. Was Hegels großes Wort vom Ende der Kunst auf den Begriff brachte, war ein historischer Prozeß, der das Absolute als ästhetische Anschauung durch ein Absolutes der Vorstellung – die Religion – und ein Absolutes des Gedankens – die Philosophie – überholt oder aufgehoben hatte. Nach Hegels grandioser Lesart begann das Absolute als Stein, ging über in Bild und Ton, Malerei und Musik, erreichte schließlich – in einer höchsten oder letzten Kunst namens Dichtung – die Sprache und war eben darum schon keine Kunst mehr, sondern allgemeines Medium, das Gutenbergs Buchdruck genausogut wie Bibeln und philosophische Ästhetiken verarbeiten konnte.
Die Grenzen der Kunst kommen dagegen in einem technischen Prozeß zutage, der mit Alltagssprachen – und damit auch mit Religion oder Philosophie – nichts zu schaffen hat. Diese Grenzen nämlich haben erst die Ingenieure, als sie den Raum der Kunst überschritten, gesetzt oder hinterlassen. Auflösung im Gegensatz zur hegelschen Aufhebung (Weibel).
Grenzen nicht Unsagbarkeit, Erhabenes (wie Philosophen von Kant bis Lyotard gemeint haben), also vom Inneren des Kunstsystems her definierte Ränder oder Horizonte.
Malereinegativum von Photographie positiviert.
Alltagssprache als großer Speicher, in dem all die ästhetischen Umsetzungen stattfanden? Rückspulenkönnen der Redeteile als Modell? Oder wirklich piagetsche Fähigkeiten mit Bauklötzen, Linien? Vielleicht für Raumkünste, aber für Zeitkünste bleibt es bei Sprache. BACH. Dürers Zeichentechnik mit zwischengeschaltetem Raster: ein doppeltes Bild. So seit Brunelleschi. Das wundersame Loch im Bild, um ein anderes optisch einsetzen zu können.
Brunelleschi, Gutenberg und der Möglichkeitsgrund von Ingenieuren, die ihr Wissen nicht handwerklich-arkan-zünftig weiterzugeben brauchen.
Entsprechend Papermachine bei Turing. Das aber ein revolutionäres Konzept, das aller Geistmathematik Hohn sprach. Also wohl auch in aestheticis das reine Systemmodell unsere Zutat, wie Hegel sagen würde. Schon Hilbertprogramm eine Herausforderung (witzigerweise von einem, der Ingenieure verachtete). A fortiori Turings Grenzen der Mathematik.
Kommentar zum Begriff Interface. Schnittstelle nicht notwendig zwischen Maschine und Mensch, auch zwischen verschiedenen Maschinen möglich. Benutzerfreundlichkeit und andere Delirien. Schnittstellen ohne Standards sind keine; standardisieren sie also den Benutzer?
Brunelleschi
Symmetrie
Der Befehl, um zwei Daten an zwei verschiedenen Adressen zu vertauschen, muß über drei Plätze verfügen, wie jeder Assemblerprogrammierer zu seinem Leidwesen erfahren hat.
Aristoteles, eusynopton, Anfang, Mitte, Ende.
Kant, Erhabenes.
DSP, nicht EDV ist das Jenseits, das hinter den Grenzen aller Künste liegt.
Anschlußtaktiken rein verbaler Natur: bei selbsternannten Computerkünstlern.
Standards und Normen statt Stilen.
Schon Analogmedien schneiden jenseits der Wahrnehmbarkeit. Hörspielmischpult wandert um 1935 in allgemeine Radiosendepraxis (Erinnerungen eines alten Berliner Technikers, der sich selbst lieber "musischer Ingenieur" nannte).
Schon Analogmedien verbieten Regreß in Gesetzesfolge McLuhans: Schallplattenfoto der Préludes bestraft.
Dichte der Software perfektioniert das alles.
"Auflösung" (Weibel, Dumont)
Nicht nur Decodieren, sondern Auscodieren (oder unvollständig bleiben wie IBM und Folgeproblem).
Alle Rechte am Text liegen bei den Autoren.
--