

Das Theater soll eine Quelle hohen Kunstgenusses, sittlicher Erhebung und kräftiger Anregung zum Nachdenken über die großen Zeitfragen sein. Es ist aber größtenteils erniedrigt auf den Standpunkt der faden Salongeisterei und Unterhaltungsliteratur, des Kolportageromans, des Zirkus, des Witzblättchens. Die Bühne ist eben dem Kapitalismus unterworfen, und der Geschmack der Masse ist in allen Gesellschaftsklassen vorwiegend durch gewisse wirtschaftliche Zustände korrumpiert worden.
Indessen hat sich unter dem Einflusse redlich strebender Dichter, Journalisten und Redner ein Teil unseres Volkes von dieser Korruption befreit. Haben doch Dichter wie Tolstoi und Dostojewski, Zolà, Ibsen und Kielland, sowie mehrere deutsche "Realisten" in dem arbeitenden Volke Berlins einen Resonanzboden gefunden.
Für diesen (...) Teil des Volkes ist es ein Bedürfnis, Theaterstücke seiner Wahl nicht bloß zu lesen, sondern auch aufgeführt zu sehen. Öffentliche Aufführungen von Stücken, in denen ein revolutionärer Geist lebt, scheitern aber gewöhnlich am Kapitalismus, dem sie sich als Kassenfüller erweisen, oder an der polizeilichen Zensur.
Diese Hindernisse bestehen nicht für eine geschlossene Gesellschaft. So ist es dem Verein "Freie Bühne" gelungen, Dramen der angedeuteten Richtung zur Aufführung zu bringen. Da nun aber die Mitgliedschaft der "Freien Bühne" aus wirtschaftlichen Gründen dem Proletariat versagt ist, so scheint mir die Begründung einer "Freien Volksbühne" wohl angebracht zu sein. (...)
Von Dr. Bruno Wille
aus dem "Berliner Volksblatt" vom 23. März 1890
I. Ideale Bedeutung der Volksbühne
"Es geschehen noch Zeichen und Wunder. In dem Kriege, den unser Vaterland (...) zu führen hat, in Berlin, wo nach dem Programm unserer Feinde jetzt die Kosaken hausen sollten, in einem volkswirtschaftlichen Mangel, (...) überdies in einem Stadtteil, wo keineswegs die Begüterten wohnen, wird ein neues Theater eröffnet, vielleicht das größte und schönste in Groß-Berlin, ein Bau, der nebst Einrichtung etliche Millionen kostet. Keine Gruppe von Kapitalisten hat ihn unternommen, sondern das Volk selbst, und sein Betrieb ist nicht darauf gerichtet, Geschäftsgewinne zu verteilen, sondern dient vielmehr völlig dem Gemeinwohl, der geistigen Kultur, ein Werk und ein Werkzeug des Idealismus, bei dem kein persönlicher Eigennutz beteiligt ist. Die Volksbühne, dies neue Theater, soll und wird täglich etwa zweitausend Menschen zu echtem Kunsterlebnis erheben, und bedeutsam ist dabei der Umstand, daß ihnen ihre wirtschaftlichen Verhältnisse ihnen nicht gestatten würden, zehnmal jährlich ein gutes Theater, dazu noch andere Kunstdarbietungen zu genießen. (...)
Aus Anlaß der Kämpfe in Löwen und Reims hat man uns Deutschen vorgeworfen, wir seien Hunnen der Kunst gegenüber, und noch vor wenigen Jahrzehnten glaubte unsere öffentliche Meinung (..) das künstlerische Erlebnis großen Stils sei ein natürliches Vorrecht der Begüteren und „Gebildeten“, während Arbeiter und Kleinbürger Kunstbarbaren bleiben müßten. (...) Diese Hunnen und Barbaren haben es fertig gebracht, eine Weihestätte der Kunst zustande zu bringen, aus eigner Kraft, vermöge der hingebenden Arbeit, zu der unsere Losung „die Kunst dem Volke“ begeisterte, vermöge der Spargroschen, die Tausende von Unbemittelten in sechs Jahren zusammenbrachten und (..) vereinten. Was den „kleinen Leuten“ die Volksbühne sein kann, zeigt in rührender Weise die Tatsache, daß aus diesem Volkskreise selbst in den Kriegsmonaten Ersparnisse für unsere Sache hergegeben wurden, und daß inmitten dieser schweren Zeit (...) immerhin noch nahezu vierzigtausend Männer und Frauen in unserer Bewegung organisiert sind. (...)
Uns allen gebührt die Aufgabe, die breiten Volksmassen zu den Quellen edelster Bildung und künstlerischer Erhebung heranzuziehen (...). Es kommt (...) darauf an, die übergroßen Unterschiede zwischen den Volksteilen auch auf dem Gebiet des geistigen Besitzes nach Möglichkeit auszugleichen. So manchem Proletarier drückt das Bewußtsein, vor den Pforten jenes Kulturhauses bleiben zu sollen, wo die Gebildeten durch geistige Güter beglückt und erhoben werden. (...) So hat (...) eine Bildungsbewegung, die aus dem Volk selber gekommen ist, Stätten des geistigen Ausgleichs geschaffen, und zu diesen gehört die Volksbühne am Bülowplatz. (...) Hier sitzen nebeneinander Maurer und Kaufmann, Schlosser und Postsekretär, Volksschullehrerin und Geheimrat, Näherin und Student (...). Die Erlösungen, die das Kunsterlebnis Vertretern der einen Bildungsschicht verschafft, werden auch den anderen Schichten vermittelt. (...) Goethe sagt: wer Kunst besitzt, hat auch Religion. Für Schiller war die Schaubühne eine moralische Anstalt, und wem dieser Gesichtspunkt etwas hoch vorkommen sollte, sieht wenigstens ein, dass die Volksbühne vom gewöhnlichen, oft sittlich schädlichen Zeitvertreib, von Kneiperei und Tanzboden, von Kientopp und Schauer-Roman ablenkt, indem sie Geld, Zeit und Gemüt vielmehr für Edles in Anspruch nimmt und durch Aufgaben, die sie an Geist und Herz richtet, den noch wenig entwickelten Menschen zu Höherem erzieht. (...)
II. Zur Geschichte der Volksbühnenbewegung
Am 29. Juni 1890 fand im "Böhmischn Brauhaus" eine öffentliche Volksversammlung statt; etwa 2000 Männer und Frauen nahmen mit lebhafter Zustimmung meinen Vortrag auf, der (...) folgende Ideen darlegte:
"Die Kunst soll dem Volke gehören, nicht aber das Privilegium eines Teiles der Bevölkerung, einer Gesellschaftsklasse sein. Diese Forderung ist alt. Sie ertönte im alten Griechenland und ertönte wieder zur Zeit der Herder, Lessing, Goethe und Schiller. (...) Die "Freie Volksbühne" soll auch das Proletariat auf den Geschmack an wirklich edler Kunst bringen, sie soll ihren Teil beitragen zur Hebung der völkischen Lebensführung... Wer soll nun in der "Freien Volksbühne" spielen? Nicht Dilettanten, sondern tüchtige Berufsschauspieler. Auch die Lokalfrage ist nicht so schwierig (...). Es sind mehrere Theaterdirektoren, die ihre Räumlichkeiten gegen einen ziemlich geringen Preis zur Verfügung stellen. (...) Die Höhe des Beitragsgeldes ist dem Ermessen, der Ehrlichkeit und dem Können der Mitglieder zu überlassen. Ein Mindestbeitrag von 50 Pf. für jede Vorstellung ist unumgänglich notwendig. Wer mehr zahlt, ermöglicht dadurch minder Bemittelten den Eintritt. (...) Als Zeitpunkt der Vorstellung empfiehlt sich der Sonntagnachmittag."
So kam die "Freie Volksbühne" zustande, und der Begründer wurde zum Vorsitzenden gewählt. Am 19. Oktober 1890 fand im Ostendtheater die erste Volksbühnen-Aufführung (Ibsens "Stützen der Gesellschaft") vor 1000 Mitgliedern statt. (...)
Die Entwicklung der "Freien Volksbühne" blieb nicht von Stürmen verschont. Einer kam von innen, aus Meinungsverschiedenheiten nicht bloß sozialpolitischer und persönlicher Art, sondern auch hinsichtlich der Volksbühne, die ich nicht bloß als einen künstlerischen Konsumverein und vollends nicht als Domäne einer Partei gelten lassen mochte. Einig mit fast allen Mitgliedern des literarischen Ausschusses und der Ordnerschaft, verließ ich nebst meinem Anhang eine tosende Generalversammlung und begründete (am 22. Oktober 1892) die "N e u e freie Volksbühne", deren Vereins-Satzungen ein Ausdruck der Erfahrung war, daß die künstlerische Leitung einer Gruppe von Sachverständigen anvertraut werden muß, die tendenzlose Kunst volkserzieherisch vermitteln, daher unabhängig vom Versammlungsgetriebe bleiben soll. Nun gab es z w e i Volksbühnen, von denen jede auf ihre Art wirken konnte, und daß sie beide nebeneinander bestanden, beweist die Lebenskraft der Bewegung. Die "Neue freie Volksbühne" spielte lange Jahre hindurch nur Stücke eigener Wahl, die in gemieteten Theatern durch Regisseure von großen Fähigkeiten (...) mit einer von Fall zu Fall kombinierten Truppe von Schauspielern inszeniert wurden (...).
Erst seit die "Neue freie Volksbühne" in der Lage war, das eigene Theater zu bauen, kam eine Annäherung der beiden Organisationen zustande. Es wurde der Verband der freien Volksbühnen gegründet, indem jeder Verein seine Selbständigkeit und Sonderart behält, der aber gemeinsame Wirtschaftsführung vorsieht. Das Haus am Bülowplatz kommt beiden Vereinen gemeinsam zugute.
III. Das eigene Theater. Wie kam es zustande? Aus welchen Beweggründen erwuchs es? Wie wurden die Mittel beschafft?(...) Im Jahre 1909 schrieb Dr. Ettlinger in der Vereinsschrift:
"Seit mehr als sechs Jahren...verfolgt die Vereinsleitung unausgesetzt das Ziel, den Verein auch insofern auf eigene Füße zu stellen, daß ihm ein eigenes Bühnenhaus als Besitz zuteil wird. Unsere ganze Verwaltungspolitik (...) war in der Hauptsache (...) auf dieses Ziel eingestellt (...). Mit anderen Worten: es hieß so lange zu arbeiten, vorzubereiten und ohne Übereilung die Entwicklung der Dinge abzuwarten, bis gegen jede Möglichkeit eines Fehlschlages die denkbar größte Sicherheit gegeben war. Wenn wir heute über 27 000 Mitglieder in 31 Abteilungen zählen, durch neue Verträge für das Spieljahr 1909/10 die Zahl der von uns gepachteten Theater auf 11 erhöht und damit die Möglichkeit haben, im kommenden Jahr auf 36 000, je nach Bedarf und Erfolg auf nahezu 40 000 Mitglieder zu steigen, so können wir mit gutem Gewissen den Zeitpunkt für gekommen erachten, die bisherigen theoretischen Erwägungen und Wünsche bezüglich eines eigenen Hauses allmählich in Wirklichkeit umzusetzen."
(...) der Verlagsdirektor Georg Springer, seit mehreren Jahren erster Vorsitzender der Neuen freien Volksbühne, hielt (...) einen Vortrag, in dem es hieß:
"Ein Haus soll geschaffen werden, das der Erhebung und Veredlung des Volkes dienen soll, unabhängig, frei von allen Rücksichten und Tendenzen, die von diesem Ziel ablenken könnten, einzig dem Zwecke geweiht: dem arbeitenden Volke künstlerischen Genuß, befreiende Erholung und Anregung zu schaffen. Dieses Haus, das Volk selbst soll es sich schaffen! In kleinen und kleinsten Beiträgen soll aus seiner Mitte das Bauvermögen hervorgehen, das zu diesem großen Werke nötig ist. Nicht kapitalistische Unterstützung, nicht Stiftungen und Geschenke sollen dazu herbeigezogen werden; das arbeitende Volk allein soll es aufbringen."
(...) Wenn es auch nicht gelingen konnte, binnen dreier Jahre das eigne Haus zu verwirklichen (...), und wenn auch der Plan eines Volkskunsthauses, das neben der Bühne noch andere wertvolle Kunstanlagen haben sollte, an den Verhältnissen gewisse Einschränkungen erlebte, so steht am Ende des sechsten Jahres die Bülowplatz-Bühne in Zweckmäßigkeit, Gediegenheit und Schönheit da. Vor wenigen Jahren noch gab es hier ein Stück Alt-Berlin, schmale Straßen mit unansehnlichen Häusern (...); nach Abtragung der Gassen entstand eine freie Fläche, und es war ebenso klug wie human von der Stadtverwaltung, daß sie den Gedanken der Neuen freien Volksbühne, auf dem Bülowplatz ihr stattliches Eigenheim zu errichten, unter Gewährung einer Hypothek begünstigte. (...)
IV. Einzelheiten über den Bau.
Das Theater am Bülowplatz ist eine Gründung der Neuen freien Volksbühne e.V. Im Januar des Jahres 1909 beschloß der Verein, einen Baufonds zur Errichtung eines eigenen Schauspiel-Hauses zu sammeln; der Verein gab einen Teil seines Vermögens als Grundlage und aus teils freiwilligen, teils obligatorischen Beiträgen der Mitglieder sammelte sich (...) eine Summe, groß genug, um den Bau in Angriff nehmen zu können. Am 14. September 1913 konnte in feierlicher Weise der Grundstein gelegt werden. (...) Entwurf und Bauleitung waren dem bekannten Theaterbaumeister Dipl. Ing. Oskar Kaufmann, Berlin, übertragen; die Bauausführung übernahm die Union Baugesellschaft auf Aktien in Berlin, unter Leitung des Herrn Regierungsbaumeister a. D. Hirte. Das Grundstück, auf dem sich das neue Haus erhebt, hat eine Größe von 4566 Quadratmetern, das sind rund 322 Quadraturen; es liegt mit einer Front von je 55 Metern am Bülowplatz und an der Linienstraße, zwei je 13 Meter breite Privatstraßen begrenzen das Haus rechts und links, so daß das Theater von allen Seiten frei steht. (...) Die Front am Bülowplatz ist ganz in Kirchheimer Muschelkalk geführt, der reiche figürliche Schmuck stammt vom Bildhauer Prof. Metzner. Die Seitenfronten und die Ansicht an der Linienstraße sind in Edelputz geputzt, das Hauptdach am Vorderhaus ist in Kupfer ausgeführt, die übrigen Dachflächen sind mit grauen holländischen Pfannen gedeckt. Durch die sechs Riesensäulen der Front am Bülowplatz, die 13 Meter hoch sind, bei 1½ Meter Durchmesser, gelangt man durch fünf breite Türen in die Kassenhalle, einen (...) Raum von rund 180 Quadratmeter Grundfläche, von dem rechts und links je drei Treppen zu den Ringen empor führen. (...) Insgesamt enthält das Haus 2000 Sitzplätze; davon entfallen auf das Parkett 1060, auf den ersten Ring 370, auf den Mittelring 315 und auf den Oberring 255 Plätze. (...) Die Bühnenanlage besteht aus der großen 21 Meter im Durchmesser haltenden Drehbühne und zwei Seitenbühnen mit einer Gesamtbreite von ca. 40 Metern. Die Drehbühne, deren Konstruktion von Ingenieur Knina stammt (...), eine der größten bisher überhaupt ausgeführten stationären Drehbühnen, ist mit bedeutsamen technischen Neuerungen versehen. So ist die ganze Hälfte der Bühne versenkbar und hebbar, ebenso nach oben und unten schräg verstellbar. Der mächtige gemauerte Kuppelhorizont - der erste dieser Art in Berlin - erhebt sich bis zu einer Höhe von 26 Metern über den Bühnenboden; das Dach des Bühnenhauses liegt 42 Meter über der Straßenkrone. Ein versenkbares Orchester, das auch hebbar und dann als Vorderbühne benutzbar ist, gewährt Raum für 80 Musiker. Hinter der Bühne an der Linienstraße liegen in fünf Etagen übereinander die Künstler-Garderoben, Statistenräume usw. Rechts und links an den Privatstraßen haben die für den technischen Betrieb erforderlichen Räume, Magazine, Maler, Schneider, Schlosser und Tischler-Werkstätten usw. ihren Platz gefunden. (...) Der gesamte Gebäudekomplex bedeckt eine Fläche von etwa 3500 Quadratmetern; die Baukosten, ohne Grunderwerb und Nebenspesen, beliefen sich auf rund 2 ¼ Millionen Mark."
Von Dr. Bruno Wille
Im Namen des Vorstandes unseres Vereins heiße ich Sie im Hause der Neuen freien Volksbühne willkommen. Es war nicht unsere Absicht, Sie so in der Tracht und der Sprache des Alltags zu begrüßen. Ein riesiger Knecht aus dem Gefolge des Ritters Götz sollte in der schönen Tracht seiner Zeit vor Sie hintreten und mit festlichen Versen zu Ihnen sprechen. Und um dem Geist dieser Stunde gerecht zu werden, sollte er mit dem schweren Eisen seiner Lanze den Vorhang heben. Es scheint aber, als ob der Geist unserer Tage, als ob die Welt des großen Krieges zu grimmig ernst ist, um sich mit solch einem spielenden Gleichnis begnügen zu können. (...)
Nachdem wir uns durch eine nicht aufzuzählende Reihe von Schwierigkeiten glücklich hindurchgekämpft hatten, ist unsere Bühne in der letzten Nacht während der Dekorationsprobe von einem Maschinenbruch heimgesucht worden, der den halben Spielraum unbenutzbar machte, und bei der geringen Arbeitskräfte, die der Krieg zu Friedenswerken übriggelassen hat, war es trotz aller Bemühungen nicht mehr möglich, diesen Übelstand bis zur Stunde zu beheben. So ist es meine erste und wenig liebsame Pflicht, Ihnen anzukündigen, daß nicht eine Aufführung des „Götz von Berlichingen“ an diesem Abend unser Theater einweihen kann, sondern daß Björnstjerne Björnsons letztes Bühnengedicht, das Lustspiel "Wenn der junge Wein blüht", jetzt in Szene gehen soll. (...)
Gleichwohl möchte ich Sie bitten, von dieser Enttäuschung sich nicht stimmen zu lassen, wenn Sie Ihre Blicke über dieses Haus senden - dies Haus, das das Werk eines namhaften Künstlers, aber die Schöpfung einer großen namenlosen Menge ist - , der Mitgliedermenge des Vereins der Neuen freien Volksbühne, der Menge, die Sie zu Gaste geladen hat und in deren Namen ich zu Ihnen zu sprechen die Ehre habe. (...)
Dies Haus gehört so wahrhaft dem Volke, wie kein anderes, der Kunst geweihtes Gebäude in der ganzen Welt. Wir danken auch in dieser Stunde der moralischen und materiellen Unterstützung, die die Stadt Berlin dem Unternehmen im letzten Stadium zu Teil werden ließ, aber wir sind auch in dieser Stunde schuldig, unseren Mitgliedern nachzurühmen, daß die Groschenbeiträge von 50000 unbemittelten Kunstenthusiasten den Baufond geschaffen haben, durch dessen Existenz eine unterstützungswürdige Bewegung erst anheben konnte. (...)
Was Sie hier als Ergebnis der 25-jährigen Arbeit unseres Vereins vor sich sehen, das soll kein Ende sondern ein Anfang sein, der Anfang einer freien und starken Arbeit, für die wir nun erst den rechten, den eigenen Boden erreicht haben. Und es soll über uns selbst hinaus der Anfang einer Bewegung sein, die auf allen Gebieten das Volk wieder zur Kunst, die Kunst wieder zum Volke führt. (...)
Von Julius Bab
P.S. Nicht alle hatten schon das Abendblatt gelesen, als sie sich in das reizende Mahagonikästchen setzten, das trotz seiner großen Ausdehnung durchaus nicht wie ein Kasten wirkt. Man erwartete Götz - Goethes treuen Lerse im Landknechtswams und war sehr überrascht, als stattdessen der Prologdichter selbst zwischen den Vorhängen erschien und, den einen Fuß auf den Soufflierdeckel gestützt, eine längere Ansprache hielt. Sehr geschickt erzählte Julius Bab von den Schwierigkeiten des großen Werkes einer Bühne, die sich das Volk selbst aus Spargroschen gebaut hat, und wie jetzt im Augenblick der Vollendung diese Schwierigkeiten dadurch gekrönt werden, daß am Tage der Eröffnung ein Fehler im technischen Apparat nicht rechtzeitig ausgebessert werden konnte. Herr Bab machte das durchaus glaubwürdig: wer mit Hemmnissen des Theaterbetriebs vertraut ist, wundert sich, daß dergleichen nicht öfter zustößt.
Mit Gewandtheit und stimmlicher Wärme lenkte der Redner das Publikum vom kraftgenialen Sturm und Drang des jungen Goethe und seines Freiheitsdranges zur fröhlichen Weisheit des greisen Björnson über, und nachdem ein wohltemperiertes Murren rasch überwunden war, wurde der Hiobsbote in voller Gunst entlassen. Unter dem wunderschönen Prospekt, der das sommerlich blaue Himmelsgewölbe täuschen darstellte, vollzog sich nun die bereits bekannte und besprochene Aufführung von Björnsons letztem Lustspiele ‚Wenn der junge Wein blüht‘. Es war nicht ganz das Richtige, aber es war doch auch etwas, und im übrigen tat das neue Haus seine Schuldigkeit.
Auch im Publikum war manches Interessante zu sehen. Im Mittelpunkte des ersten Stocks zeigten sich den Berlinern ihre beiden Bürgermeister Wermuth und Reicke, die so friedlich und freundlich nebeneinander saßen, daß das Heil der Stadt auf Jahre hinaus gesichert schien. Bei den Ratsherren von Heilbronn, vor denen der Berlichinger erscheinen sollte, wäre es weit wüster zugegangen. Mit noch tieferer Rührung und Ehrerbietung als auch die hochwohllöblichen Stadthäupter sah ich auf den großen, noch immer braunen Vollbart und auf die große, noch immer braune Mähne, die rechts oben auftauchten. Denn sie gehörten dem Doktor Bruno Wille, dem Urvater des Gedankens der Freien Volksbühnen. Wenn irgendwann, so mußte er am gestrigen Festabend fühlen, daß er nicht umsonst in Berlin gelebt, gelehrt, geschaffen hat. Preis ihm und Ehre vor allen anderes! Überblickt man in der Erinnerung die Arbeit der ganzen fünfundzwanzig Jahre, so ist es höchst gleichgültig, ob der „Götz von Berlichingen“ noch 1914 oder erst 1915 erscheint.
Als ich hinaustrat auf den werdenden Bülowplatz, verklärte der friedfertige Gefährte unseres Lebens, der volle Mond, die Säulen des Eingangs. Er schien ihn vom Himmel hoch herab zu segnen.
(Berliner Tageblatt, 31.12.1914)
Ist man bereit beizutreten, so gehe man zu der der Wohnung am nächsten liegenden Zahlstelle des Vereins. Dort hat man Name, Stand und Adresse genau anzugeben und Mk. 1,50 Einschreibegeld zu bezahlen. Nach einigen Tagen holt man sich in der Zahlstelle die Mitgliedskarte ab. In dieser ist genau vorgedruckt, wann und wo das Mitglied seine Vorstellungen erhält; auch ist der jeweilige Preis der zu einer Vorstellung (Mk. 1,50 bis Mk. 2,00) angegeben. Einige Tage vor seiner Vorstellung geht das Mitglied zu einer der mehr als 200 in der ganzen Stadt verteilten Zahlstellen, bezahl dort den entsprechenden Beitrag und klebt die dafür erhaltene kleine Marke in das in der Mitgliedskarte vorgesehene Feld ein. Es steht den Mitgliedern frei, mehrere oder alle Vorstellungsmarken gleichzeitig zu erwerben und in die Migliedskarte zu kleben. Am Tage der Vorstellung begibt man sich rechtzeitig - möglichst ¼ bis ½ Stunde vor Beginn - in das Theater. Dort folgt man den Weisungen der mit Schleifen bezeichneten Ordner. Diese sind ehrenamtlich tätige Mitglieder des Vereins - keine Angestellten - also Vertrauensleute. Die den Mitgliedern zukommenden Plätze im Theater werden verlost. Es stehen zu diesem Zwecke Urnen in der Kassenhalle jedes Theaters. An der Urne wird die jeweilige Beitragsmarke durch einen Ordner gelocht, worauf das Mitglied sein Billett der Urne selbst entnimmt. Für Eheleute, Brautpaare, Geschwister usw. die gern zusammensitzen, sind Urnen mit Doppelbilletts vorhanden.
Die Zeitschrift "Volksbühne" wird jedem Mitglied alle zwei Monate gratis zugeschickt. Sie enthält ein Verzeichnis der zur Aufführung gelangenden Stücke, belehrende und unterhaltende Beiträge, sie bringt alle Vereinsnachrichten. In der Zeitschrift sind außer den Theatervorstellungen auch alle Konzerte, Vorträge, Leseabende usw. angezeigt. Es ist dort angegeben, wo sie stattfinden, wo die Karten zu haben sind usw. Diese Angaben sind jeweils genau zu beachten.
Der Eintritt in die Vereine kann jederzeit erfolgen. Bis zum Tage der Anmeldung bereits stattgefundene Vorstellungen sind nicht nachzuzahlen.
Die Mitglieder sind in Abteilungen gegliedert, deren Zahl z.Z. 154 beträgt und die je 6-800 Köpfe umfassen. Die Abteilungen sind sämtlich gleichwertig, ohne Rücksicht auf ihre Nummern.
Die Vereinsvorstellungen finden z. Z. statt in der Volksbühne, Theater am Bülowplatz, im Schiller-Theater Charlottenburg, Deutsches Opernhaus, Lessing-Theater, Deutsches Künstler-Theater, Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater, Theater des Westens und Centraltheater. - Es gibt
a) Abend-Abteilungen, deren Vorstellung nur Wochentags stattfinden (6 in der Volksbühne, Theater am Bülowplatz und 4 in den vorgenannten Theatern).
b) Gemischte Abteilungen mit 6-7 Wochentag- Abendvorstellungen, davon 4-6 in der Volksbühne und 4-6 Sonntagnachmittagsvorstellungen in den anderen genannten Theatern.
c) Nachmittags-Vorstellungen mit nur Sonn- oder Feiertag- Nachmittagsvorstellungen, und zwar 5 in der Volksbühne, Theater am Bülowplatz und 6 in den anderen genannten Theatern.
(aus: Wesen und Weg der Berliner Volksbühnenbewegung. Herausgegeben von Julius Bab im Aufrage des Verbandes der Berliner Volksbühnen. Berlin 1919.)
„Ja mir kommt die Krise selber überraschend, genau so, wie meinen Schauspielern. Es ist überhaupt ein Unding, daß ich als Konzessionär für die finanzielle Lage des Theaters im vollen Maße haltbar gemacht werde, während ich doch nur für die künstlerische und rein artistische Leitung verantwortlich zeichne. Aber daß ich jetzt die Konzession niedergelegt habe, ist eine innerbetriebsmäßige Maßnahme. Ich habe mit ihr meine ersten dringenden Verpflichtungen befriedigt und kann zu einem gegebenen Zeitpunkt meine Arbeit wieder aufnehmen. - Es ist ja auch nicht das erste Mal, daß man mir die Konzession entzogen hat. 1920, als ich das proletarische Theater leitete, zog St. Bürokratius schon einmal gegen mich zu Felde, weil ich in einer Zeitung geschrieben hatte: Die Kunst ist nur ein Mittel im Klassenkampf. Mir wurde daraufhin prompt die Konzession entzogen. D.h. eigentlich spielten da noch andere Dinge hinein. Der Bühnenverein war damals sehr böse mit mir, womit ich nicht sagen will, daß wir heute in reiner Seelenfreundschaft verbunden sind. Das ist überhaupt der prinzipielle Trugschluß, bei der Erteilung einer Theaterkonzession finanzielle und artistische Dinge zu verquicken. Sehe ich etwa aus wie eine juristische Person!“
„Aber wie erklären Sie das Defizit bei den angeblichen hohen Einnahmen?“
„Es ist wahr, wir haben an den ersten Stücken gut verdient. HOPPLA WIR LEBEN brachte uns durchschnittlich 3000 Mark pro Abend. RASPUTIN gab eine Abendkasse von 5000 und mit dem SCHWEJK hatten wir immer eine Durchschnittseinnahme von 8000 bis 10000 Mark. Ich möchte übrigens in diesem Zusammenhange betonen, daß wir durchaus keine Phantasiegagen an unsere Schauspieler gezahlt haben. So erhielt z.B. Pallenberg 500 Mark pro Abend, und nicht Tausende, wie viele Blätter schrieben. - Aber in der letzten Zeit, ungefähr von März ab, hat unser Theater als Geschäft unter einem ungünstigen Stern gestanden. Die Übernahme des Lessingtheaters ging über unsere Kraft. Auch das Publikum blieb uns nicht treu. Wir haben pro Abend etwa 3000 Mark eingebüßt. Unter dem Druck dieser finanziellen Verschlechterung war ich auch nicht imstande, gute und teurere Stücke zu erwerben, sondern nahm, was ich bekam und was ich irgendwie in den Rahmen meines Spielplanes einfügen konnte. Das soll durchaus kein Vorwurf gegen die Autoren sein, sondern nur eine Feststellung.“
„Haben Sie die Autoren gefunden, die Sie für Ihr Theater gebrauchten?“
„Ich bin mir bewußt, daß ich Theater in einer Übergangszeit spiele. Das gilt übrigens für alle anderen Theater auch. Und hierin liegt auch schon mein Urteil begründet. Gewiß, wir haben viele bemerkenswerte Versuche und halbgeglückte Experimente, unsere Zeit dramatisch auszuschöpfen. Aber uns fehlt, wenn ich mich so ausdrücken will, der kommunistische Shakespeare, wobei ich auf den Shakespeare mehr Gewicht lege, als auf den Kommunisten.“
„Also etwas verstimmt gegen die KPD?“
„Ich bin persönlich Kommunist und habe keinerlei Veranlassung, meine Überzeugung zu ändern. Aber die landläufige Meinung, daß mein Theater eine kommunistische Filiale ist, wird wohl am besten durch die Tatsache zerstört, daß gerade die kommunistische Presse teilweise die schärfste Kritikerin meiner Stücke gewesen ist. Gegen Toller, wie auch gegen Schwejk richtete sich ganz besonders dabei eine Ablehnung, der ihre Tendenz zu pazifistisch und zu wenig revolutionär war. Und ich will offen zugeben, daß ich derselben Meinung war, aber hier waren eben die Verhältnisse stärker als mein Wille.“
„Und das neue Kollektiv-Theater?“
„Schönes Programm - aber keine Tatsachen. Gewiß habe ich viele Stücke von Arbeiterdichtern erhalten. Sie waren alle ungeheuer gefühlsecht, aber formal ungekonnt. Mit ist das nicht verwunderlich. Unser Proletariat von heute hat noch keine eigene Kultur. Es schafft sich erst eine. Es lebt noch zu nahe an der Wirklichkeit - um diese schon aus dem Abstand sehen zu können, der erst die wahre dichterische Gestaltung erlaubt.“
„Aber wo bleibt dann die revolutionäre Tendenz?“
„Im Vertrauen gesagt, mein Freund, diese ewige Revolution der Worte stumpft die Gehirne ab und ermüdet die Herzen. Ein Film, wie „10 Tage, die die Welt erschütterten“ hinterläßt für mich nur eine grenzenlose Leere, da er an der Peripherie des Geschehens bleibt, nicht aber die Entwicklung, die notwendige Vorwärtsbewegung des Geschehens aufzeigt. Es ist nicht einmal in diesen Dingen etwas von der sozialen Ökonomie der Darstellung - wie sie doch als erste Voraussetzung zu fordern wäre. Es ist deshalb auch kein Zufall, daß man sich in Rußland gerade auf diesem Gebiete der Darstellung rein menschlicher Themen wieder zuwendet. Ich möchte einmal ein Stück inszenieren können, das aus ganz einfachem Geschehen heraus, ohne alle historischen und materiellen Voraussetzungen, durch die einfache Dynamik seiner theatralischen Handlung ein großes Sinnbild allgemein gültigen Geschehens gibt.“
„Aber da muß die Diskrepanz zum Publikum doch noch viel größer sein, als wir bislang glaubten.“
„Ja, ich kenne die mehr oder minder witzigen Anspielungen auf das Parkett von Smokings, vor denen ich revolutionäres Theater spiele. Aber ich sage Ihnen ganz offen, daß es für mich keine Schande ist, vor dem Bürger zu spielen. Denn ich habe hier den Vorzug, daß der Bürger vorbereitet ist, auch auf Außergewöhnliches, auch auf Dinge, die ihm contre coeur gehen. Und gerade deshalb ist bei ihm die Möglichkeit größer, daß er nachgibt vor wirklicher Kunst. Und Sie glauben doch selber auch, daß der intellektuelle Mensch schließlich und letztlich eher den Sprung über den Eigentumsbegriff bei einer wirklichen sozialen Revolution tun wird, wenn man ihn begrifflich dazu vorgebildet hat! Diesem Zweck dient ja auch mein Theater. Gewiß, ich bin Kommunist und meine Lebensaufgabe gilt dem Proletariat. Aber ich muss offen sagen, daß ich erst dann mich auch bei den Arbeitern durchgesetzt habe, nachdem ich vom bürgerlichen Publikum anerkannt wurde. Man hat mir gesagt, ich sollte in der Müllerstraße Theater spielen! Ich habe es ja getan und der Erfolg war negativ. Glauben Sie denn, wenn ich heute in ein proletarisches Viertel ziehe und dort meine Bühne aufschlage, daß an dem grundsätzlichen Charakter meines Theaters etwas geändert wird? Es wäre dort wie hier der gleiche Kampf. Und noch eins! Einige meiner Stücke haben, das will ich ganz sachlich konstatieren, Welterfolg gehabt. Aber diese propagandistische Wirkung, auf die es doch wohl ankam, wäre nicht zu erreichen gewesen, wenn ich etwa in Neukölln vor einem noch dazu formal ungeschulten Publikum und unter der Decke gespielt hätte. Ich gebe mich eben über die Zusammensetzung des heutigen, sagen wir: Volksbühnen-Publikums keiner Täuschung hin. Es überwiegt dort heute noch der Standpunkt des „aus-dem-Theater-etwas-mit-nach-Hause-Nehmens“, d.h. man will die Klassiker oder Unterhaltungsmusik. Gewiß ist das nützliche und wertvolle Arbeit, aber der Kontakt mit dem dramatischen Leben fehlt.“
„Und was werden Sie nun weiter tun?“
„Arbeiten und nicht aus der Folge gehen. Das ist das einzig Wichtige. Aber auf mich kommt es dabei auch gar nicht so sehr an“
Von Hans Wesemann
Die Volksbühne war jung, als auch ich jung war. Unter ihren Gründern sind nahe Freunde von mir gewesen. Sehr viel Glaube, Liebe, Hoffnung und guter Wille wurde in ihren Grundstein gelegt. Bis zum heutigen Tage hat das Werk, ich sage das schöne, sage das große Werk, Bestand gehabt. Was alles dazwischen liegt, wissen wir - nicht nötig, das Furchtbare aufzurühren, nicht nötig, die Gefahren zu schildern, die das Werk von damals bis heut überwunden hat. Auch der alte Geist ist noch vorhanden in ihr, der heutigen Volksbühne, die tragenden Ideen eines Lessing, Schiller, Goethe sind noch nicht gestorben in ihr. Viel Idealismus, mit praktischer Klugheit verbunden, hat sich durchgesetzt. Fast erstaunlich, dass es so ist!
Ob in einem anderen Lande als in Deutschland und Deutschösterreich das Theater ein gleich unumgängliches Kulturelement geworden ist, weiß ich nicht. Es scheint mir beinahe unwahrscheinlich. Bühnen, über das ganze Land verstreut, geben den Gedanken nicht auf, zugleich der Kunst und dem Volke zu dienen. Die höchsten Beispiele scheinen mir, allerdings auf verschiedenen Ebenen, Bayreuth und die Volksbühne.
Um von dem allgemeinen Geist, der das deutsche Theater trägt, eine Probe zu geben, zitiere ich aus einer Schrift, die Richard Wagner mit etwa sechsunddreißig Jahren verfaßte: „Die Kunst und die Revolution“.
„…die eigentlich wirkende Kunst ist aber durch und seit der Renaissance noch nicht wiedergeboren worden; denn das vollendete Kunstwerk, der große einige Ausdruck einer freien, schönen Öffentlichkeit, das Drama, die Tragödie, ist - so große Tragiker auch hie und da gedichtet haben - noch nicht wiedergeboren, eben weil es nicht wieder geboren, sondern von Neuem geboren werden muß.“
Und er fährt fort: „Die Aufgabe, die wir von uns haben, ist unendlich viel größer als die, welche bereits einmal gelöst worden ist. Umfaßte das griechische Kunstwerk den Geist einer schönen Nation, so soll das Kunstwerk der Zukunft den Geist der freien Menschheit über alle Schranken der Nationalitäten hinaus umfassen.“
Das ist eine Zielsetzung, die man überstiegen nennen mag, aber: „Den lieb‘ ich, der Unmögliches begehrt“, und ohne ein solches immer wiederkehrendes höchstes Begehren ist das deutsche Theater nicht zu denken.
Freilich ist es heute schwere als je, hohe Ideen ins Auge zu fassen. Das allgemeine Leben hat eine ungeheure Intensität erreicht, unmittelbare und darum auch wichtigere Aufgaben drängen sich in den Vordergrund. Das umschränkte Leben einer umschränkten Volksfamilie und ihrer besonderen geistigen Anliegen ist allenthalben bedroht, weil schützende Mauern kaum noch vorhanden sind und technische Wunder eine Weltkommunikation durchgesetzt haben, vor der selbst Mauern nicht mehr standhalten.
Trotzdem darf sich der einzelne und das einzelne nicht aufgeben, ebensowenig wie irgendeine selbstbewußte Minderheit. Solche einzelne und solche Minderheiten hat es immer gegeben, und viele sind darunter, die der Ereignisflut von Jahrhunderte und Jahrtausenden erfolgreich getrotzt haben. Und wäre es nicht so, wir ständen vor jenem schrecklichen Tor, über welchem Dante die Worte „Lasciate ogni speranza!“ geschrieben fand.
Denn so allein kann sich ein Völkerfortschritt durchsetzen, daß die große Gemeinschaft den einzelnen gebiert und trägt, auch im Geistigen. Aus dem Volksboden oder der Volksseele wachsen - möge uns die Entwicklung nicht widerlegen! - immer wieder große und freie Geister auf, die den letzten und höchsten Sinn der Volksgemeinschaft in sich verwirklichen. So werden sie wiederum belebender und bereichernder Allgemeinbesitz. Möchte dieser Prozess selbst in einer politisierten Welt kämpfender Dogmen immer wieder verstanden werden, nicht nur auf einzelne Personen, sondern auch auf die schon erwähnten Minderheiten ausgedehnt, denen die Menschheit so vielen, wenn nicht alles zu verdanken hat. Möge die Volksbühne ihrem Geist, will sagen, dem Geist einer solchen schöpferischen Minderheit immer treu bleiben, wie sie ihm bisher treu geblieben ist!
Sie sei ein Asyl, eine Festung, eine Burg des freien geistes und freier Geister, die alle starren Dogmen abweisen! Vor diesem Geist, der hier besonders durch die dramatische Kunst wirksam wird und werden soll, sind alle Menschen gleich, wie vor dem Arzt oder dem Gesetz. Dieser Geist, diese Geister haben keinerlei Auftrag außer dem kategorischen Imperativ zur Humanität, zur Menschlichkeit, der sich aus ihnen selbst gebiert, abgesehen von der hohen Berufung zur Kunst, der sie sich würdig zu zeigen haben. Fast immer sind sie beherrscht von dem tieftragischen Lebensgefühl, das ans ich mit Humanität gleichbedeutend ist und aus dem auch die höchsten Humore erwachsen. Solchen Geist, solche Geister muss die Volksbühne weiter alle fanatisch dogmatischen Zeiterscheinungen gegenüber als Ewigkeitswerte umhegen, schützen und wirksam machen. Auch gegen das hyperzerebrale Wesen der Zeit muss sie diesen Geist unbeugsam verteidigen. Denn wo er seiner Vollendung nahekommt, ist es ein Geist schlichter Größe und Einfachheit. Dass der Volksbühne dieser Beruf stets bewusst bleibe, der Erfolg aber treu, ist mein Geburtstagswunsch!
Von Gerhart Hauptmann
Berlin, im Juni 1933.
Mit diesen Zeilen verabschiedet sich unserer Zeitschrift ("Die Volksbühne", Anm. d. A.) von ihren Lesern. Mit diesen Zeilen erfüllt sich außerdem das Schicksal der deutschen Volksbühnenbewegung.
Im Zuge der nationalen Revolution erfolgt in diesen Wochen die Eingliederung der deutschen Volksbühnenvereine in die vom Kampfbund für deutsche Kultur geschaffene neue Besucherorganisation, den "Reichsverband Deutsche Bühne e. V.", die einzige staatlich anerkannte Theaterbesucherorganisation. Der Verband der deutschen Volksbühnenvereine wird aufgelöst werden. Die in ihm zusammengefaßten Werte werden künftig teils - in neuen Bilanzen - auf Null abgeschrieben oder als wesentliche Aktivposten erscheinen. Aber das Hauptbuch der deutschen Volksbühnenbewegung ist abgeschlossen. (...)
Es ist unfruchtbar mit dem Schicksal zu hadern. Diese Schlußphase der deutschen Volksbühnenbewegung kann in wenigen Worten dargestellt werden: Wir haben gearbeitet und unser Bestes gegeben, dreizehn Jahre lang. Wir haben, was unser ärgster Feind uns nicht bestreiten wird, den entscheidenden Vorstoß gemacht zur kulturellen Emanzipation der minderbemittelten Volksschichten. Wir haben gleichzeitig dem deutschen Theater eine Armee neuer, treuer, kunstbegeisterter Menschen zugeführt. (...) Der "Systemwechsel" ließ uns ruhig. Wir hatten nichts zu verbergen, hatten uns nicht zu entschuldigen. Unsere Leistung sollte unsere Legitimation sein. Die neuen Herren sind der Meinung, daß für uns kein Platz sei im neuen Staate. Ein neuer Wille herrscht. Man anerkennt unsere Leistung zwar, nicht aber unser Mandat. Es blieb die Wahl zwischen nutzloser Vernichtung oder organischem Einbau unseres Werkes in eine neue Form. Mit der Liebe des Schöpfers zu seinem Werk haben wir die Wahl getroffen. (...) (...) Die deutsche Volksbühnenbewegung tritt makellos vom Schauplatz ihrer Tätigkeit ab. (...)
Das Ende sei kurz. Was wir geschaffen und geschafft haben, war nicht umsonst. (...) Das deutsche Theater wird immer wieder seine lebendigsten Kräfte aus den Quellen ableiten müssen, die von der deutschen Volksbühnenbewegung erschlossen worden sind. Insofern ist die deutsche Volksbühnenbewegung nicht tot. Der Feind, der uns am schlimmsten haßte, war die Reaktion. Die neuen Sachwalter des Volksbühnenguts haben den Willen und die Macht dazu, jenem Wort Geltung zu verschaffen, das einst ein Führer der deutschen Volksbühnenbewegung unter dem Wutgeheul eines stumpfhirnigen Spießertums als das schönste Vermächtnis deutscher Volksbühnenarbeit bezeichnete: "ein Stück Sozialismus in die Gegenwart zu stellen".
(aus der letzten Nummer "Die Volksbühne", Berlin 1933.)

Heute vormittag fand auf dem Horst-Wessel-Platz die feierliche Enthüllung des Denkmales der im Beruf gefallenen und verwundeten Polizei-Offiziere und Wachtmeister statt. Drei Jahre ist es her, daß an dieser Stelle die Polizeihauptleute Anlauf und Lenk, von den Kugeln entmenschten, politischen Verbrechertums niedergemäht, den Soldatentod starben. Heute trägt der Platz ein neues Gesicht. Lang streckt sich die Front der Neubauten rings um den Platz der eine Gedenkstätte Berlins werden wird, und gegenüber der Polizeiwache, deren Vorsteher damals der erschossene Polizeihauptmann Anlauf war, ragt das neue Denkmal empor. Schon rein äußerlich ein herrliches Symbol der Einheit auf diesem Platz, der einst die furchtbarsten Schrecken einer trostlosen Zerrissenheit erlebte. Zu vielen Tausenden drängten sich die Menschen in den anliegenden Straßen, auf den Dächern der Häuser, an den Fenstern. Zahlreiche Ehrengäste wohnten der Denkmalsenthüllung bei. Ein Fanfarensignal leitete die Feier ein. Nachdem dann die wuchtigen Rhythmen des alten Kampfliedes „Volk, ans Gewehr!“ verklungen waren, nahm Polizeioberst Dillenburger, der Kommandeur der Berliner Schutzpolizei, das Wort. Anschließend sprach Oberpräsident Gauleiter Rube. Der Oberpräsident sprach von der tragischen Rolle der Polizei in den Systemzeit, der der stützende Wille der Staatsleitung fehlte. Niemand dankte es ihr, wenn sie gegen die Volksverderber aufstand und vorging. Auch damals waren die Angehörigen der Schutzpolizei aus rassisch bestem Erbgut zusammengesetzt, aber die Vorgesetzten besaßen zwar auch rassisches Erbgut, aber nicht deutsches, so daß sie naturnotwendig gegen die deutsche Freiheitsbewegung eingestellt waren. Wenn das Denkmal gerade an diesem Platz stehe, so soll es klarmachen, daß es nicht möglich war und ist, sich mit dem Kommunismus auf weltanschaulicher Basis auseinanderzusetzen! Die Fahnen senkten sich, die Arme streckten sich zum stummen Gruß. Das Lied vom guten Kameraden klang aus. Die Formationen präsentierten, das weiße Tuch fiel und in der Sonne stand das von den Bildhauern Hans Dammann und Heinrich Rochlitz geschaffene Werk, das einen aufrecht dem Tode ins Antlitz schauenden und einen sterbenden Polizeioffizier zeigt. Bezirgsbürgermeister Lach nahm das Ehrenmal zu treuen Händen in die Obhut der Stadt. Reichsinnenminister Dr. Frick sprach das letzte Lebewohl und schloss mit einem Siegheil auf Volk, Führer und Vaterland. Dann marschierten die Formationen an dem Denkmal vorbei. Diese schöne Stunde feierlichen Gedenkens war vorüber.
Durch Satzunggemäßen Beschluß des Vorstandes der Volksbühne e. V. Berlin vom 1. März 1939 ist der eingetragene Verein Volksbühne Berlin aufgelöst worden. Die Auflösung wurde am 23. März 1939 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Berlin N65, Gerichtstr. 27, eingetragen. Rechtsnachfolgerin der Volksbühne e. V. Berlin ist das Deutsche Reich, vertreten durch den Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, in dessen Auftrage die Theater der Volksbühne (Theater am Horst-Wessel-Platz und Theater in der Saarlandstraße) weiterbetrieben werden.
(Amtlicher Anschlag, Berlin 1939.)
Jenes Volkstheater, von dem wir träumten, das Theater der Freude, der Erholung und Entspannung, der Lebensbejahung für den schaffenden Deutschen, hat sich erfüllt. Das Theater der Snobs, der Literaten, der Cliquen, der politischen Hetze ist für immer untergegangen. Wir, die wir diesem Theater der Volksgemeinschaft dienen dürfen, empfingen alles vom Führer, das Vertrauen, den Mut zum Beginn und nicht zuletzt das Wertvollste – das Volk, die Gemeinschaft der Deutschen. Schauspieler sein ist heute wieder Berufung und Glaube, und Theaterleiter sein eine Verpflichtung, die sich der politischen Volksführung nahe und von ihr verstanden fühlt. Der schönste Dank aber, den wir Theaterschaffenden erleben dürfen, ist jene Stunde, in der der Führer überraschend, sich aus Staatsgeschäften losreißend, das Theater betritt, den Worten der Dichter lauschend, der unsterblichen Musik deutscher Meister hingegeben wie die Tausende seiner Volksgenossen, die ihm an solchen Abenden in unendlichem Jubel Dank sagen für das, was er ihnen auch geschenkt hat: Das neue Deutsche Theater und eine neue wahrhaftige deutsche Schauspielkunst.
Eugen Klöpfer, Mai/Juni 1939
Einbruch der Realität! Am 23. November 1943 fallen erst Brandbomben durch das Volksbühnendach und anschließend 20 Paar Arme dem Feuer zum Opfer. Obwohl dazu noch 17 Paar Beine und 66 Paar Schenkel kommen, fließt kein arterielles, nur metaphorisches Herzblut der Theaterleute - es handelt sich um Requisiten.
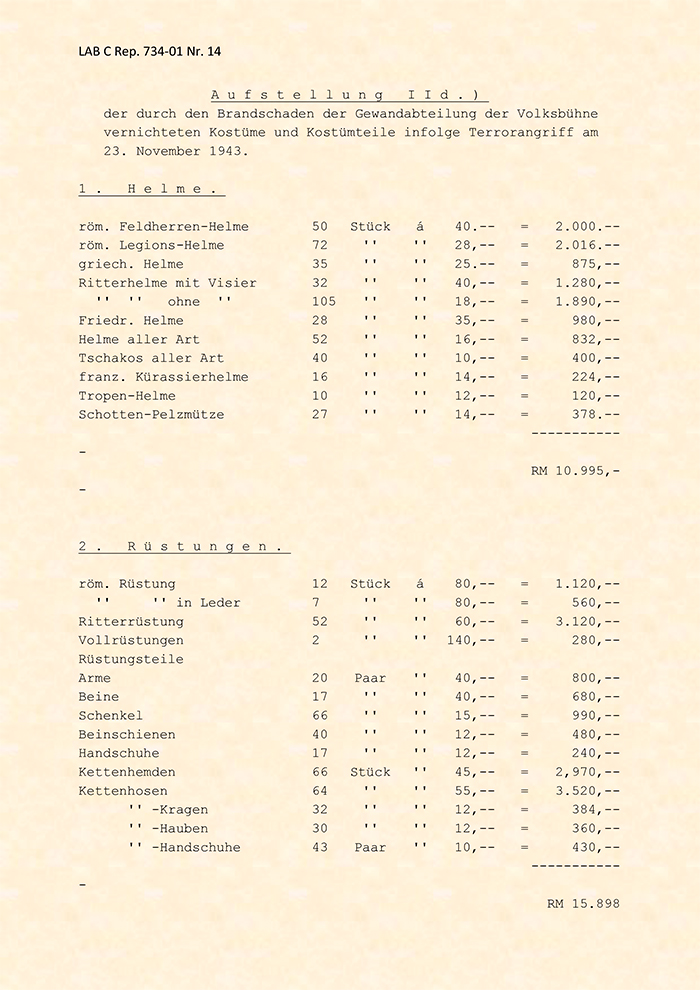
Am Anfang war das Wort. Ein Zettel Russisch/Deutsch macht 1947 aus der Ruine am Luxemburg-Platz eine zukunftsträchtige Baustelle. Die Volksbühne wird auf Befehl der sowjetischen Militär-Administration wieder aufgebaut. Bevor die Hände der Trümmerfrauen in die Schutthaufen greifen, sind es (wir nehmen es an) zarte Sekretärinnen-Finger, die über eine Schreibmaschine fliegen und in knappen Worten große Steine bewegen: „Hiermit befehle ich…“
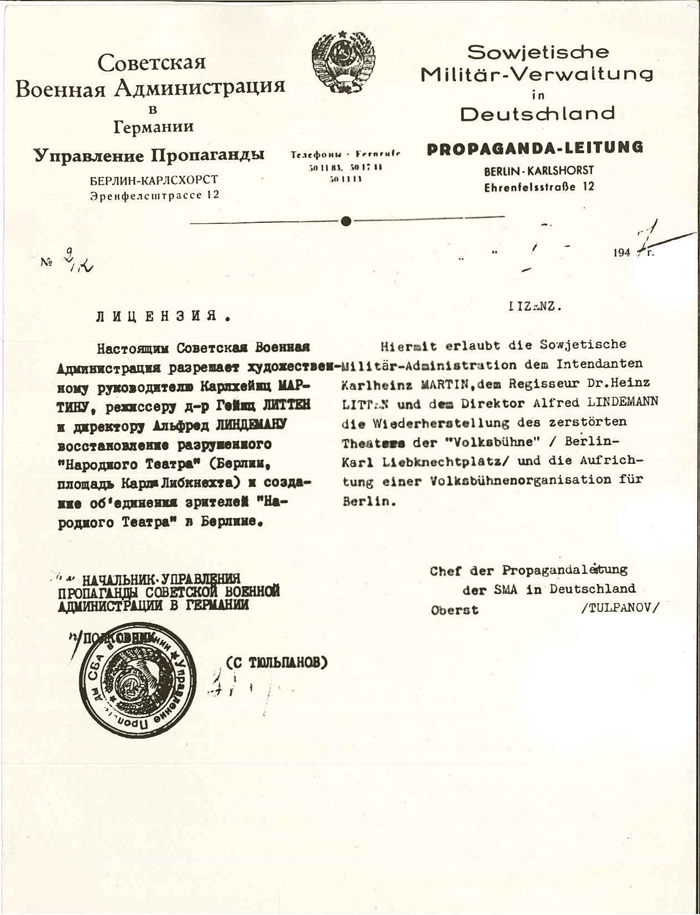
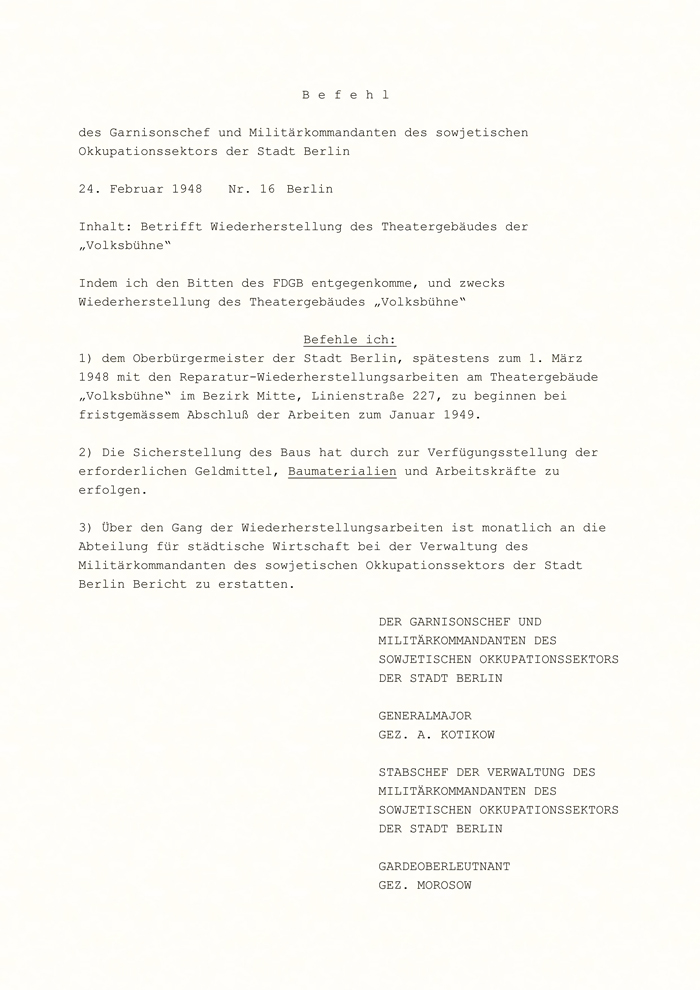
Folgender Vorgang: Es tropft von der Decke, ein Heizungsrohr leckt. Haustechniker schneiden ein Loch durch den Stuck und klettern in den Zwischenboden. Dort finden die Männer nicht nur eine kaputte Leitung, sondern auch eine Flaschenpost, die vom tröpfelnden Wasser angespült wird. Durchsichtige Flasche, eingerollter Zettel, verschlossen mit einem Korken. Wie es sich gehört. Nach dem Öffnen grüßt die Vergangenheit: Es waren schon mal Männer da, Stuckateure, 1953. In sechs Tagen ist Weihnachten und da – haben sie sich wohl gedacht – kann man der Nachwelt mal einen kleinen Gruß mit Arbeitsmotivation hinterlassen. Die Nachwelt bedankt sich, wir sind immer noch da!
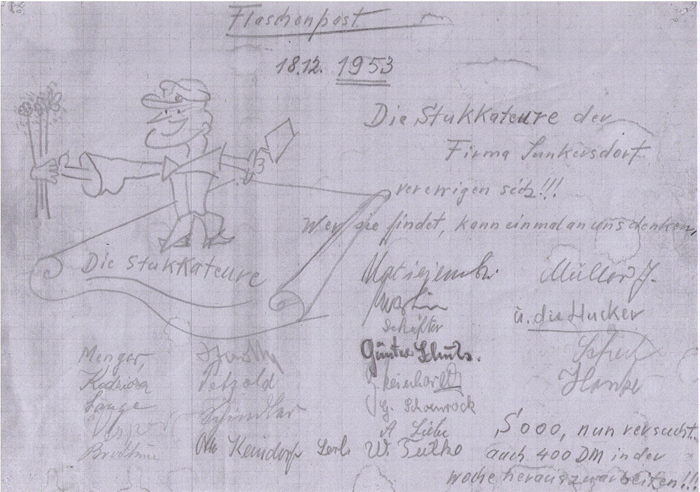
(...) Es ist ein Merkmal des wahren Volkstheaters, daß das Gefühl der Distanz zwischen Zuschauerraum und Bühne nahezu aufgehoben wird. Darum ging es im Theater am Schiffbauerdamm, darum wird es in der Volksbühne gehen. Nur was in der Kunst dem Leben der Völker abgelauscht ist, den großen Leiden des kleinen Mannes, den armseligen Freuden der Reichen, den gewaltigen Taten der neuen Menschen, ist wahrhaft groß und überdauert. Wir erstreben einen Spielplan, der progressiv, volkstümlich, künstlerisch ist - ein Ensemble, das jung, begabt, bewußt ist - und erhoffen ein Publikum, das, von uns gewonnen, davon Gewinn trage.
Von Fritz Wisten, Berlin 1954
Vor mehr als 60 Jahren schufen die Berliner Arbeiter zusammen mit fortschrittlichen Schriftstellern und Theaterleuten die "Volksbühne". Die Bedeutung dieses Ereignisses lag nicht allein darin, daß für die werktätigen Menschen die Tore des Theaters geöffnet wurden. Die Volksbühne veränderte vielmehr das Gesicht des bürgerlichen Theaters. Der gesellschaftliche Kampf der Arbeiterklasse entwickelte auch jene neuen Kräfte und Impulse, deren das Theater bedurfte, um dem Neuen und dem Fortschritt zu dienen. Die Arbeiterklasse kämpfte um ihren Anteil am kulturellen Leben der Nation. In diesem Kampf konnten vor 40 Jahren die Berliner Arbeiter ihr eigenes Theater, die "Volksbühne", eröffnen.
Die "Volksbühne" hatte seitdem bedeutenden Anteil am künstlerischen Leben Berlins. Hervorragende Autoren und Künstler fanden nun ihren Platz am Theater. In der "Volksbühne" wurde der Kampf um das revolutionäre Theater der Arbeiterklasse ausgetragen, bis auch auf diesem Gebiete die Kulturfeindlichkeit der Faschisten die kulturpolitische Sendung der Volksbühne ebenso brutal zertrümmerte wie später amerikanische Bomben sinnlos das Gebäude zerstörten.
Inzwischen haben aber die Werktätigen von den Theatern in der Deutschen Demokratischen Republik Besitz ergriffen. Alle unsere Theater sind Theater der Werktätigen und Theater des Volkes. (...) In der künstlerischen Arbeit wird auch unseren Theatern bewußt, daß sie ihre schöpferischen Kräfte nur in engster Verbindung zum Leben des Volkes gewinnen und ständig erneuern können. (...)
Der Eröffnung der wiedererstandenen Volksbühne kommt darum auch eine besondere Bedeutung zu, denn in ihrer Arbeit verbindet sich die Tradition des deutschen Theaters mit dem Kampf der Werktätigen um die deutsche Kultur, um Einheit und Frieden.
Die Volksbühne muß darum in ihrer künstlerischen Arbeit Beispiel und Vorbild sein. Sie soll zeigen, wie das Theater mit seinen Mitteln dazu beiträgt, die Gesellschaft zu verändern (...). Sie soll zeigen, wie aus Vergangenheit und Gegenwart, dem unermüdlichen Kampf der Menschen um ihre Befreiung von Unterdrückung und Ausbeutung neue Kraft erwächst und der Weg in die Zukunft erhellt wird. Sie soll zeigen, welche Kraft den deutschen Menschen in ihrem Kampf um die Einheit Deutschlands aus der Pflege ihrer Muttersprache erwächst. Sie soll zeigen, daß die Pflege der Kultur anderer Völker, vor allem auch aus der uns freundschaftlich verbundenen Sowjetunion, der Verständigung und dem Frieden der Völker dient. (...)
Otto Grotewohl, Berlin, 1954
Wir haben untersucht, wie das Theater die Mittel des Films für eigene Zwecke (für eigene Produktivität) fruchtbar einsetzen kann.
Dazu braucht das Theater unserer Meinung nach eigene Filmmittel (Apparaturen und Mitarbeiter).
Wir bezeichnen als „theatereigen Filmeinheit“ eine für Theaterzwecke spezialisierte Arbeitsgruppe innerhalb des Theaters.
Die Verwirklichung eines solchen Modells soll das Theater in die Lage versetzen, das schwierige Problem der Darstellung von gesellschaftlichen Zielen und Verhaltensweisen (im Lichte der wissenschaftlich-technischen Revolution) mit neuen Arbeitsmethoden zu lösen unter Verwendung von Mitteln unserer Zeit – nämlich des Films, mit welchen man Tatsachen, Geschehen, Zusammenhänge und Verhaltensweisen in einer der Wirklichkeit entsprechenden Komplexität erfassen und objektivieren kann.
Wir vermuten, daß dieser Weg auch neue Möglichkeiten aufzeigen wird zur Überbrückung von Widersprüchlichkeiten und Gegensätzlichkeiten, die zwischen Fernsehen, Film und Theater bestehen, im Kapitalismus zwangsläufig, im Sozialismus aber andere Ursachen haben und nicht antagonistisch sind.
Die Produzenten von künstlerischen Erzeugnissen haben tatsächlich Mühe, mit dem dynamischen Voranschreiten der sozialistischen Industrialisierung, die täglich neue Methoden der Kollektivarbeit hervorbringen, Schritt zu halten.
Es ist ein Anachronismus, wenn das Theater vor neue gesellschaftliche Aufgaben gestellt, weiterhin Film und Fernsehen als Konkurrenten betrachtet, technische Mittel seines Zeitalters ignoriert und nicht benutzt.
So verschärfen sich die Widersprüche, der sozialistische Wettbewerb kommt nicht zustande, Kräfte werden verschwendet und man stagniert.
Erscheint der Schauspieler auf der Bühne als Darsteller einer gesellschaftsbewußten und selbstbewußten kritischen Haltung, so hat er dem Publikum gegenüber eigentlich keine andere Funktion als der Kommentator der Fernsehsendung „Der schwarze Kanal“.
Für den Schauspieler ist es aber schwierig, eine solche Haltung einzunehmen und auf der Bühne darzustellen. Er spielt Rollen. Er schreibt seinen Text nicht selber. Verlangt man von ihm, daß er Menschentypen von heute darstellt, kennt er sie schlecht, weil sie im Entstehen sind. Dies ist nicht nur eine Talent- oder Charakterfrage. Kann er den Klassenfeind sehr gut darstellen, so weiß er noch nicht, wie ein sozialistischer Werkdirektor handelt und spricht. Er kann den vom Schriftsteller gelieferten Text nicht für bare Münze hinnehmen. Er muß den Unterschied zwischen Wirklichkeit und künstlerischer Stilisierung selber feststellen. Er muß unsicher sein, Zweifel und Bedenken haben. Er muß sowohl sich selber wie seine Figuren objektivieren. Er braucht dazu besondere Methoden der Kollektivarbeit und besondere Einrichtungen, um seine gesellschaftliche Aufgabe erfüllen zu könne.
Im Gegensatz zur Theateraufführung ist der Film speicherbar und leicht transportierbar. Die darstellerischen Leistungen können aufbewahrt werden. Sie bleiben verwendbar so oft wie man will und überall dort, wo es einen Sinn hat, und der Kostenaufwand dafür ist nicht groß.
Das Theater aber hat unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum.
Mittels der Elektronik hat das Fernsehen ungeheure neue Möflichkeiten geschaffen, so daß aktuelle Themen, Informationen und Zusammenhänge sowie die Darstellung von Verhaltensweisen Millionen von Schauspielern gleichzeitig und auf raschestem Wege überall hin und direkt ins Haus vermittelt werden.
Hier ist aber der Zuschauer soweit weg vom Herstellungsprozeß, daß er nur als Masse wahrgenommen wird und diesem Herstellungsprozeß kaum mehr anders als über dem komplizierten Weg von soziologischen Ermittlungen und Studien beeinflussen, d.h. fördern kann.
Das Fernsehen braucht den Film und der Film braucht den Schauspieler. Nur im Theater wird der Schauspieler direkt mit dem Zuschauer konfrontiert. Dort findet die Auseinandersetzung statt. Dort wird seine Persönlichkeit gebildet.
Wenn wir einsehen, daß die Typisierung neuer Verhaltensweisen, die sich aus der Entwicklung der Gesellschaft ergeben, die Darstellung derselben und ihre Prüfung auf gesellschaftliche Brauchbarkeit nur in unmittelbarer Zusammenarbeit mit kritisch zuschauenden Vertretern dieser Gesellschaft stattfinden kann, wird die besondere Bedeutung der Theaterarbeit deutlich, und in dieser Perspektive lohnt es sich, nach Mitteln zur Verbesserung dieser Arbeit zu suchen.
In folgendem wollen wir darlegen, aus welchen Bestandteilen sich eine funktionsfähige Filmeinheit zusammenstellt und erläutern, wozu sie für Theaterzwecke gebraucht werden.
1. Der Leiter
der Filmeinheit ist Fachberater für alle Filmfragen am Theater und vertritt auch das Theater in Filmfragen gegenüber anderen. Er ist verantwortlich gegenüber der Intendanz und einem Mitarbeiter der Künstlerischen Leitung. Er leitet die Filmarbeit am Theater.
2. Filmapparaturen und Einrichtungen
Die Filmeinheit verfügt über
a) Bild- und Tonaufnahmegeräte 16mm
b) einen Montageraum mit Schneidetisch für Bild und Ton, 16mm
c) einen Vorführraum mit Doppelbandprojektor für Bild und Ton, 16mm
d) ein Filmarchiv, das für Theaterzwecke aufgebaut wird.
3. Die für die Filmarbeiten benötigten Mitarbeiter
Kameramann
Tonmann
Cutterin
Vorführer
Archivar
Assistenten und Gehilfen
Sie rekrutieren sich nach Möglichkeit aus dem Theater selber, aus der Filmschule Babelsberg vielleicht oder sonst, wo junge Leute mit genügend Interesse und technischer Vorbildung erhältlich sind.
Sie werden vom Leiter der Filmabteilung für die besondere Arbeit am Theater ausgebildet.
Dies genügt, damit das Theater selbstständige Filmarbeiten für seine Zwecke ausführen kann.
Die Menge des benötigten Rohmaterials ergibt sich aus der Planung und Arbeit und den der Filmeinheit gestellten Aufgaben.
Die Entwicklung des belichteten Materials, die Herstellung von Arbeitskopien und die Überspielung der Tonaufnahmen auf Perfoband sind die einzigen Arbeiten, die ausserhalb des Theaters im Filmlabor ausgeführt werden.
Da die Theater-Filmeinheit nicht zur Aufgabe hat, publikumsfertige Filme herzustellen, fallen verschiede komplizierte Arbeitsvorgänge, die in der Filmproduktion sonst vorkommen, in unserem Falle aus. Farbaufnahmen werden nur ganz selten sinnvoll sein.
Sollte in einem bestimmten Fall die Auswertung des Filmmaterials auch nach außen in Aussicht genommen werden, bedingt dies konzeptmäßig sowie technisch Absprachen und Zusammenarbeit mit DEFA oder Fernsehen.
Zur Hauptfrage
Wie Filmaufnahmen zur Rationalisierung und Verbesserung der Theaterarbeit gebraucht werden können, müssen wir uns hier auf einige Punkte beschränken, weil die Praxis selbstverständlich noch weitere Möglichkeiten aufzeigen wird.
1. Hilfsmittel zur rationellen Ausarbeitung des Spielplans
Zwecks frühzeitiger Erfassung der Ziele, Planung auf weite Sicht (Perspektivplanung) Herstellung von Entwürfen als anschauliche Basis für Diskussionen zur Abklärung der Konzepte sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit anderen. Prospektive Bearbeitung von Themen zur Überprüfung ihrer Eignung für Theaterstücke (bildhafte Darstellung der Konzepte).
2. Hilfsmittel zur Erfassung der Problematik eines bestimmten Theaterstückes
und deren Vermittlung an die Schauspieler.
Herstellung von Dokumentationen zur Analyse der Problematik des Stückes mittels Bild- und Tonaufnahmen aus der Wirklichkeit, oder auch anhand von Versuchsmodellen, und auch unter Verwendung von sonst wo erhältlichen schon bestehendem Filmmaterial (zu diesem letzten Punkt: Fernsehen informiert laufend über tausend Dinge. Die Theaterleute sind nicht klar darüber, was der Zuschauer schon weiß.)
Der Film liefert eine objektivierbare Anschauung und fördert die Bildung eines kollektiven Standpunktes.
3. Hilfsmittel für den Schauspieler zum Aufbau seiner Rolle. Filmaufnahmen erlauben dem Schauspieler, die von ihm entworfene Figur als Zuschauer kritisch zu betrachten. Daraus ergibt sich eine bessere Verständigung mit Kollegen und Regie. Der Schauspieler wird aktiviert.
4. Hilfsmittel zur Selbstkontrolle der Regiearbeit
Wir meinen hier Kontrolle im kybernetischen Sinn. In jeder Phase der Entwicklung des Stückes kann mittels Filmaufnahmen geprüft werden (aus verschieden Gesichtspunkten), ob die Konzepte sich verwirklichen.
Auch neue entdeckte Faktoren, durch die Praxis entstandene schöpferische Leistungen können analysiert und geprüft werden.
Ganz allgemein soll durch die Verwendung von Film erreicht werden, daß sachlicher und weniger geredet wird.
Es ist auch ein Vorteil, wenn Filmaufnahmen es erlauben, jederzeit auf frühere Stadien der Arbeit zurückzugreifen.
5. Der Aufbau eines eigenen Filmarchivs bereichert das Theater und ergibt sich selbstverständlich sobald das Theater mit Filmmitteln arbeitet.
Das Filmarchiv wird gebraucht, damit das Theater seine Arbeit laufend historisieren kann.
Das Bewußtsein der vergangenen Leistung präzisiert die Gestaltung der Zukunft (es ist ein Jammer, daß solche Filmarbeit am BE nicht gemacht wurde zurzeit, da Brecht noch inszenierte und daß solche Leistungen, die zum Kulturbestand der DDR gehören, nur durch schriftliches und Fotomaterial belegt sind).
Das Filmarchiv wird für alle Mitarbeiter des Theaters nützlich sein, weiter auch für Außenstehende und zur Bildung der Jungend.
Wir stellen uns vor, daß die Wirkung des neuen Modells allseitig sein wird. Wir wollen dabei nicht außer Acht lassen, daß Theaterleute dadurch, daß sie die Filmmittel für eigene Zwecke gebrauchen, sich mit diesen Mitteln befreunden. Sie werden damit vertraut und sind ihm nicht mehr ausgeliefert, woraus sich die Grundlage für eine aktiviere und bewußtere Zusammenarbeit mit Film und Fernsehleuten entwickeln kann.
Abschrift
(von Dieter Klein diktiert)
Berlin, den 7.11.1969
Reni Mertens
Walter Marti
[Erste Seite des Protokolls fehlt]
Auf die Frage, ob es auch ein Unverständnis Franz gegenüber gäbe, wieder Schweigen.
Galfert schießt!
JUNGE: Das Stück solle ruhig aufgeführt werden, denn das Publikum solle Lehren ziehen. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, was das Publikum lernen soll. Soll es also die Bösen, Frechen umbringen? Das Gegenteil wäre zu tun, also nicht mit Gewalt.“
KARGE: „Wie ist Handlungsweise der Räuber zu verstehen? Gibt es sie noch im heute, im übertragenen Sinne?“
Antwort: „Heute - Flugzeug entführen. Ich muß sie zu verstehen suchen.“
LANGHOFF: „Ist es nur Abenteuerlust, in die Wälder zu gehen?“
JUNGE: „Die sind mit der Gesellschaft nicht einverstanden und wollen sie verändern.“
KARGE: „Was sind das für Leute?“
ANDERER JUNGE: „Menschen, die sich über ihr Leben Gedanken machen, ähneln heute jenen, die Rauschgift nehmen, die kapseln sich ab, sind ratlos den Verhältnissen gegenüber, passiv.“
BLÜMEL: - Räuber sind unterschiedliche Leute, Karl ist rühmliche Ausnahme, Spiegelberg ist vorher Dieb. Karls Motiv ist zu persönlich: Unverständnis des Vaters. Ist nicht die Gesellschaft zu verändern? Karl äußert im Gespräch mit Spiegelberg gesellschatfskritische Gedanken. Gleichzeitig sagt er aber, daß Vater zum Verzeihen bereit sei. Damit könnte er ein feudales Leben führen!
KARGE: (korrigiert - Spiegelberg ist plebeijische Type)
Wieder Schweigen.-
KARGE: „Wie ist das Verhältnis des alten Moor zu seinen Söhnen?“
Schweigen. - Zweiter Schuß von Galfert. - Gesprächsangebote werden nicht angenommen.
BLÜMEL doziert: „Ich verstehe nicht, daß ihr auf die Frage nach dem alten Moor keine Antwort bereithaltet. Ihr habt Euch doch alle vorbereitet. Da muß ich Euch also einzeln auffordern.“
MÄDCHEN: - Der alte Moor bevorzugt Karl als älteren Sohn. Und daraus muß man die Handlungsweise von Franz verstehen, daß er anfängt, zu intrigieren. Das ist nicht der richtige Weg, um sich beim Vater beliebt zu machen.
JUNGE: - Der alte Moor wollte Karl zum Herrscher heranziehen. Das war damals so.
ANDERER JUNGE: - In dem Augenblick, wo Karl den Vater befreit, bangt dieser auch um Franz. Er stirbt, als er sieht, daß Karl Räuber ist.
BLÜMEL: - Das ist ein Trugschluß vom Vater, wenn er meint, daß Gott ihn mit seinem weiten Sohn streft, weil er den ersten so schlecht behandelt.
LANGHOIFF: - Denkt der Alte überhaupt mal nach?
BLÜMEL: - Er nimmt nur zur Kenntnis, ist entsetzt, gibt sich aber keine Mühe, seine beiden Söhne zu verstehen.
EIN JUNGE: - Der Alte lässt sich am Anfang von Franz leiten.
LANGHOFF: Ist ihnen ein solches Problem fremd?
JUNGE: - heute sind Brüder gleichberechtigt.
(Blümel fordert wieder zu Beiträgen auf)
KATRIN: Bei uns zu Hause wurde früher mancher vorgezogen, heute ist‘s anders. Zusammenhalt untereinander. Unsere Elternerziehen uns zu anständigen Bürgern. Es muß so sein, daß Eltern mehr zu sagen haben, haben eben Autorität.
BLÜMEL: - Was ist, wenn Eltern im Unrecht sind?
KATRIN: - gute Eltern versuchen, zu überzeugen.
Ein anderes Mädchen hat zu ihrer Mutter ein Freundinnenverhältnis. Meinung wird nie aufgezwungen.
KARGE: - Verhältnis zum Lehrer?
BLÜMEL: - Das kommt auf den Lehrer an. Es ist unsere erste Aufgabe, von ihm etwas zu lernen. Wissen schafft auch hier Autorität.
EIN JUNGE: - Klasse findet: „Freude schöner Götterfunken“ als Beat gut. Darüber Auseinandersetzung mit dem Musiklehrer.
BLÜMEL: - Er hat keine Argumente. Nur - das ist eine Sauerei.
EIN JUNGE: - Die Frage wird eben nicht ausdiskutiert.
ANDERER JUNGE: - Lehrer müßte sagen, warum er es schlecht findet.
Ein Junge findet, daß solche Umwege erreichen, daß viele Jugendliche diese Musik kennenlernen.
BLÜMEL: - Franz drängt Vater eine Meinung auf. Das ist uns fremd. Franz muß mit der Wankelmütigkeit bei aller berechnung rechnen.
KARGE: - Wie stehen Sie zu Franzens Unternehmungen?
EIN JUNGE: - Er sollte zeigen, daß er was kann, irgendeinen Beruf erlernen.
MÄDCHEN: - Er ist kein Dummkopf, versucht auf geschicktem Weg Karl auszuhalten.
GALFERT: - Hat Karl logische Einfälle?
BLÜMEL: - Er muß logisch ziemlich gewandt gewesen sein, daß Bande Soldaten besiegt. Franz benutzt Logik nur zum Ränkeschmieden.
KARGE: - Denkt Karl ansonsten weiter?
BLÜMEL: - Darüber hinaus hat er nicht weiterüberlegt. Wenn nicht der Neue hinzugestoßen wäre, würde er gar nicht an Amalia denken.
KARGE: - Eigenschaften beider Figuren vereinigt?
MÄDCHEN: Das würde eine menschliche Bestie werden.
Nach langem Nasebohren kommt: Vergleich zur französischen Revolution
JUNGE: - Karl hätte ein Aufklärer werden können wie die französischen Aufklärer.
JUNGE: - Das wäre in Deutschland aber schwierig geworden, denn Deutschland war ziemlich zerteilt. Frankreich war ein Ganzes.
BLÜMEL: Karl-Franz hätten so eine Art Bauernführer werden sollen. Die Bauern dieser Zeit wären bereit gewesen, sich zu erheben.
KARGE: - Wie finden Sie Amalia?
MÄDCHEN: - sie ist standhaft, kämpft um ihre Liebe.
ANDERES MÄDCHEN: - Sie hätte den alten Moor zum Nichtverdammen Karls veranlassen sollen.
ANDERES MÄDCHEN: - Sie ist nicht konsequent, da sie den Fluch des Vaters bei der Nachricht verzeiht, als sie Karls Tod erfährt.
Die Jungen haben gar keine Meinung zu Amalia.
MÄDCHEN: Amalia denkt auch nicht weiter. Sie weiß keinen anderen Ausweg, als sie erfährt, daß Karl Räuber geworden ist. Jetzt ist sie völlig passiv, nachdem sie das Stück standhaft war.
ANDERES MÄDCHEN: - Aber was an Amalia find ich komisch: Als sie erfährt, daß Karl tot ist, will sie sich nicht umbringen, aber als sie erfährt, daß er unter die Räuber gegangen ist, da will sie sich umbringen. Da hätte sie sich lieber gleich töten können.
GYSI: Als Amalia weiß, was es heißt, allein zu leben, weiß sie, daß sie so nicht leben kann. Diese Erfahrung macht sie reif. Für sie gibt es keine andere Existenz als diesen Mann.
MÄDCHEN: - Ich würde mich nicht umbringen.
GYSI: - Erst am Schluss stürzen extreme, ungewöhnliche Ereignisse auf sie ein.
KARGE SCHLUSSKOMPLEX
JUNGE: - Wäre Karl am Leben geblieben, hätte er noch was schaffen können.
ANDERER JUNGE: - Ein Mensch kann keine Gesellschaft verändern.
KARGE: - Unsere Sache - Konzeptionsfindung.
MÄDCHEN: - Uns interessiert, was Schiller zeigen wollte.
BLÜMEL: Es ist anzunehmen, daß Schiller aus der Zeit heraus, in der er gelebt hat, keinen anderen Ausweg gewußt hat. In dieser Zeit war noch nichts von den Gesetzmäßigkeiten des Klassenkampfes bekannt. Auch Schiller konnte nicht viel weiterdenken.
JUNGE: - Schiller hat absichtlich keinen anderen Schluß gezeigt, weil er das Publikum dazu bringen wollte, selbst einen Ausweg zu suchen.
LANGHOFF: - Was können sie aus der Geschichte nehmen? (Beispiel mit Musiklehrer) Reicht Erklärung? - oder Parteinahme!
Was nicht verstanden wird.
BLÜMEL: Jeder kann sich als Parabel wiedererkennen.
Viele können sich jetzt auch eine Zuspitzung in der Schule vorstellen.
MANFRED: - Wir müssen und heute auch mit Problemen auseinandersetzen, werden vor Entscheidungen gestellt, müssen rausfinden, welcher Weg der richtige ist.
LANGHOFF: - Gibt es Faustschlagsituationen?
BLÜMEL: - Hat Schiller die Situationen extra zugespitzt? Derartige Gegensätze gibt es bei uns nicht, vielleicht nur in kleinerem Umfang.
GALFERT: - Sie leben zu Hause und in der Schule in Harmonie.
LEHRER: - Entschuldigt sich für nichtvorhandene Gesprächsbreite: „Man müßte noch bessere Vorbereitungen treffen.“
Wäre das für Spontaneität des Gesprächs wirklich gut?!
1. Wirkung der BPO / Arbeit der BPO
- Es herrscht unter Genossen Kontaktarmut
- In der BPO kein Vertrauen zueinander
- Die besten Künstler sind nicht Genossen (Vorbildfrage)
- In letzten 2 Jahren immer geringer werdende Aktivität der BPO. Keine polit.-ideolog. Arbeit, aber auch kaum echte
Verbindung zu Produktionsfragen - Nachtrab
- Mitgliederversammlungen sind kein Ort der echten Auseinandersetzung. Man ist so höflich - hinterher erst
richtige Gespräche in Grüppchen.
Man wird nicht gefordert, es fällt nicht auf, ob man mitmacht oder nicht.
- Wirkungsvolles Mitmachen setzt voraus, dass man künstlerisch was leisten darf.
- Viele alte VB-Angehörige sitzen auf der „Strafbank“. Atmosphäre der Unsicherheit im Hause.
2. Gruppen
- Gruppe Schauspiel war sehr aktiv, wenn es um Feuerwehreinsätze ging, vor allem in der Zeit der ehemaligen KL.
Kontraststellung machte produktiv, jetzt Leerlauf.
- Gruppen müssen Platz für Kontakte sein, auch ohne Tagesordnung Probleme aussprechen können.
- Genossen befähigen, in Prognose zu denken. Wir müssen ideologisch vordenken, um Nachtrab zu verhindern.
z.B.:
- Was heißt Theater der 70er Jahre?
- Wo ist Platz der Institution Theater überhaupt?
- Wie beziehen wir konkrete Tagesarbeit in Zusammenhänge mit inner- und außenpolitischer Lage?
- Wie werden wir produktiv?
3. Parteileitung
- Eindruck, dass sie viel sitzt - aber Isolation. Breite Wirkung fehlt. Persönlichkeitsfrage auch fachlich mit PL
durchgesetzt sein.
- Polit.-ideolog. Geschieht nichts
4. Parteiaktive / Parteiaufträge
- Im Allgemeinen begrüßt, „Avantgarde“-Aktiv war im Nachtrab.
- Aktive müssen Aufgaben kriegen. Viel früher umsetzen. (Gute Beispiele „Lerche“ / „V wie Vietnam“) Gemeinsam
MIT Regisseur arbeiten.
- Parteiaufträge müssen konkret und kontrollierbar sein. (Werden von vielen gewünscht)
5. Demokratie
- Der KÖR ist unwirksam, wird zwar gefragt, aber seine Meinung gilt nix, wie viele Ergebnisse zeigen. (Auch
Nachtrab, Höflichkeit)
- Perspektivplan - Theater
Der erste Plan wäre nie rausgegangen, wäre er mit allen besprochen worden.
Der zweite wurde auch erst hinterher diskutiert. Falscher Weg. Aber sehr wichtig die gefundene Losung „Das noch nicht Gedachte denken…“ - das kann produktiv machen, z.B. beim Finden des Platzes der Institution Theater in der Zukunft.
6. Leitungsfragen
- Ergaben sich nur im Bereich Technik. Werkstatt am Plan nicht beteiligt. Keine Feinplanung erfolgt. Werden als
Nähmaschinenfabrik betrachtet, nicht als künstlerische Hilfstruppen.
- Es wird nicht gesorgt für Vorgaben der Teams, daher keine schöpf. Mitarbeit möglich.
- Unterstellung Ausstattung unter Techn. Dir. kann nicht richtig sein.
- Werkstätten werden getrennt vom Haus behandelt. (an Kleinigkeiten: Keine Probenpläne, keine
Benachrichtigungen über Essen usw.)
- Polit. Haltung der Werkstätten: Die Karnickel sind wichtiger, denn solange die Großverdiener so viel Geld
auf die Straße schmeißen (z.B. „Avantgarde“), interessiert sich keiner für „große Fragen.“
- Unverständnis, weshalb können Genosse Intendant und Genossen der KL nicht zusammenarbeiten. Eindruck:
Jeder sucht beim andern Fehler, um einzuhaken.
7. Besondere Fragen
- Zuschauer: Wir sind dem Publikum zu weit voraus. Denken zu wenig an ihn. Deshalb kommt er nicht.
- Wir werden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser, richtiger --- trotzdem kommen weniger Leute: Platz des Theaters!
Finden
- Wenn nicht täglich jeder Genosse lernt, wird er sich selbst isolieren. Aktives Teilnehmen am Sozialismus eine
wichtige Frage für jeden, um Stillstand oder Wohlstandsdenken zu überwinden. (Gehört zur Gruppenarbeit)
- Man muss schaffen, seine Tagesfragen mit Weltgeschehen zu konfrontieren, sonst bleiben wir steril (z.B. „Räuber“
und das Weltgeschehen)
- In der DDR geht so vieles schief - wie kommen wir trotzdem weiter?
- Einige Genossen kannten ihren Gruppen-Organisator (Schauspiel) nicht.
8. Aufträge
- Gen. A. wurde beauftragt, mit den Genossen der Werkstatt einen Problemkatalog zu erarbeiten, der als
Arbeitsgrundlage dienen soll für den zu gründenden Parteiaktiv, das helfen soll Werkstatt - techn. Direktion -
Produktion in Gang zu bringen.
Auftrag muss terminiert und kontrollfähig gemacht werden.
- Gen. L. wurde gebeten, mit Gen. B. über Probleme zu sprechen, die in der Gruppe diskutiert werden könnten.
- Gen. T. wurde gebeten, zu notieren, worin die Behinderungen seiner Arbeit bestehen (durch Zwitterstellung
zwischen Intendanz und KL) (Gen. T. hat sein Dipl. Theaterwiss. - wieso nicht einbezogen)
- Gen. T. macht bis Dez. die Re-Organisierung der DSF im Hause
- Das Gespräch mit J. M. soll fortgesetzt werden, denn die BPO hat sich nach seine „Herauskatapultierung“ nicht
um ihn und seine Arbeit gekümmert. Frage seiner Perspektive. (Ein Punkt für die Gruppenarbeit: Bericht der
Genossen, die längere Zeit außerhalb arbeiten)
- Zu klären ist die Angelegenheit Fam. G. Das Vertrauensverhältnis ist nach wie vor ungelöst. (M.)
- Zur Kandidatenwerbung ist Kollege S. (Werkstatt) einzubeziehen (A.)
- Mit dem Abendpersonal sollte ein gesondertes Parteilehrjahr durchgeführt werden.
- W. sollten wir über Dr. W. zu einer Kur verhelfen
Brot und Spiele, ein uralter Zusammenhang, erfolgserprobt wie Zigarre-Sonnenbrille oder Regisseur-Stöckelschuh, und nirgends besser auf den Punkt gebracht, als in den Kaschemmen neben stampfender Unterbühnen-Maschinerie, den Theaterkantinen. Hier mischen sich Kostümträger mit blauem Dunst, Karrieren beginnen und Arbeitsalltage enden hier. "Kantinengänger, egal welcher Coleur, das sind alles Biertrinker" (Josi Meyer, Tresenkraft) und nehmen wir ein paar Gläser zu viel dieser Sorte, nehmen wir eine Uhrzeit nach Mitternacht, zwei berühmte Regisseure, einen unbekannten Gegenstand, mit dem Türen (Sesam, Sesam!) und Regeln gebrochen werden, und nehmen wir die verspätete Volkspolizei hinzu – dann sind wir in der Kantine der Volksbühne angekommen. Es ist das Jahr 1972!
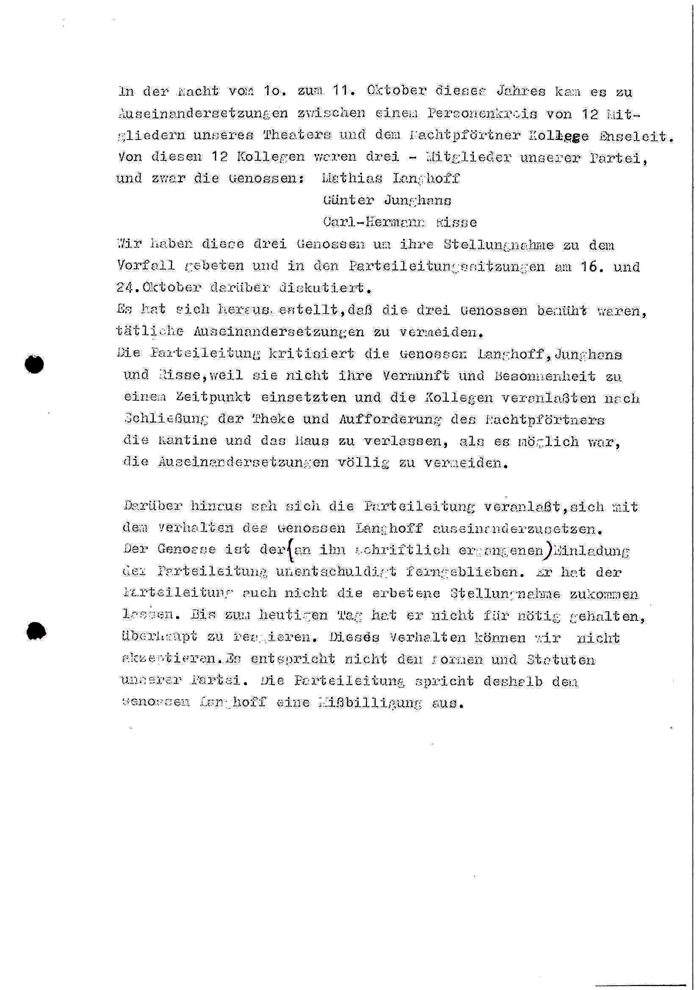
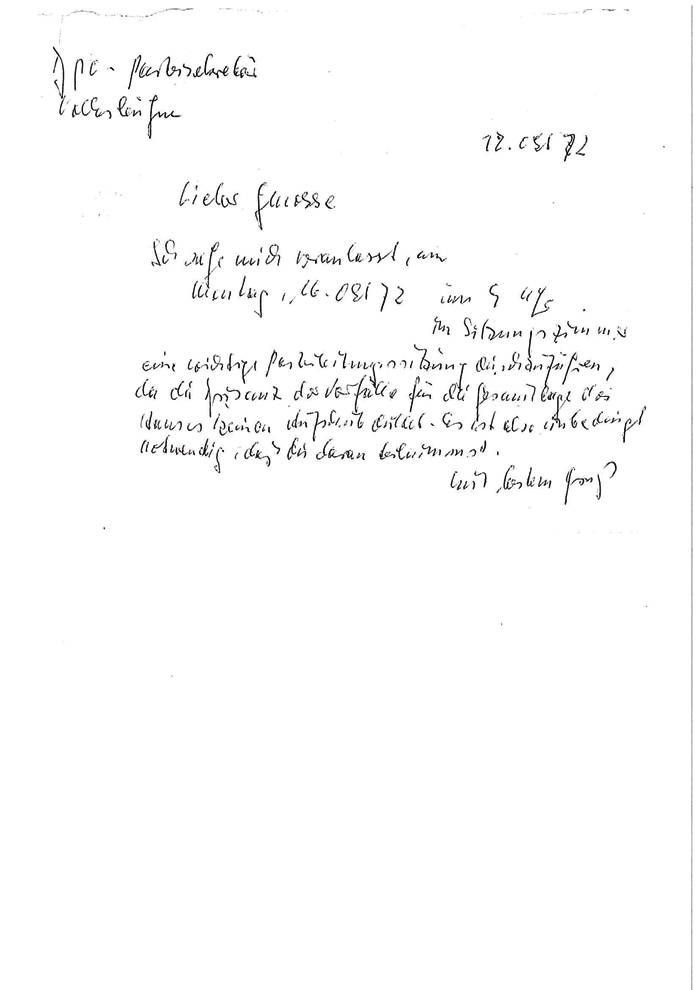
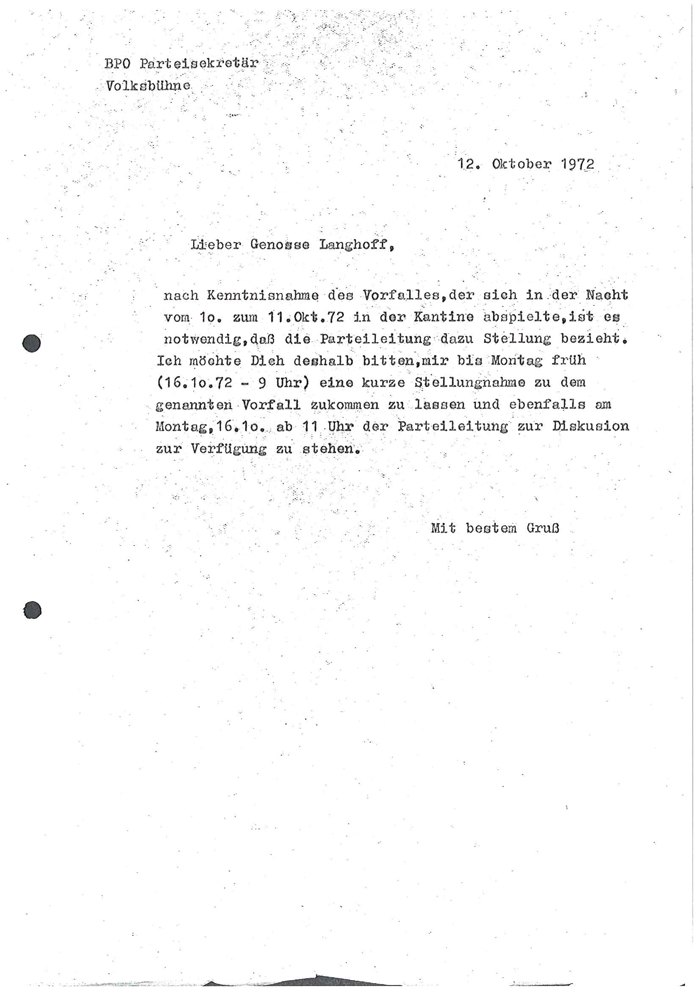
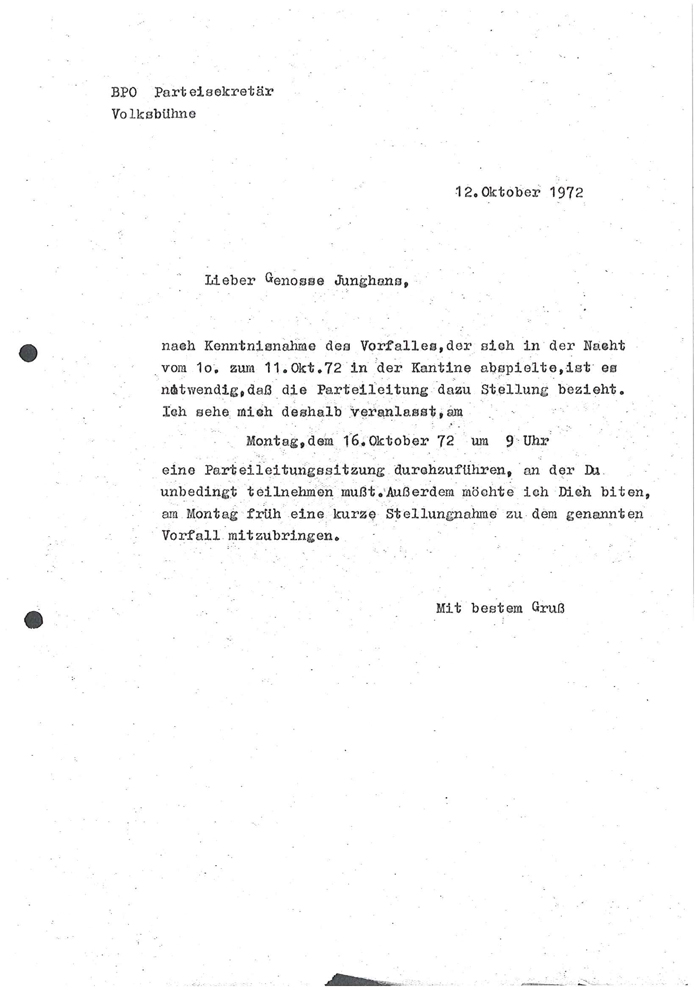

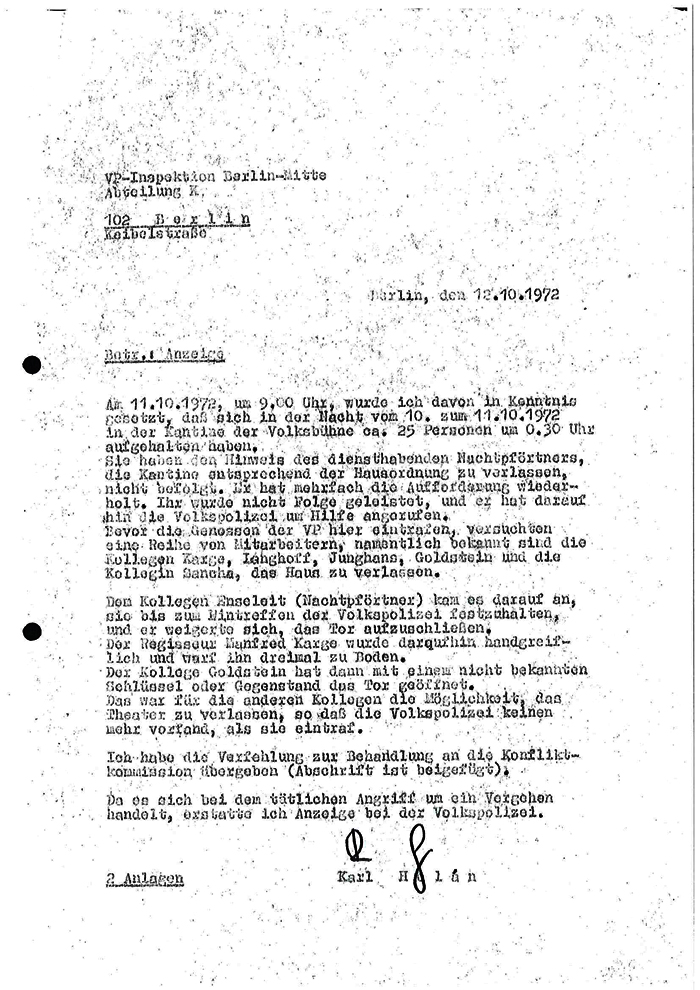
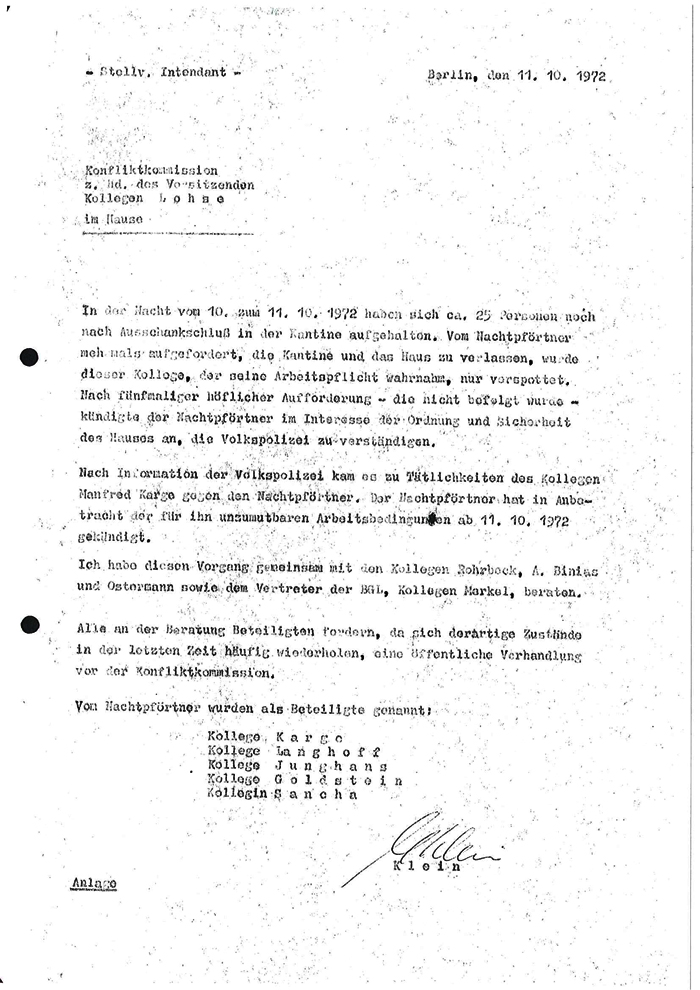
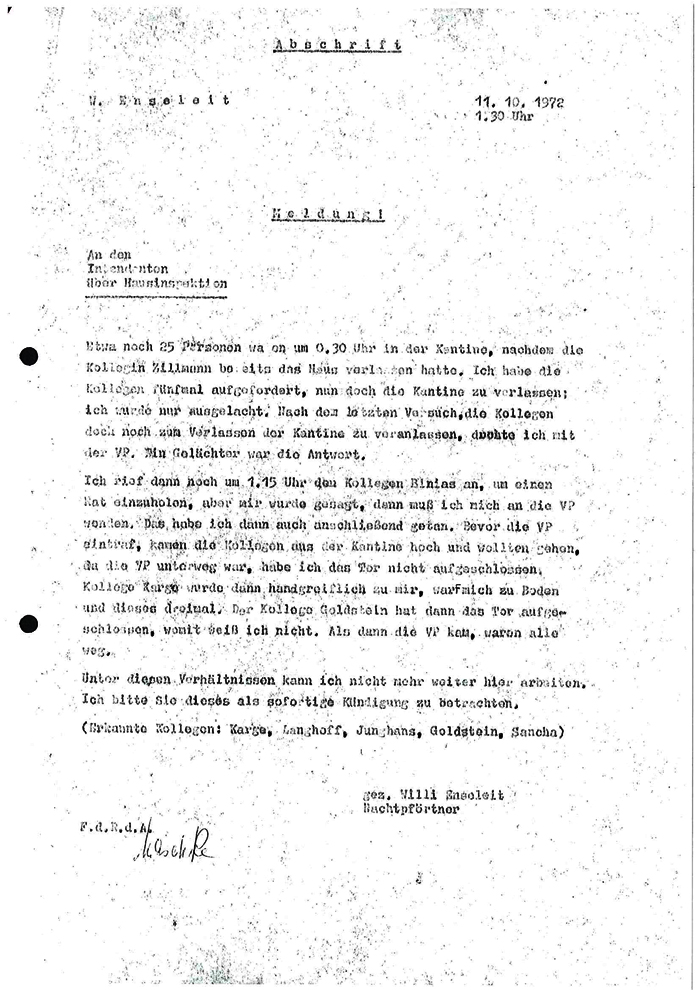
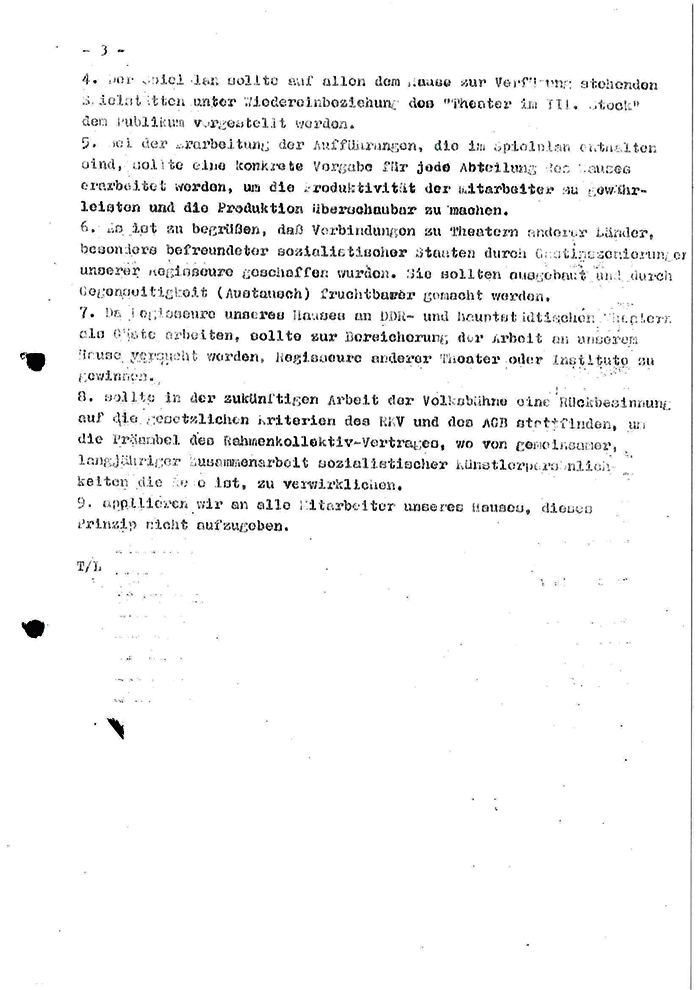
18.30 Uhr betritt er die Volksbühne. Da er sich nicht schminken muß, geht er zunächst in die Kantine.
18.50 zieht er sich in seiner Garderobe um für die Rolle des Doubles „junger Soldat“ im LAKEN und begibt sich an seinen Auftrittsort hinter der Bühne links.
19.30 ist sein Auftritt beendet. Gang vom Abgang im Foyer hinter die Bühne, liefert die Requisiten ab beim Schwarzen Brett (Strick). Dann liefert er die Gasmaske beim Garderobier ab. Danach zieht er sich um (muß sich nicht schminken) für die Rolle des Mory im SCHLÖTEL und holt aus der Requisite das Gewehr. B. hat 10 Minuten Zeit bis zum Auftritt (Schießplatzszene).
19.40 – 19.45 dauert die Szene. Abgang nach hinten durch die Unterbühne. Dort wartet B. auf seinen 2. Auftritt bis kurz vor
20.00 Uhr. Er wartet dort aus Sicherheitsgründen, um den Auftritt nicht zu verpassen; er erhält kein Zeichen, sondern ist für den Auftritt selbst verantwortlich. In dieser Viertelstunde hört er dem Dialog der Kollegen von der Unterbühne aus zu.
Ca. 20.00 – 20.05 2. Auftritt (Szene vor dem Institut).
Nach diesem Auftritt geht B. noch im Kostüm von SCHLÖTEL in die Kantine, um etwas zu essen und zu trinken. Meist hört er dann etwas in PROMETHEUS hinein und setzt sich in die Dekoration von STÜHLE, um sich zu unterhalten, z.B. mit dem Techniker Jörg Buchmann oder mit wem sich an diesem Ort sonst der Kontakt zufällig ergibt. B. bleibt immer in lockerer Verbindung mit den Aufführungen. Auch beim ersten Ensuite-Programm war er stets daran interessiert, immer noch am Abend in die anderen Sachen hineinzuhören und nach seinen Auftritten noch dazubleiben.
Lesen, Schachspielen oder Skat mag B. im allgemeinen während der Vorstellungen nicht, da es ihn zu sehr von der Konzentration auf den nächsten Auftritt wegführt. Er hat die Erfahrung gemacht, daß er in solchen Fällen sogar mal falschen Text sprach.
Ca. 21.30 Uhr zieht sich B. für die Rolle des „Blauen“ in STÜHLE um und schminkt sich (wenig, etwas Puder).
22.00 Beginn des Nachtprogramms.
22.30 Ende. Heute machten beide Darsteller Extraimprovisationen, weil sie sich zufällig ergeben haben.
B. meint, dass es das Stück mit seiner absurden Technik in dem Rahmen dieses Spektakel-Nachtprogramms schwer hat. Die Störung durch BAUCH macht dann nichts aus, wenn man die Hälfte der Leute fesseln kann. Es wird kompliziert, wenn Dreiviertel der Leute am liebsten rübergehen würden, weil sie aufgrund von Musik, Lachen und Beifall denken, sie verpassen jetzt etwas, wenn sie STÜHLEN zuhören.
Die Improvisationen haben allerdings nicht mit den Störungen zu tun, sondern damit, daß man aus einem bestimmten Moment plötzlich etwas machen kann, d.h. nicht nur die Absicht zum Machen hat, sondern auch den plötzlichen Einfall.
Ca. 22.30 Uhr zieht sich B. wieder um und hält sich meistens noch etwas im Theater auf.
------------------
Während der 13 Ensuite-Tage hatte B. zwei Filmtermine, sonst keine Proben.
von Birgit Meißel
Sprecher: SPEKTAKEL 2 - ZEITSTÜCKE wird von vielen im Haus und außerhalb des Hauses als Höhepunkt angesehen.
Benno Besson: Natürlich spricht man immer wieder von SPEKTAKEL, weil es eine Art Kristallisationspunkt war. Da hat sich vieles, was wir in den früheren Jahren angestrebt hatten, realisiert. (...) Daß SPEKTAKEL die beste Form ist, die wir gefunden haben, das glaube ich nicht.
Matthias Langhoff: Wahrscheinlich ist sie nur insofern die beste, weil sie flüchtig wie alle Formen ist.
Benno Besson: Ja. - Ich glaube auch nicht, daß es wiederholbar ist, in derselben Weise. Wir haben auch ganz andere Möglichkeiten jetzt, wir können immer fußen auf Erfahrungen, die wir schon gemacht haben und die das Publikum mit uns gemacht hat. Die Kontinuität, die Lebendigkeit der Verhältnisse, die wir zwischen Menschen geschaffen haben, wird reicher und dadurch auch interessanter, vielfältiger usw. In dem Sinne geht es uns darum, daß wir nicht große Modellinszenierungen machen, sondern daß wir die Verhältnisse zwischen uns innerhalb dieses Theaters und zwischen den Leuten, dem Publikum, immer vielfältiger und lebendiger gestalten. (...)
Matthias Langhoff: Das Wichtigste, was wir in den fünf Jahren doch geschafft haben, ist, daß wir jetzt einen Publikumsstamm haben. Theaterbesuch fängt ja damit an, daß man mehrere Vorstellungen gesehen hat, das heißt, daß man andere Vorstellungen, die man im selben Haus gesehen hat, mitsieht. (...) Wir erleben auch endlich, daß Leute, die Produktionen von uns ablehnen, sie doch besuchen, denn sie wollen die Volksbühnenarbeit in ihrer Gesamtheit verfolgen, das macht ihnen Spaß.
Manfred Karge: Das heißt, das Wichtigste ist nicht, daß ein Publikum einmal kommt oder auch mehrere Male, das muß noch kein produktiver Besuch sein, sondern daß es eine bestimmte Haltung zu einem Theater, zu einem bestimmten Theater gewinnt und zum Theaterspielen überhaupt. Daß es Theater begreift als Teil unseres Lebens und nicht nur als eine Ausnahmeerscheinung, wo man sich mal die Krawatte umbindet und mal hingeht.
Sprecher: Warum wurden Stücke wie RÄUBER, DON GIL VON DEN GRÜNEN HOSEN, DER GOLDENE ELEFANT aus dem Spielplan gezogen - abgespielt, wie es hieß, und dabei groß angekündigt?
Benno Besson: Ich meine, daß der Sinn der Vergänglichkeit so eng zusammenhängt mit dem Glücksgefühl und dem, was ist. Das Schöne am Theater sind nicht die Ewigkeitswerte, sondern die Vergänglichkeit der Ereignisse, die sich immer folgen. Und die Kontinuität dieser Vergänglichkeit, die sich doch durchsetzt. (...)
Ekkehard Schwarzkopf: Es gab eine Kunstideologie, wo Kunst gerade das sein sollte, was man im Leben nicht vorfindet, Kunst sollte etwas Fertiges, etwas Vollkommenes, etwas Ideales sein. Ihr sagt, daß es euch überhaupt nicht darum geht, etwas Perfektes zu liefern. Das ist eine Haltung gegenüber der Realität, die Haltung einer grundsätzlichen Anerkennung der Priorität der Wirklichkeit gegenüber allem Ausgedachten, Gesponnenen und Gewünschten. Ich glaube, das hängt zusammen mit dem Phänomen, daß dieses Theater sich ein Publikum verschafft hat, denn - das Theater hier ist ein bißchen anstrengend. Es wird den Zuschauern etwas zugemutet. Das Erstaunliche ist, daß trotz der Zumutung die Leute wiederkommen, oder sie kommen nicht trotz der Zumutung wieder, sondern weil ihnen etwas zugemutet worden ist. Weil von ihnen etwas verlangt worden ist und ihnen ermöglicht wurde, zu etwas Stellung zu nehmen.
(Auszüge aus einem Gespräch von Mitarbeitern der Volksbühne, welches durch die Filmgruppe des Theaters am 16. Mai 1975 auf der Treppe vor dem Haupteingang aufgezeichnet wurde. Abgedruckt in "Blätter der Volksbühne", Berlin 1976.)
Ein grauer Steinklotz, inmitten von grauen Steinklötzen: die Volksbühne. Keine Stadtrundfahrt führt durch diese Gegend, keine Baudenkmäler gibt es zu bewundern, keine Parks und keine exklusiven Restaurants ziehen den Fremden hierher. Unschöne Teilansicht eines Arbeiterviertels, der Berliner Osten, so gebaut in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, schmucklos, lieblos, unförmig.
Hinter dem Theater liegen die Mietskasernen zwischen Schönhauser und Prenzlauer Allee, eng beieinander stehende Häuserzeilen mit wenig Sonne und viel Hinterhöfen. Zur Rechten, wenige Meter entfernt, das erste Parteibüro der KPD, das Liebknechthaus. Rechts vorne führt der Weg zum Verkehrsknotenpunkt Alexanderplatz, vorbei am klotzigen Polizeipräsidium, der einstmals wichtigsten Behörde in dieser Gegend. (...) Weiter vorne die Drehe um Linienstraße, Alte Schönhauser und Münzstraße. Hier fand man die billigen Kneipen und die billigen Prostituierten. Dazwischen waren die Pfandleihen und die Kleidervermietungen. Und die größte Stempelstelle Berlins, das Arbeitsamt Gormannstrasse. Auch die armen Juden lebten in diesem Viertel. Später zogen die kleinen Parteigänger des großen Führers in die leergewordenen Häuser. Der Krieg schlug Lücken in das eng besiedelte Gelände, ein wenig Raum für Grünflächen blieb.
Dreimal wechselte die Anschrift: Volksbühne am Bülowplatz, Volksbühne am Horst-Wessel-Platz, heute Volksbühne am Luxemburgplatz. Dieses graue Viertel hat Geschichte. Seine Kulturgeschichte. Die Volksbühne ist Theater des Stadtteils.
("Blätter der Volksbühne", Berlin 1976.)
Shakespeare ist mir (...) immer schon unheimlich gewesen, nicht nur wegen der meist vielen Morde, auch wegen vieler Verwechslungen, Intrigen und anderer "Undurchsichtigkeiten". Deshalb war ich gut beraten, mir am Vorabend der Generalprobe wenigstens im Schauspielführer noch einmal die Fabel des Stückes durchzulesen. Kulturfunktionäre aus den anderen Betrieben unserer Hauptstadt - die es nicht getan hatten - sahen, unbedarft erschienen, doch recht alt aus und verließen zumeist das Theater schon in der Pause. Ich selbst konnte wenigstens noch einige Fragmente aus dem Shakespearschen "Macbeth" erkennen. Berücksichtigen muß man allerdings, daß die Neuinszenierung in der VOLKSBÜHNE "Macbeth" von Heiner Müller n a c h Shakespeare heißt. Ob es tröstet, daß selbst die Fachkritiker in unseren Tageszeitungen dem Dargebotenen eigentlich hilflos gegenüberstanden?
Am besten gefiel mir noch das Bühnenbild von Hans-Joachim Schlieker. So ein richtiger Berliner Hinterhof, plastisch dargestellt, geeignet für ein richtiges Volksstück, wie vielleicht "Krach im Hinterhof" oder ähnliches. (...)
Die Verfremdungen, die Heiner Müller vorzeigt, sind mir meist unverständlich, nicht deutbar. Das Spiel zum Teil anekelnd, fast sadistisch. Und da stellt sich für mich wirklich die Frage: Für wen wird hier eigentlich gespielt? Wirklich nur für einen Kreis von Fachleuten und/oder Theaterwissenschaftlern, für einen elitären Kreis von Theaterschaffenden oder -besessenen die sich "ausprobieren" wollen? Meine Aufgabe als Kulturfunkionär besteht darin, die Arbeiterklasse mit Theaterkunst bekannt zu machen, die hilft, sozialstische Persönlichkeiten zu prägen. Hier sehe ich mich bei besten Anstrengungen dazu außerstande. (...)
Ich hatte schon einmal gewünscht, die VOLKSBÜHNE möchte sich ihres Namens besinnen. (...)
(Carl Schwant in der RFZ-Frequenz, Nr. 21. Berlin 1982.)
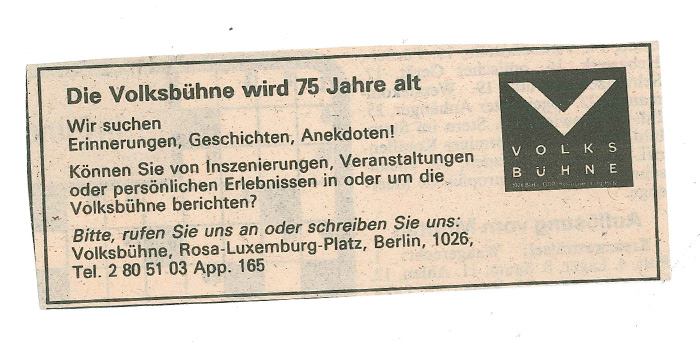
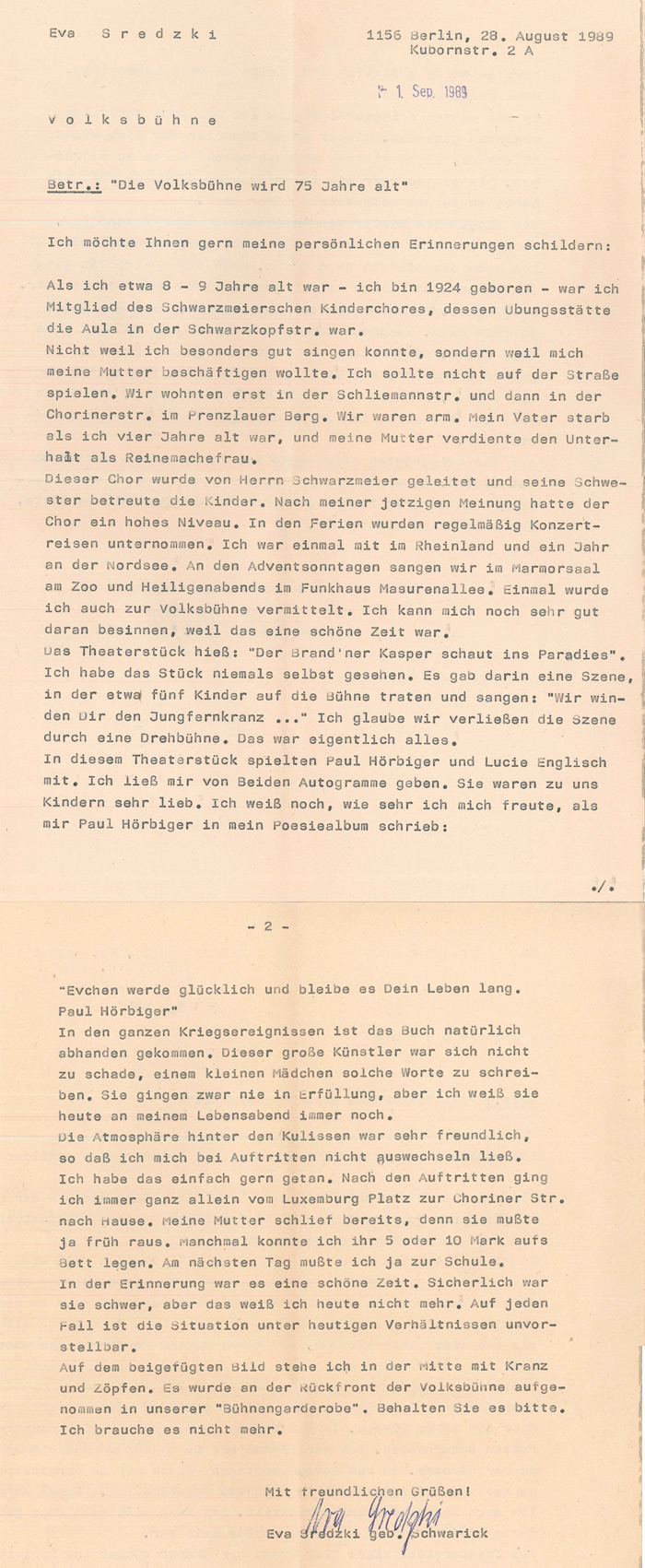

Der Bau ist von schlagender Häßlichkeit. Hier sollte man (eben deshalb) ein junges Theater gründen: mit ästhetischer Innovationslust, politischem Mut, ähnlich wie (und sicher ganz anders als) einst die Schaubühne am Halleschen Ufer. In diesem Haus (in bröckelnder SED-Stuck-und-Marmor-Pracht, auf der Strecke von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg, mit Blick sowohl aufs Liebknecht-Haus als aufs Programmkino Babylon) ließe sich etwas bewegen. Bespielbar, belebbar ist nicht nur die Hauptbühne, sondern drei Foyers und ein Studio. In der besten Zeit des Hauses haben das Besson, Karge/Langhoff, Müller vorgeführt, in Ostberlin unvergessen. Wir schlagen vor, daß das Land Berlin (mit dem Mut, den es 1970 hatte, Peter Stein und die Seinen aufzunehmen) die Volksbühne am Luxemburgplatz einer jungen Truppe, vermutlich mit Ex-DDR-Kern, gibt: einer Truppe, die IHR Theater machen will. Die sozialen, kulturellen Schocks und Wirrnisse unserer Lage könnten sich gerade in Berlin umsetzen: in einen neuen, erhellenden und verstörenden Blick des Theaters. Die Truppe der Volksbühne Ost würde ungefähr so viel Geld brauchen, wie die Volksbühne West zuletzt bekam, vielleicht weniger im ersten und zweiten Jahr. Bis zum dritten Jahr könnte sie entweder tot oder berühmt sein; in beiden Fällen wäre die weitere Subventionierung unproblematisch.
(aus: Überlegungen zur Situation der Berliner Theater. Friedrich Dieckmann, Michael Merschmeier, Ivan Nagel und Henning Rischbieter. Textfassung von Ivan Nagel. Berlin, den 6. April 1991)
"Ich bin in einem Schönheitssalon geboren. Mein Vater war eine Art Friseur. Meine Mutter war ein Callgirl, und wenn man rief, war sie immer da, wenn man rief, war sie immer da, wenn man rief, war sie immer da, wenn man rief, war sie immer da..." (Leonhard Cohen)
Das Gegenteil von Totalitarismus ist Aufklärung. Das Vermögen, seinen eigenen Verstand ohne Anleitung anderer zu gebrauchen, das Leben "ohne Leitbild" (Adorno) soll das Bollwerk bilden, das uns hindert, auf die Strategien demagogischer Menschheitsbeglücker hereinzufallen. Er muß gegen dieses offenbar existentielle Bedürfnis nach klaren Vorgaben, Leitfiguren und Weltbildern, nach der Geborgenheit des Kindes, das sich auf seine Eltern blind verlassen kann, schon starkes Geschütz aufgefahren werden, wenn es neutralisiert werden soll. Totalitäre Strategien suggerieren die Möglichkeit einer glücklichen Eltern-Kind-Beziehung als dominante Lebensorientierung auch für erwachsene Menschen, daß einen nie das Gefühl losläßt: immer ist einer da, der für mich sorgt und der weiß, wo es lang geht. Niemand, der eine Kindheit hatte, soll behaupten, er sei von derlei SehnSüchten frei. Es ist alles in uns selbst und deshalb geht es in der Auseinandersetzung mit totalitären Strategien nicht primär um verbrecherische Diktatoren und umfassend kontrollierende Staatsapparate, sondern um Denk- und Verhaltensweisen, die in uns selbst die latente Bereitschaft zu totalitären Lösungen signalisieren.
Wir sind nicht frei von Bedürfnissen, daß endlich alles stimmen soll, daß endlich Ruhe ist, daß störende Elemente beseitigt werden und daß wir mit einer überschaubaren Perspektive unser kurzes Leben verbringen können. Dies alles kann uns die freie Marktwirtschaft nicht versprechen, und deshalb werden der Zweifel und die Verzweiflung an dieser Wirtschaftsordnung nicht aufhören, solange es Menschen gibt, die Eltern hatten. Das zeigt sich beim Landwirtschaftsminister Kiechle, der seine Bauern nicht unter den, wie er sagte, "gnadenlosen" Marktgesetzen produzieren lassen will, oder auch bei sicherlich wohlmeinenden Teilnehmern der letzten Berliner Lichterkette, auf deren Transparent zu lesen stand. "Für Menschenfeinde gibt es auf der Erde kein Bleiberecht", die also zumindest verbal zu einer "Endlösung" neigen. Es zeigt sich auch bei den Kritikern der Volksbühne, die uns gleichzeitig Verwirrung und fehlende Botschaft vorwerfen und – noch vor Beginn dieses Totalitarismusprogramms – ein familiäres Verhältnis zum Stalinismus. Sie fordern also Leitbilder und Ausgrenzung, als wäre das Theater ein Propagandaunternehmen mit der Aufgabe, das Richtige richtig zu zeigen.
Die brutale Lebensform der sogenannten bürgerlichen Gesellschaft, die eine Gesellschaft von isolierten Individuen ist, von Waisenkindern, um im Bild zu bleiben, bringt den Wunsch nach einer höheren Ordnung und definitiven Kriterien mit sich, an die wir uns halten können. Totalitäre Denkmuster haben deshalb häufig etwas unerhört Beruhigendes und Entlastendes. Aber auch die immer wieder von aufgeklärt professoraler Seite erhobene Forderung nach gültigen Wertmaßstäben und -orientierungen hat in einer Gesellschaft, die sich nicht nach ethischen Prinzipien organisiert, sondern durch den stummen Zwang des Marktes keine Basis. Die historische Erfahrung, zumal dieses Jahrhunderts, hat gezeigt, daß Alternativen zu dieser desolaten Waisenkindergesellschaft nur als autoritär zu denken sind und zum Totalitarismus führen, ebenfalls in ein nicht nur wirtschaftliches Verhängnis. Deshalb sind wir alle schwankende Existenzen und brauchen offenbar, wie es die Rockgruppe Laibach in ihren Reflexionen über das Kapital beschreibt, manchmal lebensnotwendig den Glauben an eine Intelligenz, zu der wir aufschauen können, und manchmal ebenso notwendig das Mißtrauen in eine solche höhere Intelligenz.
Wenn unsere Schutzheilige Rosa Luxemburg vor nicht allzulanger Zeit noch eine Alternative benennen konnte: "Sozialismus oder Barbarei", so scheinen wir jetzt (wenn man die Tagesschau sieht) nur noch vor einer Tautologie zu stehen: "Barbarei oder Barbarei". Dies wiederum ist für das Theater nichts Neues: Die Wiege der Demokratie und der bürgerlichen Gesellschaft, das klassische Griechenland, hat mit der ersten Blüte dieser Gesellschaft auch ihre Tragödie hervorgebracht und das Theater tut seitdem nicht viel mehr, als diese tautologische Alternative in eine Form zu bringen. Man nennt das "die tragische Lebenserfahrung des Menschen im klassisch griechischen Sinn". Auch die Volksbühne steht unvermeidlich in dieser Tradition und wird wahrscheinlich nur Tragödien produzieren, auch wenn diese nach so vielen gescheiterten Generationen nur noch als Farce zu haben sind.
Diese lange Tragödientradition und der selbst in der Tendenz totalitäre Charakter kollektiver Theaterarbeit (der Einzelne unterwirft sich einem Gesamtplan) und die freischwebende Situation der Theatermenschen ermöglichen es vielleicht, mit den gegenwärtigen Formen gesellschaftlicher und individueller Ausweglosigkeit lebenspraktisch umzugehen und die Spannungen und Unsicherheiten ohne Kurzschluß zu ertragen, nicht defaitistisch und wehleidig, sondern lebensbejahend und hoffnungsvoll. "Wir müssen und Sysiphos als glücklichen Menschen vorstellen."
Die an der Volksbühne geplante Auseinandersetzung mit totalitären Denk- und Verhaltensmustern, die offenbar solche Unsicherheiten zeitweise neutralisieren können, wird keinen "freiheitlich-demokratischen" Konsens in schönen unwirklichen Bildern beschwören, sondern "Fehler" machen. Das Theater muß Fehler machen, wenn es mehr sein will, als funktionsloses Anhängsel umlaufender Ideologien. Die Bühne ist vielleicht der einzige soziale Ort, wo es richtig ist, das Falsche zu tun, wo regelmäßig Dinge geschehen, die "im Leben" Gefängnis, Irrenanstalt oder Tod nach sich ziehen würden.
"Der kalkulierende Mensch ist feige. Kalkulieren hat zu tun mit Gewinn und Verlust. Leben ist Gewinn, Sterben Verlust. Wer kalkuliert, beschließt, nicht zu sterben. Der Jäger, der zwei Hasen jagt, verfehlt beide. Wenn du schon Fehler machen mußt, mach sie richtig! Jage zwei Tiger!" (Laibach)
Carl Hegemann
Ein merkwürdiges Phänomen: Leute, die nicht oder nur ungern ins Theater gehen, die allergisch auf das Wort Theater reagieren, weil sie damit hochgestochene Dummheit und zeitraubende Langeweile verbinden, die Filme intensiver, die Bildschirme benutzerfreundlicher finden und die gewöhnlich keine zehn Pferde in den "Musentempel" bringen, solche Leute gehen in die Volksbühne. Leute, die das Theater lieben, die sich auf den nächsten Abo-Abend freuen, die im Theater wiederfinden, was sie im Deutschunterricht Interessantes gelernt haben, solche Leute fühlen sich in anderen Theatern besser bedient.
Auch die Regisseure Frank Castorf und Christoph Marthaler gehören zur ersten Gruppe, wie viele andere, die nicht so offen bekennen, dass sie eigentlich nicht gerne ins Theater gehen und dass sie das Theater eigentlich nicht interessiert. Warum hindert diese Einstellung sie nicht daran, Theater zu machen? Die Antwort ist so verblüffend wie einfach: Castorf und Marthaler machen gar kein Theater. Sie sind Theaterverweigerer. Die Zuschauer, die schimpfend aus der Volksbühne flüchten, haben recht, wenn sie sagen "Das ist kein Theater mehr." Aber was ist es dann? Die Antwort ist wieder ganz einfach: Wirklichkeit.
Bei Marthaler sitzen Leute auf der Bühne, lesen, grübeln, starren vor sich hin. Manchmal singen sie ein Lied. Sie waschen sich die Hände und trocknen sie ab. Sie ziehen ihre Mäntel an, verabschieden sich, kommen wieder. Sie spitzen ihre Bleistifte, bis sie abbrechen usw.
Bei Castorf rutschen sie aus auf echtem Kartoffelsalat und noch ekligeren Sachen. Sie stellen das nicht pantomimisch dar, sie rutschen wirklich aus. Manchmal fallen sie auch von der Bühne. Das tut weh. In der Flasche ist ein künstlicher Finger, aber echter Schnaps, der bis zum Rang stinkt wenn er ausgeschüttet wird. Ein echter, zwar etwas klein geratener Hubschrauber landet auf der Bühne, und zwei Riesenschlangen heben ihren Kopf und züngeln und winden ihren Körper um die Beine von Herbert Fritsch. Auch die Zuschauer werden einbezogen. Auch die Zuschauer werden einbezogen. Manchmal blockieren sich Publikum und Schauspieler gegenseitig. Dann passiert eine Zeitlang gar nichts, und große Ratlosigkeit breitet sich aus, oder man lacht sich kaputt im Zuschauerraum und auf der Bühne.
Und das ist alles nicht gespielt, es findet wirklich statt in Echtzeit, nicht in Echtzeitsimulation. Das dauert manchmal ziemlich lange, wiederholt sich auch mit kleinsten Varianten, wiederholt sich von Abend zu Abend, von Inszenierung zu Inszenierung. Trotzdem ist immer alles anders, und man weiß nie im voraus, was passieren wird. Denn der Ball ist rund, und jedes Spiel dauert 90 Minuten, mindestens.
Manchmal hat das Publikum auch Zeit, ein kleines Schläfchen zu machen. Anders als sonst im Theater, wo schon immer gern e geschlafen wurde, scheint bei Marthaler auch das inszeniert zu sein. Der Zuschauer geht nach Haus mit dem Gefühl, er habe die ganze Nacht im Theater verbracht.
Bei Castorf weiß man nicht, ob die Schauspieler ihre Rollen nur benutzen, um auf der Bühne Dinge tun zu können, die sonst und anderswo unmöglich wären. Manchmal spielen sie sogar richtig, wie im Theater üblich. Aber es fällt keiner tot um, wenn ein Schuss fällt, zumindest nicht, ohne sofort wieder aufzustehen. Zwar behauptet da jemand, er sei Prospero oder ein Rentier aus Oberwestfalen/ Lippe, aber auf die Glaubwürdigkeit solcher Äußerungen wird nicht der geringste Wert gelegt. So kommt auch hier die Realität zu ihrem Recht. Nebenbei: Brecht war es, der gegen den Realismus auf der Bühne mehr Realität forderte. Er wollte die Realität in der Theatersituation gegen die Illusion setzen, tat dies allerdings nur formal und inkonsequent.
Vielleicht wird nirgends im Abendland so wenig gelogen wie in einer Inszenierung von Marthaler oder Castorf. Das wäre allerhand, zumal wenn man bedenkt, dass in unserer Spektakelgesellschaft alles zum Theater wird oder zur Simulation von Simulation , wie man heute sagt. Etwaige tödliche Ausgänge sind allerdings, anders als im Theater nicht simuliert. Das Geheimnis der Arbeit von Castorf und Marthaler scheint darin zu liegen, dass sie die Theater definierende akzeptable Lüge vermeiden: die Illusion, die brecht abschaffen wollte, aber nicht konnte und die immer noch das Theater beherrscht. Die Bühne wird zum Ort, an den sich Realität flüchtet, die in der Welt keinen Platz mehr hat. Außerhalb des Theaters wird immer nur ein Stück gespielt. Es hat den Titel: "Wie es euch zerfällt". Es besteht aus Facetten einer sich auflösenden Welt, aus unendlich vielen, sich widersprechenden, aber grundsätzlich gleichberechtigten Perspektiven, weil nach dem Tode Gottes und dem unvermeidlichen Scheitern seiner politischen und wissenschaftlichen Ersatzsysteme keine Kriterien und Garantien für Wahrheit und Wirklichkeit mehr aufzufinden sind. Das Theater aber, das sich vom Theater verabschiedet, sucht nicht nach der verlorenen Realität, sondern schafft selber neue Wirklichkeiten: reflektierte, gestaltete Spezialwelten, die sind, was sie sind, die alles mögliche sind, nur kein Theater. Damit wäre geklärt, warum Verächter des Theaters lieber in die Volksbühne gehen als dessen Liebhaber und warum die letzteren sich dort so häufig geprellt fühlen.
Wenn kein Theater mehr stattfindet auf der Bühne, gibt es folgerichtig auch keine Stücke mehr zu sehen. Statt Prospero oder Philipp Klapproth sehen wir Sepp Bierbichler oder Henry Hübchen, wie sie sich kopfschüttelnd, distanziert oder aus der Rolle getreten auf diese Stückfiguren beziehen, genauso wie auf aktuelle und geschichtliche, private und öffentliche Ereignisse oder den physischen Bühnenraum.
Marthaler und Castorf sind Gegenwartsautoren, die auf der Bühne mit Hilfe von Schauspielern, Bühnenausstattern und dem ganzen Theaterapparat dreidimensionale, lebende Riesenbücher herstellen, die vom Gedichtband, über den politischen Essay bis zum Strafgesetzbuch alles umfassen können. Das gilt auf je andere Weise auch für Schlingensief und die nach wie vor obdachlosen Ratten. und Pirandello war der literarische Text noch ein adäquates Medium zur Beschreibung der Zerfallsprozesse der abendländischen Welt. Seit Beckett, Ionesco und Karl Valentin wird deutlich, dass das Ausdrucksmittel Sprache selbst von dieser Erosion erfasst ist. Damit ist das Ende des literarischen Theaters eingeleitet. Es rutscht ab ins Museum. Das muss nicht schlecht sein. Die Museen "boomen" ja. Aber es bedeutet, dass auch die schrecklichsten Tragödien von Aischylos bis Heiner Müller zum verklärten Gegenstand der Erinnerung an eine längst vergangene Überschaubarkeit werden, an eine harte, aber letztlich harmonische Weltordnung. Der literarische Autor, der Geschichten erzählt, ist allein durch das Medium, in dem er schreibt, ehrenvoll anachronistisch. Die geschichtliche Gegenwart, das was auf der Straße passiert, kommt heute auf andere Weise auf die Bühne. Nur auf Rhythmen, Musik und ästhetische Formen, die gegen die Erosion resistent zu sein scheinen, können sich Regisseur und Schauspieler als Rahmen ihrer Realitätsarbeit beziehen – und auf die Mechanismen des Lächelns und des Lachens.
Bis zu Kafka und Pirandello war der literarische Text noch ein adäquates Medium zur Beschreibung der Zerfallsprozesse der abendländischen Welt. Seit Beckett, Ionesco und Karl Valentin wird deutlich, dass das Ausdrucksmittel Sprache selbst von dieser Erosion erfasst ist. Damit ist das Ende des literarischen Theaters eingeleitet. Es rutscht ab ins Museum. Das muss nicht schlecht sein. Die Museen "boomen" ja. Aber es bedeutet, dass auch die schrecklichsten Tragödien von Aischylos bis Heiner Müller zum verklärten Gegenstand der Erinnerung an eine längst vergangene Überschaubarkeit werden, an eine harte, aber letztlich harmonische Weltordnung. Der literarische Autor, der Geschichten erzählt, ist allein durch das Medium, in dem er schreibt, ehrenvoll anachronistisch. Die geschichtliche Gegenwart, das was auf der Straße passiert, kommt heute auf andere Weise auf die Bühne. Nur auf Rhythmen, Musik und ästhetische Formen, die gegen die Erosion resistent zu sein scheinen, können sich Regisseur und Schauspieler als Rahmen ihrer Realitätsarbeit beziehen – und auf die Mechanismen des Lächelns und des Lachens.
Wenige Autoren wie Rainald Goetz und Elfriede Jelinek ziehen aus der Abgenutztheit der Sprache Konsequenzen. Ihre Theatertexte sind häufig aus vorgefundenem Material komprimiert und lassen viel Platz für außersprachliche Vorgänge. Castorf und Marthaler entwickeln die Partituren selbst, die das Theater braucht, das kein Theater mehr ist. Textvorlagen, darunter auch traditionelle Theaterstücke werden sehr gewissenhaft missbraucht. Man sollte nicht sagen, es gibt keine guten, aktuellen Stücke mehr. Es gibt sie, nur entstehen sie mittlerweile anderes und woanders, als wir das gewähnt sind. Die bloß schreibenden Autoren schreiben – wie aktuelle ihre Themen auch sein mögen – fürs Museum, solange das Theater für sie eine Wiederaufbereitungsanlage für Literatur ist.
Um das Theater ins nächste Jahrtausend zu retten, muss man es nicht neu erfinden, sondern abschaffen. Die Steigerung von Realismus ist Realität. Das Theater ist Produktion von Wirklichkeit nach Regeln der Kunst. Was in der Politik zu Faschismus und Totalitarismus führt, ist auf der Bühne genau richtig. Das Theater der Zukunft ist kein Theater, sondern gestaltetes Leben. Der Tragödienregisseur Einar Schleef war sich dieser Paradoxie bewusst, als er sagte: "Ich würde soweit gehen, dass es kein Leben gibt außerhalb meiner Produkte."
Als der fröhliche Wissenschaftler Nietzsche in der Maske des "tollen Menschen" einem verständnislos grinsenden Publikum den Tod Gottes verkündete, musste er feststellen, dass keiner die Tragweite dieses Ereignisses erkannte. "Ich kam zu früh", sagte er, "Ich bin noch nicht an der Zeit. Dieses ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert..." Er ging in die Kirche und sang ein Requiem für den verstorbenen Gott. Und er fragte sich, wie man sich trösten kann, wenn man das "Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß", umgebracht hat. "Welche Sühnefeiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen?" Nun scheint die Zeit da zu sein. Das "ungeheure Ereignis" ist angekommen und wandert nicht mehr. Nun können wir erfahren, wie diese "heiligen Spiele" aussehen. Castorf und Marthaler gehören u den Autoren, die sie erfinden.
Carl Hegemann im
Leporello 7, Spielzeit 1993/1994
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren!
Liebe Mitglieder und Gäste des Wirtschaftsrats der CDU!
CHANCE 2000 ist ein überkonfessionelles künstlerisch politisches Bündnis, das aber seine Wurzeln im Katholizismus nicht verleugnet. Es versteht sich als „postcaritative Hilfsorganisation“ für Menschen, die aus der Gesellschaft herausgefallen sind, und möchte Politik und Wirtschaft für deren Belange sensibilisieren. Anläßlich Ihrer Tagung über die Krise des Sozialstaats wollen wir Denkanstöße geben und mit Ihnen in den Dialog eintreten.
Wir alle sind Menschen, und deshalb gibt es grundsätzlich mehr, das uns verbindet als trennt. Auch Sie gehen davon aus, daß der Mensch im Zentrum steht. Und zwar nicht die abstrakte Idee, sondern die konkreten, sterblichen Menschen, die ihren Alltag bewältigen und versuchen, das Glücksversprechen der bürgerlichen Gesellschaft nach Kräften für sich einzulösen. Auch Sie, so vermuten wir jedenfalls, wollen die kapitalistische Wirtschaftsordnung nicht als Betrugssystem verstanden wissen, und zwar nicht aus moralischen Gründen. Der Markt selbst ist es, der die Wirtschaft zwingt, das Glücksversprechen ernst zu nehmen. Heute mehr denn je. Mit Mogelpackungen ist ernsthaft kein Geschäft mehr zu machen, mit Stumpfsinn und Entfremdung kein Unternehmen erfolgreich am Leben zu halten. Das heißt: Jeder kann sein eigener Unternehmer sein, und Kapitalismus heißt nicht (mehr), daß sich Menschen gegenseitig übers Ohr hauen, sondern daß sie einander helfen. Nichts wird mehr aus Geldgründen instrumentalisiert, nur das Geld selbst wird instrumentalisiert, um intakte Zwischenmenschlichkeit und größtmögliche Problemlösungskapazitäten in einer echten Dienstleistungsgesellschaft zu befördern. Verkaufs- und Wirtschaftsfachleute wie Edgar K. Geoffrey (ABSCHIED VOM VERKAUFEN) oder Tom Peters (JENSEITS DER HIERARCHIEN, MANAGEMENT IN CHAOTISCHEN ZEITEN) haben nachgewiesen, daß Unternehmen nur noch funktionieren, wenn solche Maximen ganz ernst genommen werden, wenn Tugenden und Verhaltensweisen gepflegt werden, die über das pure Verwertungsinteresse hinausweisen, wenn das Unternehmen, in seiner Organisation, in seinen Produkten und Leistungen für ein besseres Leben steht – und zwar wirklich und nicht nur als Werbespruch. Was dies heißt, sollte nicht unbeachtet bleiben: Die Gesellschaft transformiert sich in eine freie Assoziation im Überfluß lebender Individuen, die selbstbestimmt tätig sind und nach ihren je eigenen Bedürfnissen leben können. (Wollten das nicht auch Marx und das Ahlener Programm?)
So weit, so gut, wir sind dafür. CHANCE 2000 unterstützt selbstverständlich diese Tendenz. Auch wir denken streng marktwirtschaftlich, risikofreudig und innovativ und rufen uns und Ihnen zu: Alles Aufgeben! Fehler machen! Scheitern ist Chance! Nicht Wandel, sondern Revolution, nicht Revolution, sondern permanente Revolution, Unsicherheit! Verrückte Unternehmen für verrückte Zeiten! Helfen! Helfen! Helfen! Handeln! Handeln! Handeln!
Wenn Sie diese Imperative, die wir bei Tom Peters, dem umsatzstärksten Wirtschaftsautor aller Zeiten (außer Karl Marx) abgeschrieben haben, wirklich ernstnehmen, läßt sich auch das Problem lösen, das Sie zu dieser Tagung zusammengeführt hat: die Krise des Sozialstaats.
Wir wissen wie Sie, daß die beschriebene glückliche Entwicklung des Kapitalismus leider nur für eine Minderheit gilt. Zwei Drittel bis vier Fünftel der Menschen fallen aus der globalen Marktwirtschaft heraus und stehen unsichtbar im Schatten. Ohne die Segnungen des sich transformierenden Kapitalismus genießen zu können, leben sie außerhalb der Vernetzung in einem Vakuum und sind sich selbst überlassen. Der größte Teil dieser Menschen wird nie mehr eine Arbeit im Sinn traditioneller Lohnarbeit finden. Der Sozialstaat, man denke ihn national oder global, ist überfordert. Der größte Teil der Menschheit erscheint schlicht als überflüssig. Das aber darf nicht sein und trifft auch nicht zu. In dieser von allem freigestellten, riesigen Gegenwelt wird auch gearbeitet, hier wird Sinn produziert und dem Leben auf den Grund gegangen, hier fallen absoluter Stillstand und Höchstgeschwindigkeit zusammen. Arbeitslosigkeit ist ein Beruf, Arbeitslose sind die unvermeidliche Rückseite des entfalteten Kapitalismus. Wie sie ihr Leben außerhalb des Systems organisieren und, wie in früheren Zeiten eigentlich nur Künstler und Dichter, selber mit Sinn erfüllen, oder wie sie Sinnlosigkeit aushalten, verdient Anerkennung und Bewunderung. Alle können davon lernen. Arbeitslosigkeit muß als Beruf anerkannt werden, als guter Beruf, und zwar ideell und materiell, so ähnlich wie in alten Stammesgesellschaften, wo Mitglieder, die sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht an der Schaffung der Subsistenzmittel beteiligen konnten, von der Gemeinschaft besonders verehrt und großzügig unterstützt wurden.
Was steht dagegen, den Menschen, die aus der Globalisierung herausfallen und gleichzeitig einen wesentlichen Teil der Menschheit darstellen, auf ähnliche Weise Achtung zu zollen? Sind es einfach zu viele? Nein, das ist kein Hindernis. Was uns bei der Lösung dieses Problems blockiert, ist der Umstand, daß, wie zu Max Webers Zeiten, dem Geld noch immer ein quasi religiöser Status eingeräumt wird. Nach der fortschreitenden Auflösung sämtlicher Glaubensysteme und festen Orientierungen, im Zuge der kapitalistischen Entwicklung und der Aufklärung ist Geld der einzige und letzte Wert, auf den hin, wie Heiner Müller sagte, „Orientierung realistisch oder sogar möglich ist“.
Eine aufgeklärte Gesellschaft kann sich aber auch diesen letzten Kristallisationspunkt mystisch religiöser Weltsicht, der ausgerechnet im Geld bestehen soll, nicht leisten. Wer sich wirklich klar gemacht hat, daß wir nicht für das Geld da sind, sondern daß wir Geld benutzen, um den Markt zu vereinfachen und zu regulieren, und darüberhinaus weiß, daß wir alle dazu verurteilt sind, lebenslänglich zu leben, und daß uns alle am Ende, schuldig oder nicht schuldig, die Todesstrafe erwartet, weiß auch, daß dieser letzte fixe Glaube an das Geld als solches ihm nicht weiterhilft. Er kann deshalb, wie der wahrscheinlich nicht ohne Grund bei uns ziemlich unbekannte griechische Philosoph Krates, sein Geld locker wegschmeißen, zumindest das, was er nicht braucht.
Die Einsicht in die Hinfälligkeit und Nichtigkeit der menschlichen Existenz, im biblischen Buch PREDIGER bereits vor fast zweieinhalbtausend Jahren ziemlich endgültig gewürdigt, mag vor nicht allzu langer Zeit noch zu Lethargie und Verzweiflung geführt haben. Heute ist sie eine Voraussetzung für die Transformation des Kapitalismus, der jeder metaphysische Glaube, auch der Glaube an das Geld, im Wege steht. Wenn dieser Glaube zerstört ist, können wir leichten Herzens auf die angehäuften Geldsummen verzichten, die wir sowieso nicht gebrauchen können. Was da übrig bleibt, könnte den Arbeitslosen auf der ganzen Welt die materielle Basis zu einer selbstbestimmten Existenz verschaffen. Wenn es zutrifft, daß Marktwirtschaft nur weiterfunktionieren kann, wenn nicht das Geld, sondern jawohl: christliche Tugenden dominieren wie Liebe und Vertrauen, Verständnis, Zärtlichkeit, Mut, Großzügigkeit und Opfer, treten wir in ein neues Zeitalter ein. Wer der CDU nahe steht, sollte hier hellhörig werden.
Auch für den Reichsten ist es schöner, seinen Reichtum in einer Welt ohne Armut und Obdachlosigkeit zu genießen als hinter den Mauern eines von der Welt abgeschotteten und von schwer bewaffneten Privatarmeen geschützten Privilegiertenghettos. „Der Blick in das Gesicht eines Menschen, dem geholfen ist, ist der Blick in eine schöne Gegend“, sagt Brecht. Helfen verlangt nicht, daß man ein besserer Mensch ist, es ist einfach schöner und nutzt der Wirtschaft.
Machen Sie es also wie der Philosoph Krates in Athen, der an seinem vierzigsten Geburtstag im Jahre 303 v. u. Z. sein Geld auf dem Marktplatz verstreute und einfach nur noch lebte, oder wie heute George Soros, der erfolgreichste Spekulant der Welt, der seine Milliarden in Bosnien zum Wiederaufbau einsetzt, oder wie Wolfgang Joop, der CHANCE 2000 mit den Zinsen seines Vermögens unterstützt. Schmeißen Sie Ihr Geld weg und retten Sie die Marktwirtschaft! Und vielleicht Ihre sterbliche Seele! Und sagen Sie es weiter. Organisieren Sie die Verteilung. Wenn Geld als religiöser Fetisch aus der Mode kommt, wird es auch nicht an falschen Stellen landen. Der Sozialstaat ist dann nur noch ein obsoletes Denkmodell aus dem zwanzigsten Jahrhundert, weil Sozialstaat und Kapitalismus eins geworden sind. Wir möchten wissen, was Sie davon halten. Sprechen Sie mit uns. Rufen Sie uns an oder senden Sie ein Fax.
Ihre Freunde von CHANCE 2000
Christoph Schlingensief und Carl Hegemann
(Unter dem Titel „helfen helfen helfen“ In: Theater Heute, Nr. 8 / 9, August / September, 1998, S. 1f.)
top
Die möglichen Themen und Fragen des Theaters sind deckungsgleich mit den Themen und Fragen der Welt, in der es spielt. Theater als soziale Kunst kann sich nicht abschotten gegen die Welt, wie das vielleicht in der bildenden Kunst möglich ist. Es ist selbst Teil der Welt, so wie die Gesellschaftswissenschaften selbst Teil der Gesellschaft sind und die Geisteswissenschaften Produkte des Geistes, den sie untersuchen. Wenn Shakespeare in seinem späten Stück TIMON VON ATHEN auf die beiläufige Frage eines Malers „Was macht die Welt?“ einen Dichter antworten läßt: „Sie nutzt sich ab im Lauf“, dann gilt das umgekehrt nicht nur für die Welt, sondern auch für den Mikrokosmos des Theaters.
Weder die Welt noch das Theater sind taufrisch. Das ist speziell für die Herstellung von Kunstwerken, die sich als solche nach Niklas Luhmann durch die Unwahrscheinlichkeit ihres Zustandekommens kennzeichnen lassen, ein Problem. Kunst muß neu sein, überraschend. Wo aber alles, was passiert, nur auf etwas verweist, das so ähnlich schon einmal dagewesen ist, wird das Neue zum Alten. Das nutzt sich ab. Aus Kunst wird Routine, Gewerbe, Zeitvertreib, weil es einfach nichts Unwahrscheinliches mehr gibt. Was auch immer im Theater gemacht wird, es ist schon einmal dagewesen, jeder mögliche Versuch, seine Grenzen zu sprengen, ist durchgespielt worden, und immer ist es wieder bei den wenigen Grundvoraussetzungen gelandet, die sich vor 2500 Jahren in Athen herausgebildet haben – und wenn man Shakespeares Fiktion ernst nimmt, schon 100 Jahre später, eben zur Zeit Timons, abgedroschen waren. „Nichts Neues unter der Sonne.“
In diesem Jahrhundert haben das die Naturalisten genauso erfahren wie die Dadaisten und die Surrealisten, Bertolt Brecht genauso wie Heiner Müller. Auch die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Patz ist da keine Ausnahme. Castorf, Marthaler und Schlingensief stehen für die dortigen Versuche, die Konventionen des Theaters zu sprengen, und jeder von ihnen ist an einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung, wie eigenwillig auch immer, zur Konvention zurückgekehrt. Bei Marthaler geschah dies zuerst mit seiner vollständig und geradlinig erzählten Hamburger KASIMIR UND KAROLINE-Inszenierung 1997 und setzte sich an der Volksbühne mit komplett texttreuen DREI SCHWESTERN fort. Große Inszenierungen, die wirken, als seien sie lange vor MURX oder den STURM-Segmenten entstanden. Bei Castorf fing dies 1998 an mit Sartres SCHMUTZIGE HÄNDE, wo erstmals durchgängig Dialoge als Dialoge und Figuren als Figuren inszeniert wurden und trotz einiger aktueller Einsprengsel und ästhetischer Eskapaden so etwas wie Dekonstruktion nicht mehr stattfand, und zeigte sich ein Jahr später wieder in der wunderbaren Seifenoperntragödie nach Dostojewskijs DÄMONEN. Selbst Schlingensief inszenierte seine Boulevardkomödie DIE BERLINER REPUBLIK zunächst fast konsequent im konventionellen Theaterrahmen, hielt dies aber nicht aus und zerstörte sein Werk schon vor der Premiere. Verweigerung des Theaters auf dem Theater ist aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr möglich, und so wird Schlingensief entweder Entertainer oder Aktionskünstler. Oder beides.
Diese Entwicklung bestätigt den selbst nicht mehr ganz neuen paradoxen Befund: Wer etwas Neues will, muß irgendwann zum Alten zurück. Das Unwahrscheinlichste, was diese Regisseure noch machen konnten war es eben, zur Konvention zurückzukehren. Das bedeutet aber: Entwicklung verläuft nicht als ansteigende Linie, sondern als Kreis. Oder besser als Spirale. Denn wir kehren ja nicht einfach zum Ausgangspunkt zurück, wie wir ihn verlassen haben, sondern schleppen die Erfahrungen mit, die wir auf dem Weg gemacht haben. Deren Umfang wächst und wächst ins Unermeßliche, ähnlich wie die Zahl der Weltbevölkerung, die sich in immer kürzeren Abständen verdoppelt. Mit der Zeit entwickelt das Theater und die Welt einen ungeheuren Ballast, der außer durch Amnesie nicht wegzukriegen ist. Die Abnutzung der Welt korrespondiert mit der Anhäufung der Resultate unendlich vieler Versuche ihrer Erneuerung. Das Gleiche gilt für das Theater. Eine ungeheuerliche Müllhalde, die sich wie der Turmbau zu Babel ins Unendliche schraubt, bis die Spiralwindung so angeschwollen ist, daß sie sich in einen amorphen Klumpen verwandelt. Irgendwann berührt sich der sich verengende Kreis an seinen Rändern. Dann gibt es keine Spiralbewegung mehr mit einer eindeutigen Richtung, sondern eine Ansammlung von Elementen, die in ihrer Verklumpung den bisherigen Ordnungsprinzipien, den physikalischen Gesetzen und der Logik nicht mehr entsprechen.
Diese Verklumpung oder Verwachsung, die als theoretisches Modell Alfred N. Whitehead zuerst beschrieben hat, deutet auf etwas wirklich Neues: „Das Ende der Naturgesetze und die Entlassung des Geistes in sich selbst“, wie der Hyperspaceforscher und Pflanzenpharmakologe Terence McKenna aus Kalifornien prophezeit. Das Raum- und Zeitkontinuum verschwindet. Kausalität, in der Wissenschaft seit der Quantentheorie obsolet geworden, dürfte dann auch im Alltag ihre erklärende Kraft verlieren, wenn es dann überhaupt noch so etwas wie Alltag gibt. Für McKenna steht diese Verwachsung kurz bevor, er datiert sie sogar: auf das Jahr 2012, wenn dann so banale Sachen wie Jahreszahlen überhaupt noch vorkommen. Denn auch die Zeit wird dann zu Ende sein. „Alles fließt zusammen“, was übrig bleibt ist der „autopoetische lapis, der alchemistische Stein der Weisen am Ende der Zeit“, „die Monade, die fähig ist, sich selbst für sich selbst auszudrucken (sic).“
Wenn es ein Medium gibt, das für solche apokalyptischen Visionen Modelle liefert, ist es natürlich nicht das Theater, sondern das digitale Datenknäuel der virtuellen Realitäten des Computers, mit dessen Hilfe jede Art von Korrespondenz und Vernetzung möglich ist, wo Abfolgen beliebig herstellbar sind, wo vorher und nachher, vorne und hinten nichts mehr bedeutet, wo Entfernungen keine Rolle spielen und wo Phantasie und Einbildungskraft eigene Realitäten produzieren, wo alles, was man wollen kann, vorhanden und abrufbar ist und in Sekundenschnelle auf beliebige Weise synthetisiert werden kann: dreidimensional, gegenständlich, akustisch und intersubjektiv, jenseits der Schwerkraft. Hier scheint der Traum größenwahnsinniger Theaterleute und Gesamtkunstwerkbesessener wahr zu werden, die hier alles in einem sein können: Schauspieler, Regisseure, Bühnenbildner – und mit der entsprechenden Ausrüstung im Cyberspace dreidimensionale Bühnenbilder unendlichen Ausmaßes mit den Menschen und Gegenständen ihrer Wahl beleben können. Im Cyberspace lassen sich ganze Welten in Sekunden kreieren, wie sonst nur im (Tag-)Traum. Aber diese Welten sind gegenständlich dreidimensional mit der entsprechenden Ausrüstung (Cyberbrille, -handschuh, -anzug) auch intersubjektiv wahrnehmbar und begehbar: belebte Hologramme, bewohnbare Filme, Theater ohne Grenzen. Der Film MATRIX zeigt, wie das geht und auch das traurige Los der unvermeidlichen aber störenden Wetware, der ‚vergessenen‘ menschlichen Körper, an denen das alles hängt. Es sind zwar nur virtuelle Welten, und ein simpler Stromausfall läßt sie verschwinden und irgendwelche Viren können dafür sorgen, daß niemand mehr sie im Netz wiederfindet, aber sie schaffen eine neue Möglichkeit der Objektivierung von Phantasie, die es bisher auf vergleichbare Weise noch nicht gab. Ihre Perfektionierung erfolgt in immer schnelleren Schritten.
Daß diese Technologie in der Welt ist und hochgerechnet werden kann, läßt auch uralte erkenntnistheoretische Probleme in einem neuen Licht scheinen. Als sich Kant vor 220 Jahren in der KRITK DER REINEN VERNUNFT nach den Bedingungen von Erfahrung und Bewußtsein fragte, beschäftigte er sich auch mit solchen damals noch rein fiktiven Phänomenen, die er „intellektuelle Anschauung“ nannte. Und er beschied, daß dieses Vermögen, gedachte Wirklichkeiten umstandslos gegenständlich werden zu lassen, Gedankenbilder intersubjektiv auf direktem Wege erfahrbar zu machen, dem Menschen nicht gegeben ist. Nur dem „Urwesen“ Gott sei so etwas wie intellektuelle Anschauung oder anschauender Verstand, die Identität von Einbildung und Wirklichkeit, vorbehalten. Es wäre spannend gewesen zu erfahren, was Kant von der digitalen Technologie gehalten hätte, die uns endliche Menschen mit solchen unendlichen Fähigkeiten zu beglücken scheint. Gott ein Computerprogrammierer, wir seine virtuelle Realität? Dieser Gedanke liegt dem des großen Welttheaters des Barocks gar nicht so fern. Und nun haben wir unsere eigenen Computer und schaffen unsere eigenen virtuellen Welten? Verwirklichung des romantischen Traums? Pippi Langstrumpf, die sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt? Alle physischen Widerstände beseitigt? Bis es soweit ist, dauert es noch, aber die Technologie dazu ist vorhanden.
Merkwürdig ist nur, dass, während man sich überall für die Möglichkeiten dieser neuen Technologie brennend interessiert, das Theater – trotz der damit verbundenen, scheinbar unendlichen Erweiterung theaterspezifischer Gestaltungsmöglichkeiten – nichts davon wissen will. Außer in der Verwaltung und der Presseabteilung. Oder vielleicht doch nicht so merkwürdig?
Die spielentscheidende Frage für das Theater ist, ob dieses neue Medium, das intellektuelle Anschauung zu ermöglichen scheint, von den übrigen kommunikativen und informativen Möglichkeiten ganz abgesehen, für Menschen, die nicht nur aus Phantasie und Geist bestehen, sondern auch aus Fleisch und Blut, ohne irgendeine Gegenläufigkeit praktizierbar ist. Von der Beantwortung dieser Frage hängt es ab, ob das Theater in Zukunft als anachronistischer Appendix zum globalen oder monadenhaften Cyberspacetheater existieren wird – sei es als Luxus für die elektronisch übersättigten Reichen oder als Beschäftigungstherapie für Freaks in irgendwelchen Kellern. Oder ob das alte Theater, das noch auf physische Menschen und handgemachte Bühnenausstattungen angewiesen ist, so etwas wie eine conditio humana symbolisiert, in dessen Produkten sich unvermeidlich Phantasie und physische Widerständigkeit im Wege stehen oder eine disparate Einheit eingehen. In diesem theatralen Aufeinandertreffen von physischer Ohnmacht und kreativer Allmacht würden dann im Kantschen Sinne notwendige Bedingungen menschlicher Erfahrung reflektiert, die intellektuelle Anschauung als Möglichkeit menschlicher Praxis ausschließen.
Cyberspacepropheten behaupten gerne, was eine wirkliche Welt mit physischen Menschen, Tieren und Pflanzen bedeutet, könne man erst ermessen, wenn man virtuelle elektronische Welten zum Vergleich hat. Und nach ihrer bisherigen Erfahrung mit diesen virtuellen Welten ist es für sie keine Frage, wo man sich lieber aufhält. Plötzlich ist die physische Welt nicht mehr die einzige selbstverständlich, sondern vergleichbar mit konkurrierenden Welten, und dabei scheint die althergebrachte ganz gut abzuschneiden. „Ein blühender Baum ist mit nichts, was du im Cyberspace herstellen kannst, vergleichbar“ sagte einer von ihnen. Die Frage ist, ob Theaterarbeit ohne Widerstand des Materials möglich ist, und ob Erfahrung und Selbstbewußtsein, d. h. „das ‚Ich denke‘, das alle meine Vorstellungen muß begleiten können“ nicht diese bewußtseinsunabhängige Widerständigkeit braucht, um überhaupt zu funktionieren. Wenn es so wäre, wären die computeranimierten virtuellen Realitäten nicht erfahrungserweiternd, sondern erfahrungszerstörend. Das würde dann auf die Unvermeidbarkeit des Theaters verweisen. Allerdings weniger in seiner Funktion ständiger künstlerischer Erneuerung, als Fabrik für Unwahrscheinliches – da läuft es sich aufgrund der Endlichkeit seiner Ressourcen tot –, denn als Ritual der Endlichkeit und Profanität unserer Lebensformen und der damit verbundenen unabänderlichen „Dürftigkeit des Lebens“.
Während andere Berliner Theater gerade damit beginnen, die aktuelle gesellschaftliche Realität auf die Bühne bringen zu wollen, ist die Volksbühne bereits in den letzten Jahren so mit dieser Realität gesättigt worden, daß sie sich teilweise nicht mehr davon unterscheiden konnte. Deshalb kann sie es sich nun leisten, die Virtualität und Eigenständigkeit des Mikrokosmos Theater zu reflektieren. Eigene Welten experimentell und im Blick auf Tradition und Geschichte entstehen lassen. Und im chaotischen Raum, der die Fortschrittsspirale in einen unstrukturierten Klumpen zu verwandeln droht, Breschen zu schlagen und Orientierungsmuster nicht zu entdecken, sondern zu erfinden und zu ‚implementieren‘. Je mehr sich die Volksbühne von der aktuellen Politik und Gesellschaft abwendet, desto näher kommt sie vielleicht deren Problemen. Als Tragödientheater, das im Kampf gegen das Verhängnis dieses gerade produziert, kommt es seiner ältesten Bestimmung wieder nahe und ist damit aktueller als jede Gegenwartsdramatik, die bewußtlos alte Formen mit vermeintlich neuen Inhalten auffüllt.
Der Weg des Theaters, jedes Theaters ist mit Paradoxien gepflastert, das bekannteste ist das Paradox über den Schauspieler, aber die ganze Anordnung ist paradox. Wer das Theater – sei es zugunsten der Realität, sei es zugunsten reiner Phantasie – abschaffen will, rettet es im Scheitern dieser Versuche. Wer es erhalten will, wie es ist, zerstört es. Die Zwischenwelt ‚Theater‘ ist so stabil und so fragil wie das menschliche Leben und die Realitäten, die wir in diesem Leben aufbauen. Wir müssen lernen, ohne Glauben zu leben, wenn wir die verlorene Stabilität zurückhaben wollen. Wir müssen zur Tragödie zurück, die ursprünglich das Theater ausmachte. „Die Paradoxie ist die Orthodoxie dieses Jahrhunderts“, sagte Luhmann. Die Volksbühne stellt sich dem Paradoxen, indem es Paradoxien bekämpft, denn nur dann werden sie erfahrbar. Insofern ist sie ein orthodoxes Theater.
Dies mag verstiegen klingen. Aber vielleicht hat ja Bill Shanky, der ehemalige Trainer des FC Liverpool, recht, der als Vertreter einer anderen, dem Theater sehr verwandten Sportart, einst dementierte, Fußball sei ein Spiel auf Leben und Tod. „Es geht“, sagte der, „um viel, viel mehr.“ Und der Sportteil der Süddeutschen Zeitung erklärte dazu, daß „man das Wesen des Fußballs nur begreift, wenn man über die Grenzen des Normalen hinausdenkt. Weil der Fußball anders als der Alltag immer wieder Raum läßt für das maximal Unglaubliche, also für das Undenkbare.“ Nichts Neues also: Theater muß wie Fußball sein. Die Regeln bleiben. Sie ändern sich höchstens in Nuancen.
(Vollständige Fassung eines Beitrags zu dem Buch „Castorfs Volksbühne. Schöne Bilder vom häßlichen Leben“, hrsg. von Hans-Dieter Schütt und Kirsten Hehmeyer, Berlin: Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf, 1999, S. 226-228.)
top
„Überall auf der Oberfläche der Erdkugel bereitete sich eine an sich selbst und an ihrer eigenen Geschichte zweifelnde, müde, erschöpfte Menschheit darauf vor, so gut es ging, ein neues Jahrtausend zu beginnen.“
Michel Houellebecq, ELEMENTARTEILCHEN, 1998
„Im Osten ist der Eindruck verbreitet, die Atmosphäre sei schon wieder so ähnlich, wie vor dem Ende der DDR. Es könnte sein, daß sich die Kräfte des Marktes über diese Stimmung nicht ganz im Klaren sind.“
Mark Siemons, FAZ vom 03.12.1999
Das Jahrhundert endet mit ein paar Überraschungen. In Seattle artikulierte sich ein globaler Widerstand gegen die Globalisierung, in einer Heftigkeit, die kaum jemand erwartet hätte. Möglich geworden ist die hier zuschlagende, vielschichtige und weltweite Protestbewegung durch dieselben elektronischen Kommunikationsmedien, die auch das Movens der Globalisierung bilden. Und, vielleicht nicht weniger wichtig, in Berlin ist plötzlich ein neuer Ernst an die Stelle der bequemen Ironie getreten, die sich so flächendeckend ausgebreitet hatte, dass ihr am Ende nichts anderes übrig blieb, als sich selbst zu ironisieren und damit zum Verschwinden zu bringen – wie die berühmte Schlange, die sich vom Schwanz her selbst verschlingt. An der Volksbühne manifestierte sich dieser neue Ernst schon in den Castorf-Inszenierungen SCHMUTZIGE HÄNDE und DÄMONEN und, seit Beginn dieser Spielzeit, in den Inszenierungen von Thomas Bischoff (DER GESTOHLENE GOTT) und Sebastian Hartmann (GESPENSTER). Das Motto „Ohne Glauben leben“ erweist sich dabei weniger als ambivalente aufzufassende Parole denn als schlichte Zustandsbeschreibung: Es ist ein Merkmal der Gegenwart, dass man nicht mehr weiß, was man glauben soll. Übrigens auch nicht, was man fühlen und wen man lieben soll. Die Aufklärung hat ganze Arbeit geleistet und jede Gewissheit durch hartnäckiges Hinterfragen zerstört, ohne überzeugende neue Gewissheiten zu liefern. Einzig dem Fetisch des Geldes und der Kapitalakkumulation wird noch auf eine quasireligiöse Weise gehuldigt. Beim Geld hörte schon immer der Spaß auf. Und Geldwegschmeißen ist die einzige Sünde, die nicht verziehen wird. Das ist so, auch wenn jeder weiß, dass man Geld nicht essen kann und das Totenhemd keine Taschen hat. Der Kapitalismus ist tatsächlich konkurrenzlos geworden, keine Alternative in Sicht, und selbst die Kirchen denken in ihren Überlebensstrategien streng marktwirtschaftlich. Denn die Gesetze der Marktwirtschaft verbreiten sich nicht nur extensiv über die Welt, sondern auch intensiv bis in die letzten Winkel unserer privaten Existenz. Nicht nur die Abschaffung der Vaterländer, sondern auch das Ende der Familie liegt in ihrer Logik, wie Marx schon wusste. Und die persönlichen Beziehungen, die, selbst dem Markt entzogen, bisher das Funktionieren des Ganzen zu ermöglichen schienen, werden zunehmend marktförmiger, d. h. einem geschäftsmäßigen Kalkül unterworfen. Die kommerzielle Kälte, die alles erfasst, ist ein Problem. Der Kapitalismus, der sich als effektive Problemlösungsagentur versteht und legitimiert, versucht auch dieses Problem über den Markt zu lösen. Paradox. Reflektierte Verkausfsstrategen propagieren den „Abschied vom Verkaufen“, der Kunde wird zum Partner, der Verkäufer „Berater“ und selbstloser Freund. Solche nichtinstrumentellen Verhaltensweisen sollen einen nicht zu unterschätzenden Marktvorteil bringen: „Wir verkaufen Ihnen keine Möbel, wir suchen die optimale Lösung für ihr Problem“, heißt es daher in der Werbeschrift des neu eröffneten Berliner Möbelhauses „Minimum“. Selbst an diesem zweifelhaften Beispiel sieht man, dass Marx recht hatte, als er sagte: „Die kapitalistische Produktionsweise kann sich also nur erhalten, wenn sie gleichzeitig ihre eigenen Existenzbedingungen unterminiert.“ Vielleicht geht es dem Kapitalismus wie der Ironie – wenn er alles gefressen hat, bleibt ihm am Ende nur übrig, sich selbst zu fressen. Und dann?
Dann – oder besser schon vorher – muss man über den Kapitalismus hinaus denken. Denn der Rückweg zum Partikularismus, zur Scholle und zum feudalen Paternalismus ist verbaut (nicht erst seit dem Bekanntwerden von Helmut Kohls Sündenfall); einen Rückfall hinter die Aufklärung kann es nicht geben, das Illusionistische solcher Retroversuche ist auch durch äußerste Willensanstrengung nicht mehr zu beseitigen. Die Relativierung der eigenen Wahrheit hat zudem den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass meine Wahrheit auch nicht mehr dazu herhalten kann, zu legitimieren, anderen, die diese Wahrheit nicht begreifen wollen, den Schädel einzuschlagen. Das Unwirklichwerden der Welt, das Fehlen von gültigen Ideen enthält allerdings ebenfalls ein großes, dann eben sinnloses Gewaltpotential.
In dieser Situation der strukturellen Ungewissheit wird Ambiguitätstoleranz – d. i. die Fähigkeit, unstrukturierte, nichtdefinitive Situationen zu ertragen – vielleicht zu einer der wichtigsten Tugenden für das neue Jahrhundert. Künstler, Schriftsteller und Theatermenschen haben diese Tugend schon zu Zeiten besessen, als die Welt noch in Ordnung schien, denn Künstler zeichneten sich schon immer durch die Unfähigkeit aus, sich mit der gerade üblichen Wahrnehmung der Welt zufrieden zu geben.
Folgerichtig bietet die Volksbühne zum Einstieg in das neue Jahrtausend im Januar dem Publikum die Möglichkeit, sich mit Kunstfiguren und literarischen Helden der Vergangenheit zu beschäftigen, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie höchst unkonventionell und höchst entschieden in höchst unklaren Situationen zu Werke gingen: Caligula, Don Quixote, Lei Feng!
Caligula, der verschwenderischste aller römischen Kaiser, ist der Erste. Der junge Albert Camus schildert ihn als einen Despoten, der es angesichts der Sterblichkeit und Verlogenheit der Menschen vorzieht, nichts mehr zu tun, was sich zweckrational begründen ließe. Nach dem Tod seiner inzestuös geliebten Schwester vollzieht er eine radikale Absage an jedes vernünftige Kalkül, mordet und entfaltet eine Willkürherrschaft – in der Gewissheit, dass diese letztlich auch ihm den Kopf kosten wird. Die Bereitschaft zu sterben gibt ihm die Freiheit zu tun, was er will. Weil der Himmel leer ist, ist alles erlaubt. Selbstmord als in die Länge gezogener Amoklauf eines Tyrannen, der keinen Sinn mehr darin sieht, Verantwortung für sich oder gar für andere zu übernehmen. Frank Castorf bringt diesen konsequenten Helden des Absurden in seiner Inszenierung konsequenterweise mit Georges Batailles GESCHICHTE DES AUGES und seiner THEORIE DER VERSCHWENDUNG in Verbindung, wo Souveränität und Exzess zusammenfallen. Das ist obszön und gleichzeitig die radikalste Absage an die kapitalistische Verwertungslogik, die sich denken lässt. Für Bataille, den Buchhalter und Bibliothekar, und für Camus war das Antiökonomische solchen Terrors nur ein faszinierender Gedanke. Für manches Schulkind scheint das heute eine reale Perspektive zu sein.
Videoschnipselhistoriker Jürgen Kuttner hat sich für seine erste echte Inszenierung den Helden der chinesischen Volksbefreiungsarmee Lei Feng vorgenommen, der von Mao höchstselbst 1963 als politisch-moralisches Vorbild initiiert wurde und dessen Tugenden dem entsprechen, was im Osten TIMUR UND SEIN TRUPP verkörperten und im Westen Rudi Dutschke, DIE FÜNF FREUNDE und andere K-Gruppen. Bei diesen gilt der kategorische Imperativ, den Anderen niemals nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck zu betrachten, mit einer Selbstverständlichkeit, die auch heute noch Rührung auslöst. Lei Feng entzieht sich dem ökonomischen Prinzip genauso wie Caligula, aber er verschwendet sich für das Gute. Wie es für Helden typisch ist, muss auch er früh sterben, aber er weiß wofür: „Fröhlich sein, Gutes tun, und die Spatzen pfeifen lassen!“ Dieser Held, dessen einstige Anhänger heute größtenteils noch leben und z. B. im Bundeskanzleramt oder in der Spiegelkantine Gutes tun, erscheint vielleicht als der anachronistischste in unserer Heldengalerie. Die jüngste Vergangenheit ist am weitesten weg. Aber der Aufbau einer neuen heilen Welt und das Opfer Lei Fengs verweisen auf eine Sehnsucht, von der wir nicht wissen, ob sie bloß ein verschwindendes feudales Überbleibsel ist, oder ob sie der Kapitallogik selbst entspringt.
Die Welt ist ein Supermarkt. Im unbegrenzten Warenangebot muss auch das ganz Andere seinen Platz haben. „Wenn es heute jemandem gelingen sollte, einen sowohl ehrlichen als auch positiven Diskurs zu entwickeln, wird er den Lauf der Welt verändern“, sagt Houellebecq. Er hätte hinzufügen müssen: „... wenn man ihm glaubt“.
Der dritte Held ist Don Quixote. Cervantes’ berühmteste Romanfigur zieht es vor, angesichts der zerfallenden Realität des Feudalismus im Spanien im 15. Jahrhundert, die Wahrheit seiner alten Ritterromane zu leben, und konstruiert sich anhand dieser Literatur eine – fast – perfekte eigene Welt, in der er zusammen mit seinem treuen und verständnisvollen Knecht (Wahnsinn lässt sich allein nicht ohne größere Paranoia realisieren) die Abenteuer erleben kann, die ihm in seinem maroden Kaff versagt sind. Der erste Roman der Weltliteratur, der die Flucht in eine virtuelle Welt beschreibt und zeigt, wie man sich die Lebensbedingungen halluziniert, die man braucht, um sich nicht umzubringen. Ziemlich komisch. Die gesellschaftlichen Zerfallsprozesse in jüngster Zeit – erst der Sozialismus, und nun auch der Kapitalismus – legen Reaktionen nahe, die an Don Quixote erinnern. Auch Johann Kresnik, immer noch bekennender Kommunist in einer säkularisierten Welt, die unter der Oberfläche aus Gewalt und Terror besteht, kann sich in dieser Figur wiederfinden, muss es aber nicht. „Der tiefste Glaube ist der Glaube an eine Fiktion, von der man weiß, dass sie eine Fiktion ist und dass außer ihr nichts existiert.“ Dieser Satz ist nicht von Hitler und nicht von Stalin, sondern das letzte Glaubensbekenntnis der Aufklärung. Light age. Wallis Stevens. Wer heute Erfolg haben will, muß werden wie Don Quixote. Ohne Ironie.
(Leporello Januar 2000)
top
1.
Früher war es nur das Theater, das den vermessenen Anspruch hatte, mit dem allmächtigen Schöpfer zu konkurrieren, und Menschen und Welten zu schaffen, die es vorher nicht gab. Theater war der Ort, an dem Realitäten produziert wurden, die die herrschende Realität transzendieren sollten. Ungeheure geistige und technische Anstrengungen wurden seit seinen Anfängen unternommen, um diese neuen Welten und Menschen eindrucksvoll zu präsentieren. Schon die Antike kannte hochkomplizierte Flugmaschinen zum Einfliegen der Götter. Aber am Ende glichen, durch die Verhältnisse bedingt, diese Versuche, selbst wenn sie technisch gelangen, doch immer sehr dem Elend, von dem sie sich absetzen wollten, und seit 2500 Jahren enden sie, wenn sie gelingen, regelmäßig in der Tragödie. Paradoxerweise gelten sie dann als gelungen.
Die Mittel des Theaters, die Dürftigkeit des Daseins wenigstens auf der Bühne zu überwinden, waren immer beschränkt. Die Allmachtsphantasien der Theatermacher schlugen regelmäßig um in reale Ohnmacht angesichts des unüberwindbaren Widerstands des Materials, zu dem ja im Theater nicht zuletzt auch die Akteure gehören, und auch angesichts der wankelmütigen und geschmacksunsicheren Geldgeber. Die fanden zwar das zweckfreie und unkalkulierbare Tun der Gaukler immer irgendwie wichtig, aber weil es eben Luxus war und nicht zu den „Pflichtleistungen staatlicher Grundversorgung“ gehörte, sicherten sie es nie richtig ab.
Nun gibt es im Verbund mit einer ‚neuen Ökonomie‘, die so neu gar nicht ist, allseits vernetzte ‚neue Medien‘, ‚neue Technologien‘ und ‚neue Wissenschaften‘, die das Theater, nachdem es schon durch den Siegeszug des Films und des Fernsehens schwer angeschlagen ist, endgültig marginal und vorgestrig erscheinen lassen. Die Schöpfung hat ihren paradigmatischen Ort nicht mehr beim lieben Gott und im handwerklichen Phantasieraum des Theaters, sondern wird biotechnologisch und digital angegangen. Das, so scheint es, ist in der Massenkultur langfristig kostengünstiger und wirkungsvoller als die anachronistischen und aufwendigen Arbeitsweisen des Theaters – und kalkulierbarer als Gottes unerforschlicher Ratschluß. Und läßt manchen hoffen, mit Tragödie und Ambivalenz endlich fertig zu werden.
2.
Die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts und die Fortschritte der Molekularbiologie versprechen, wenn auch nicht sofort und nicht unproblematisch, den neuen, potentiell unsterblichen Menschen, der vom Leiden und der wiederkehrenden Verzweiflung, die bisher seine Geschichte prägten, frei sein soll. Die Weiterentwicklung der Computertechnologie erlaubt darüber hinaus in digitalen Paralleluniversen die unmittelbare Umsetzung selbst der phantastischsten Ideen, von denen Menschen, z. B. Theaterregisseure, bisher immer nur träumen konnten, und zwar dreidimensional und intersubjektiv gegenständlich. Wenn man die entsprechenden tools hat. Die Beschränkung durch die physikalischen Gesetze ist dort aufgehoben, zwar nicht in ‚echt‘, aber immerhin in Echtzeitsimulation. Und die kleinen Nanomaschinen werden dann Biologie und Elektronik verbinden. Das Ganze in einem unglaublichen Tempo und vielleicht auch ohne unser weiteres Zutun. Am Ende hat sich der Mensch dann wie bei Michel Houellebecq durch eine neue, von ihm selbst geschaffene, vollkommenere Spezies ersetzt. Vielleicht aber auch durch eine noch katastrophalere. Diese technologiegestützte Spekulation scheint heute die im letzten Jahrhundert gescheiterte sozialrevolutionäre zu ersetzen. Die gibt nicht nur neue Themen für das Theater, sondern berührt auch dessen Selbstverständnis.
3.
Die Beschäftigung des Theaters mit den neuen Technologien folgt nicht nur einer Mode. Denn wir haben es mit Technologien zu tun, die das Theater sozusagen auf seinem ureigenen Gebiet überbieten. Herbert Fritsch, bei uns als Schauspieler beschäftigt, ist bereits in der Lage, in seinem Wohnzimmer am Computer digitale Klone von sich selbst und anderen Schauspielern herzustellen, deren Stimmen und Bewegungen zu manipulieren oder deren Motorik digital auf simulierte Tiere zu übertragen, so daß uns plötzlich ein Löwe mit den unverkennbaren Bewegungen von Herbert Fritsch entgegenkommt. Und trotz ärgerlicher Softwarefehler funktioniert das: Die Tücken der Objekte und Subjekte, mit denen man es sonst bei der Produktion riskanter Theaterabende zu tun hat, und die natürliche Begrenztheit der Möglichkeiten des Theaters tauchen hier nicht mehr als Problem auf. Man kann sich ganz auf die interne Logik des poetischen und ästhetischen Prozesses stürzen. Es soll keiner sagen, das sei für die künstlerische Phantasie ohne Reiz. Der Gedanke, auf Menschen und Material zu verzichten, und die fixen Ideen und Phantasien, die man im Kopf hat, per Klick unmittelbar in einen gegenständlichen Raum zu übertragen, ist durchaus faszinierend und entspricht den Autonomievorstellungen vieler Künstler. Mancher Regisseur, der sich auf der Probe quält, wenn nichts funktioniert, wünscht sich so einen Computersklaven, der, gut programmiert, jeden seiner Gedanken genau so umsetzt, wie er ihn haben will. Schon Arbeiten, wie am Schneidetisch sitzen, oder die Bildmanipulation digitalen Materials haben ziemlich viel mit den Träumen dieses Berufs zu tun. Die Möglichkeit, während der letzten Spielzeit die Castorf-Inszenierung von Dostojewskijs DÄMONEN trotz verweigerter Filmförderung in ein anderes, wenn auch nur digital-videomäßiges Medium zu transformieren, hatte für die Beteiligten etwas Befreiendes. Der poetische Geist ist nicht an das Theater gebunden. Daß er noch nicht wirklich im Cyberspace angekommen ist und dort meistens Öde und Langeweile herrschen, liegt nicht am Medium, sondern an uns. Von den Ingenieuren und Technikern, die das entwickelt haben, muß man keine Kunst erwarten, genauso wenig wie vom Hersteller von Ölfarben.
4.
Trotzdem ist es vielleicht für das Theater das Klügste und Beste, diese neue Situation zu ignorieren. Ich meine das ohne Ironie. Vielleicht gehört das Theater ja ins Museum, ins Museum für uralte Medien. Die Theaterbauten in Deutschland eignen sich hervorragend als Museen. So wie Dinosaurier, Mumien, Gemälde, Kunst- und Gebrauchsgegenstände aus vergangenen Zeiten muß auch dieses erwürdige Medium, von dem alle späteren in irgendeiner Hinsicht abstammen oder geprägt sind, konserviert werden und öffentlich zugänglich sein. Und weil Theater nur Theater ist, wenn es live ist, muß das ein Museum sein, in dem das Theater von lebendigen Schauspielern immer wieder zum Leben erweckt wird. Das müßte eigentlich funktionieren, denn die Museen boomen ja. Eine völlige Geschichtsvergessenheit kann man sich in Europa nicht leisten. Die Theatermacher müßten ihren musealen Status dann nur akzeptieren, denn das Peinliche ist ja immer, daß man glaubt, man könnte mit den alten Formen und mit den alten Stücken einen gültigen Beitrag zur Gegenwart leisten. Die sieht man im Theater aber immer nur von weitem, auch wenn die Stücke aktuelle Themen behandeln und erst heute Morgen geschrieben worden sind. Theater leistet alleine durch seine Form immer nur Beiträge zur Vergangenheit. Das sollte man erst mal einsehen. Es ist nicht ehrenrührig, denn es muß nicht alles aktuell sein, was geschieht, und gerade die Bewahrung der früheren Fundamente unserer Zivilisation, zu denen das Theater zweifellos gehört, ist wichtig für unser geschichtlich gegenwärtiges Selbstverständnis und genauso subventionswürdig wie die sonstigen Museen, die andere historisch überlebte Elemente der Welt auf liebevolle Weise bewahren. Das könnte Herr Peymann vielleicht von Herrn Stein lernen. Wir finden das eine schöne und reelle Vorstellung von Theater heute. Als Museum wird und soll es überleben, gerne auch in einem Großcontainer auf der EXPO.
5.
Doch leider sieht man sich an unserem Arbeitsplatz, an der Volksbühne, nicht in der Lage, die Zukunft nach solchen klugen und bewahrenden Gesichtspunkten anzugehen. Schon 1992, als wir an der Volksbühne anfingen, haben wir gesagt, daß es nicht leicht werden wird, das Theater ins nächste Jahrtausend zu retten – und daß es auch nicht so wichtig ist. Das Medium ist nicht so wichtig. Die ästhetischen, politischen und poetischen Fragen, die uns interessieren, stellen sich auch unabhängig vom Medium Theater. Die Volksbühne bewegt sich in der Tradition der revolutionären Kunst Erwin Piscators, der zu seiner Zeit Theater auf dem höchsten Stand der Entwicklung der Produktivkräfte machte und für den Multimedia-Produktionen in der Volksbühne schon 1925 selbstverständlich waren (nach dem Krieg dann nicht mehr). Das prägt. Und wenn wir uns nicht abschotten können gegen die neuen Entwicklungen, müssen wir uns eben für die öffnen.
Die Alternative zu einer solchen Offenheit gegenüber den medialen Umwälzungen, die für das Theater durchaus sinnvoll wäre, die neuen Entwicklungen einfach komplett zu ignorieren und sich als Museum zu begreifen, ist also der Volksbühne schon auf Grund ihrer Geschichte und ihres Kunstverständnisses nicht möglich.
Wir können nicht im Saft einer hermetisch geschlossenen Theatertradition schmoren, wir wollen unser Know how der Entwicklung dieser Gesellschaft zur Verfügung stellen, und wir müssen uns das ‚hypertheatrale‘ Know how der Computeringenieure aneignen, um es für unsere Zwecke zu nutzen. Wir müssen, um sinnvoll weiterarbeiten zu können und überlebensfähig zu sein, wie jedes Unternehmen in Zeiten des rasenden Wandels unser Unternehmenskonzept von Grund auf ändern. Das heißt mindestens: Wir müssen unser altes Lippenbekenntnis, das Theater sei für uns nur eine Kommunikationsform unter vielen, praktisch folgenreich ernst nehmen. Deshalb wird unsere Spielstätte im Berliner Prater in ein digitales Filmstudio verwandelt, deshalb eröffnen wir eine weitere Spielstätte im Cyberspace. Deshalb interessieren wir uns für motion capturing- und physiognomics-Programme. Deshalb arbeiten wir zusammen mit avancierten Softwareentwicklern wie „Avatarme“ in London oder „Artifacial“ in Tel Aviv. Deshalb versuchen wir uns unabhängig zu machen von Raum und Zeit. Wir brauchen dazu keine Subventionen. Es sind aber Investitionen erforderlich, die der Erforschung des humanen Potentials der neuen Technologien dienen und der Entwicklung der Gesellschaft unter ganz anderen Bedingungen als noch vor ein paar Jahren Impulse geben sollen. Gerade unsere traditionelle Neigung zur Subversion ist hier gefragt. Die amerikanische Theaterwissenschaftlerin und Programmiererin Brenda Laurel hat in ihrem Buch COMPUTERS AS THEATRE schon vor Jahren auf die Bedeutung des Theaters für die sinnvolle Entwicklung der digitalen Technologie hingewiesen, auf die Notwendigkeit der Beschäftigung etwa mit der griechischen Tragödie oder der Dramentheorie des Aristoteles für die Codierung der neuen Gestaltungs- und Kommunikationsformen. Katharsis ist in ihrem Buch neben dem Wort Interface das am meisten gebrauchte Wort. Das hört sich etwas besser an als Otto Schily, der eine Internetpolizei fordert.
Wir haben keine Subventionsmentalität ausgebildet wie der Steinkohlebergbau. Künstler und Unternehmer brauchen das Risiko gleichermaßen. Wir wollen lediglich angemessene Vergütung für unsere Arbeit entsprechend dem Marktwert und keine Einschränkung der Konkurrenzfähigkeit durch willkürliche und wettbewerbsverzerrende Subventionsvergabe. Am musealen Theater fallen arbeits- und kostenintensive Forschung und Neuentwicklung weg. Die machen aber bei der Volksbühne die Hauptarbeit aus. Museen sind wichtig und teuer, aber sie dürfen nicht auf Kosten der notwendigen Erforschung und Entwicklung neuer Lebensformen gehen. Die Volksbühne braucht Anschubfinanzierungen, um sich ernsthaft mit den neuen Technologien konfrontieren zu können. Dann steht nichts im Wege, in den neuen digitalen Spielstätten auch gewinnorientiert zu arbeiten, zwar nicht für den Markt, das ist uninteressant, aber im Markt. Geld ist auch eine Form der Anerkennung und wird gerne bezahlt, wenn das Produkt einen Gebrauchswert hat und Wünsche erfüllt. Unsere Kunden haben allerdings in der Mehrzahl nicht viel Geld zur Verfügung, und der Gebrauchswert wird in der experimentellen Phase erst noch entwickelt. Darüber hinaus gibt es für uns keinen Grund, bestimmte Dinge, die wir zeigen oder sagen wollen, nicht im Medium Film oder im Fernsehen auszuprobieren, es gibt keinen Grund, sich nicht im virtuellen Raum zu präsentieren und das Internet theatral (und nicht nur als Mainstream-Homepage) zu nutzen, es gibt nicht mal einen Grund, die Produktion von Fernsehserien im Container oder Talkshows auszuklammern (Schlingensief!). Man kann sogar Werbung machen, wenn das Produkt stimmt. Wir existieren – ob wir wollen oder nicht – immer nur in Relation zum Markt, sonst wäre Globalisierung, als „intensive und extensive Totalität“ des Kapitalismus (Marx), ein Popanz. Subversion ist selbst eine Funktion des Kapitals und wie Ambivalenz eine notwendige Bedingung des Wachstums. Zwischen den Megaproduktionen aus Hollywood, den standardisierten Fernsehproduktionen und der privaten Heimkino- respektive Computerproduktion gibt es eine Menge Spielraum. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß Künstler und Unternehmer in vielerlei Hinsicht ähnlich sind. Sie bringen Neues in die Welt und lieben das Abenteuer. Die Volksbühne arbeitet wie jedes mittelständische Unternehmen mit großen Risiken und mit einer großen Verantwortung. Wir wollen im Erfolgsfall, wie andere Unternehmen auch, den Gewinn einfahren und investieren können. Und wir haben Entwicklungs- und Forschungskosten, die sich nicht schlagartig amortisieren und nicht nur uns selber zugute kommen. Das heißt, die öffentliche Hand muß uns bei der Umstrukturierung des Ladens Investitionen ermöglichen. Es ist schließlich ihr Laden. Sie ist Eigentümerin nicht nur von lebendiger Kunst, sondern in unserm Fall auch von einer anspruchsvollen Innovationsmaschine.
6.
Die Alternative dazu ist auch verlockend: Stillstand, Einschlafen oder Routine. Einfach verschwinden. Obsolet werden. Dazu ist die Volksbühne aber aus strukturellen und historischen Gründen bisher nicht in der Lage. Wir können uns einfach nicht zum gemütlich kritischen Weltstadttheater für Politikerfrauen entwickeln. Wir entwickeln uns eher zu einem kleinen, populär-elitären Medienkonzern. Das ist der Versuch, das, was am Theater wichtig ist, was uns an seiner zweieinhalbtausendjährigen Geschichte noch reizt, mit dem, was durch die neuen Medien, die digitale Technologie und die sogenannte zweiten Schöpfung auf uns zukommt, in einen Zusammenhang zu bringen. Natürlich mit der Hoffnung, daß die furchtlose und unbefangene Auseinandersetzung mit den neuen elektronischen Simulationsformen und den technischen Heils- und Horrorversionen ein neues Interesse an der sogenannten Wetware hervorruft (an den zerbrechlichen und gefährdeten Menschen zwischen Hard- und Software), und die Unersetzlichkeit des Theaters als Reflexionsagentur dieser sich offenbar zunehmend selbst in Frage stellenden Spezies demonstrieren kann. Das Theater als ‚Kerngeschäft‘ soll und muß erhalten bleiben. Auch wenn und gerade weil es sich nie gerechnet hat und nie rechnen wird. Die Menschen rechnen sich eben nicht. Ökonomisch betrachtet sind sie ein Flop.
Carl Hegemann
(In: Carl Hegemann (Hg.): Glück ohne Ende. Kapitalismus und Depression II. Alexander Verlag Berlin, 2000, S. 153-164. Dieser Text ist drei Jahre später nochmals in gerkürzter Version unter dem von Henning Rischbieter gewählten Titel „Das Museum Theater bewahren und verändern – Über die Volksbühne und die neuen Medien“ erschienen in: Dramaturg, Zeitschrift der dramaturgischen Gesellschaft, 2/03, S. 3-6.)
top
"SPD und PDS bekennen sich zur Unwirklichkeit Berlins. "Peking, Havanna, Berlin", so hatte der CDU-Kandidat Frank Steffel im Wahlkampf gewarnt, werde die Liste der kommunistisch regierten Metropolen lauten, wenn die PDS an die Macht käme. Jetzt ist es so weit: Die Rechtsnachfolger der führenden Partei der Deutschen Demokratischen Republik regieren in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Steffels Vision stand offenbar auch der SPD vor Augen, als sie die Präambel der Koalitionsvereinbarung entwarf, die von der PDS weitgehend bestätigt wurde. Sie ist ein Dokument der Angst und zugleich das gültige Manifest, was die Hauptstadt heute ist und sein will, das Gründungspapier einer neuen Berliner Republik, die sich zu ihrer notgedrungen postmodernen Kondition offensiv bekennt. Die Präambel ist von einem abgründigen Gegensatz geprägt, demzufolge Berlin zugleich nichts und alles ist. Während sich in der Koalitionsvereinbarung der knappe Satz findet: "Berlin ist ein Sanierungsfall", heißt es in der Präambel, die mit den enzyklikaträchtigen Worten "Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ..." beginnt: "Berlin repräsentiert eine der führenden Industrienationen der Welt, die in die westliche Wertegemeinschaft eingebunden ist." Mit anderen Worten: Ein Sanierungsfall symbolisiert eines der Machtzentren der Welt, ein Kerngebiet des Abendlands. Aus dieser Paradoxie, die beunruhigenderweise auch etwas über den Zustand des solchermaßen vertretenen Landes aussagen könnte, resultiert die Angst. Wenn Berlin nichts anderes ist als "Hauptstadt", als symbolische Repräsentanz eine Wesens, dessen materieller Boden andernorts liegt, muß man sich darüber Sorgen machen, ob die hier produzierten Symbole überhaupt mit dem Symbolisierten Übereinstimmen. Nur so ist der eigentümliche Satz zu erklären, den keine andere Landesregierung bisher für nötig hielt: "Wir wissen um die besondere Verpflichtung Berlins gegenüber dem Bund und zu bundesfreundlichem Verhalten". Befürchtet wird also offensichtlich, daß eine PDS-regierte Hauptstadt zur Avantgarde einer gegen die Usancen der Bundesrepublik gerichteten Fundamentalopposition werden könnte. Die Präambel ist von Gysis Wahlkampfprogramm durchzogen, daß Berlins Hauptstadtfunktion der Stadt selbst und der ganzen Nation bewußter werden soll. Das ist realistisch, weil zunächst nur vom Bund das Geld kommen kann, das der Stadt aufhilft. Aber es legt auch mit aller Klarheit offen, daß die Wirklichkeit der Stadt und aller ihrer Themen bis auf weiteres nur eine symbolische ist: die Einheit des Landes, die Kreativität der Metropole, die Öffnung nach Osten, die Integration in die westliche Wertegemeinschaft; sogar von der historischen Versöhnung der deutschen Arbeiterbewegung hatte der Berliner SPD-Vorsitzende Strieder einmal gesprochen. Auch die wirtschaftliche Gesundung erwartet die Präambel vor allem von der Kultur, den genuinen Sphären der Symbolproduktion. Tatsächlich könnte man Berlin als die realste und die unwirklichste Stadt Deutschlands zugleich bezeichnen: die realste, weil sich hier die sozialen Härten und die ost-westlichen Dissonanzen unverstellter von neutralisierenden Angestellten-Milieus zeigen als andernorts; die unwirklichste, weil das Treiben keinen ökonomischen Boden hat und deshalb in Wahrheit in der Luft hängt. Die Beamten- und Intellektuellen-Stadt produziert schon seit langem zu wenig materielle Werte, um sich selbst zu halten, und dafür um so mehr immaterielle. In dieser Lage schlägt die Stunde der wahren Dialektiker, als die man die PDS-Strategen von heute am ehesten verstehen kann. Sozialisiert in einem Ideen-Macht-Komplex, der über Nacht kollabierte, in sein Gegenteil umschlug, wissen sie mit leichten Zeichen souverän zu jonglieren, wirkungsvoller jedenfalls als die in dieser Hinsicht schwerfällig gewordene SPD, die sich kaum mehr zu einem programmatischen Gedanken versteigen mag. Bei der PDS wimmelt es dagegen nur so an Gedanken, oder vielmehr an Vokabeln, die mit virtuoser Schwerelosigkeit ins Feld geführt und gleich wieder aufgehoben werden. Der "Sozialismus" etwa ist ständig präsent, doch als Subjekt der Geschichte erscheint er kaum mehr im Singular, sondern nur in der unübersichtlichen Menge vieler kleiner Fortschritte zu mehr "Gerechtigkeit". Die Codes der marxistischen Geschichtsphilosophie sind abrufbereit, doch sie können sich behende mit anderen Denkmustern, etwa dem der "Moderne" verbinden. Fest steht nur die aus Erfahrung kommende Überzeugung, daß kein System ewig währt. So wird Hegel wieder auf den Kopf gestellt: Wie in der maoistischen Kulturrevolution und in den postmodernen Managementtheorien soll das Bewußtsein das Sein hervorbringen, die mentale Stärke die ökonomische nach sich ziehen. Insofern sind die der PDS zugeteilten Posten des Wirtschafts- und Kultursenators gerade aufgrund ihrer Virtualität die wahren Zukunftsressorts: Mit ihnen soll sich die Stadt am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ansonsten wird die PDS ihr Mandat zur Symbolproduktion wohl weidlich nutzen. Subversiver als Stellungnahmen zur Nato könnte da die von ihr ausgehende Insinuation sein, daß selbst die Bundesrepublik wandelbar ist, zur Disposition steht. Aber dafür, daß sie so schön kritisch und kreativ ist, schätzte die Nation ja auch bisher ihre Hauptstadt. Berlin soll offenbar zu einer Art Volksbühne der Republik werden: ein subventioniertes Theater, dessen Gemeinnützigkeit in seinen wohlkalkulierten Provokationen besteht. Alle Berlin-Unterstützung wird, so gesehen, von nun an Kulturpolitik sein."
Mark Siemons, FAZ, 9.1.02
1.
Das Gefühl, in New York fehl am Platz zu sein, hat sich nach und nach aufgebaut. Die falsche Entscheidung für den Irak-Krieg bestärkte das natürlich, die Amerikaner wurden von Tag zu Tag patriotischer und durchgeknallter. Wie paradox: Während sich die ehemalige Sowjetunion amerikanisiert, sowjetunionisieren sich die Amerikaner mit ihren restriktiven Gesetzen und politischer Willkür [...] Es fühlte sich unfrei an. Gleichzeitig wurden alle hysterischer. Das spürt man in New York besonders intensiv, weil sich diese Stadt über dich stülpt und dich dann wie ein Schwamm aufsaugt. Wirklich: Europa ist die letzte Insel der Freiheit.
Wolfgang Joop hat seine Zelte in New York wieder abgebrochen. Der preußische Modeschöpfer ist wieder in Berlin, wo er sich antizyklisch mit der Kreation von Nichtalltäglichem, von Luxus beschäftigt: Frivoles für Wunderkinder, die nicht vor 16 Uhr aufstehen. Joop in der Vogue: „Ich denke, in Zeiten, in denen eine Hauptstadt so pleite ist, kann man doch eigentlich nur abends ausgehen.“ Die sich „amerikanisierende“ ehemalige Sowjetunion ist dann möglicherweise der Markt, der diese Luxusproduktion lukrativ machen könnte. Denn hier erzeugt die absolute Deregulation der Märkte und Lebenszusammenhänge zwar unendliche Armut für die Verlierer und Versager, aber auch ungeheuren Reichtum für die, die sich durchzusetzen verstehen. Freiheit pur. „Wenn man im heutigen Moskau Ärger mit den Nachbarn hat, engagiert man am besten einen Killer. Der löst das Problem schnell, nachhaltig und enorm preisgünstig.“ Das sagte uns beim Gastspiel von DER MEISTER UND MARGARITA in Moskau einer, der es wissen muss, und illustrierte es mit haarsträubenden Fallbeispielen. Hier fließen die sowjetischen Strategien Amerikas und die amerikanischen Strategien der ehemaligen Sowjetunion ineinander und legitimieren sich gegenseitig. „Wir müssen sie umbringen, bevor sie uns umbringen“, verlautbart der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen im Irak. Höchste Autoritäten machen uns klar: Die einzige Alternative zur Barbarei ist die Barbarei. Das gilt nicht nur im Irak, das gilt auch in der Nachbarschaft. Der Frieden ist nur durch hartes Durchgreifen herzustellen. George W. Bush weiß: Die Revolution der Weltordnung ist durch nichts aufzuhalten. „Wir kämpfen bis zum totalen Sieg“ – und dann „scheint die Sonn’ ohn’ Unterlaß.“ Als Boris Groys vor zwei Jahren in der Volksbühne sagte, die Sieger neigten dazu, die Eigenschaften und Überzeugungen der Besiegten zu übernehmen, und dies gelte auch für den Westen nach der ‚Wende‘, waren wir uns der Tragweite dieses Gedankens nicht bewusst. Jetzt ahnen wir sie.
2.
Auch im ‚alten‘ Europa erodiert das angesichts struktureller Arbeitslosigkeit und terroristischer Bedrohung dysfunktionale System demokratischer Freiheit und rechtsstaatlicher Kontrolle, wie man nicht nur in Berlusconis Italien sehen kann. Trotzdem ergibt sich hier eine scheinbar privilegierte Perspektive, die es uns ermöglicht, wie von außen in die Abgründe zu blicken. Der Schwindel, den das hervorruft, ist nicht ohne Reiz. Zwischen moralischer Selbstgewissheit und dekadentem Schauder genießen wir das Gefühl, Zeugen zu sein eines großen ungeheuerlichen ‚Theaterstücks‘, in dem wir als Zuschauer immer in der Gefahr sind, uns plötzlich selbst auf der Bühne wieder zu finden, wo es plötzlich von einer Sekunde auf die andere nur noch um unser ‚nacktes Leben‘ gehen könnte. Und diesen Eindruck zu erzeugen, war zu Zeiten der Aufklärung tatsächlich die höchste Aufgabe der Kunst, speziell des Theaters, wie man schon in Denis Diderots 1758 erschienener Abhandlung ÜBER DIE DRAMATISCHE DICHTKUNST nachlesen kann:
Der wahre Beifall, nach dem ihr streben müßt, ist nicht das Klatschen der Hände, das sich plötzlich nach einer schimmernden Zeile hören läßt, sondern der tiefe Seufzer, der nach dem Zwange eines langen Stillschweigens aus der Seele dringt und diese erleichtert. Ja, es gibt noch einen heftigeren Eindruck, den sich aber nur die vorstellen können, die für ihre Kunst geboren sind und es vorauswissen, wie weit ihre Zauberei gehen kann: diesen nämlich, das Volk in einen Stand der Unbehaglichkeit zu setzen, so daß Ungewißheit, Bekümmernis, Verwirrung in allen Gemütern herrschen und euere Zuschauer den Unglücklichen gleichen, die in einem Erdbeben die Mauern ihrer Häuser wanken sehen und die Erde ihnen einen festen Tritt verweigern fühlen.
Eine interessante Theaterauffassung, die das eher neurologische Phänomen des Wankschwindels in einen ästhetischen Kontext stellt. Heute, zumal nach den Ereignissen des 11. September 2001, erscheint eine solche Auffassung von den geschichtlichen Ereignissen überrollt und obsolet zu sein, weil wir ja immer live dabei sind, wenn irgendwo in der Welt die Erde bebt und Mauern einstürzen.
3.
Theodor W. Adorno, der ausgerechnet am 11. September Geburtstag hat und, wie mittlerweile jeder weiß, dieses Jahr seinen Hundertsten gefeiert hätte, gehört zu denen, die einige Zeit nach Diderot die Aufklärung selbst zum Thema der Aufklärung gemacht haben und damit noch eine andere Art von Schwindel einbrachten. Sein negativ dialektisches Vorgehen, das auf schlussendliche Identität und eine positive Synthese verzichtet und statt dessen immer wieder Unruhe, Unversöhntheiten und Brüche reflektiert und generiert, „provoziert, wo nicht den Einwand des Bodenlosen, der an seinen faschistischen Früchten zu erkennen ist, den des Schwindelerregenden.“ Dieser Schwindel unterscheidet sich vom Diderotschen Wankschwindel. Die unabgeschlossene Reflexion geht, so Adorno, „dem verdinglichten Bewußtsein wie ein Mühlrad im Kopf herum“. Zum Wankschwindel kommt der Drehschwindel. Das scheint faschismusanfällig zu machen und den Ruf nach festen Orientierungen, Autorität und Regression zu provozieren. Wenn solche Sehnsüchte angesichts der Weltlage und des Standes der Zivilisation nur als scheiternder Totalitarismus eine immer nur scheinbare Erfüllung finden, hilft gegen die Konsequenz der Selbstzerstörung anscheinend nur die Kultivierung einer gewissen Lust am Schwindel, die ihn zu etwas Erträglichem umdeutet, und die Entwicklung von Ambiguitätstoleranz (d. i. die Fähigkeit, unstrukturierte Situationen zu ertragen), die uns ermöglicht, mit der Bodenlosigkeit ohne Kurzschluss umzugehen. Nicht nur von Philosophen wie Adorno, die in der Eiswüste der Abstraktion das Glück ins allgemeine Unglück reichen lassen, indem sie das Unglück formulieren und sich der Dichtung nähern, auch von Zirkusartisten, Seeleuten und Krankenschwestern kann man da vielleicht lernen. Von Künstlern und Theaterleuten, die schon immer auf wackligem Boden stehen, vielleicht auch.
(In: Berliner Zeitung vom 11.09.2003. Siehe auch Kapitalismus und Regression „Das Schwindelerregende“, Berlin 2003.)
Von Carl Hegemann
top
I.
Vielleicht haben Sie um die Jahrtausendwende den Film Matrix gesehen, diese Cyberspace-Geschichte, in der sich die ganze Welt in ein digitales „Theater“ verwandelt, in dem das wirkliche Leben vollständig oder nahezu vollständig durch eine elektronisch erzeugte Scheinwelt ersetzt ist. Dieser Film aus dem Jahre 1999, zu dem es später noch zwei weniger erfolgreiche Fortsetzungen gab, wurde damals wegen seiner spektakulären Actionszenen, aber auch wegen der philosophischen, theologischen und technologischen Fragen, die er aufwarf als außergewöhnlichen Ereignis wahrgenommen. In diesem Film (Slogan: „Glaube das Unglaubliche“) gibt es ein vergammeltes Hotel, in dem sich offenbar die Schnittstelle zur Matrix befindet: der Durchgang von der vermeintlich „wahren“ Welt in das virtuelle Matrix-Universum, die digital erzeugte künstliche Welt. Dieses Hotel hat eine beschädigte Neonschrift an der Außenseite, von der nur noch drei Buchstaben leuchten, die das englische Wort „ART“ ergeben. Wenn man ganz genau hinsieht, kann man auch den dunklen Rest der Schrift entziffern. Es ist der Name des Hotels: „HeART of the city“. Herz der Stadt. Ich weiß nicht, ob das nur ein Zufall ist oder ob die Brüder Wachowski, die diesen Film gedreht haben, sich etwas dabei gedacht haben. Zuzutrauen wäre es ihnen, denn ihr Film ist auch wenn er das Genre Actionfilm auf massenkompatible Weise bedient, nicht dumm. Was könnten sich die Brüder gedacht haben? Vielleicht das folgende? Oder ist das eine typische Theaterdramaturgen-Projektion? Die Kunst als Herz der Stadt oder im Herzen der Stadt wird mit diesem kryptischen aber doch deutlichen Hinweis ein bedeutender Platz zugewiesen. „Art“ scheint in „Matrix“ an der Schnittstelle zu einem Raum generiert zu werden, den man als digitales Theater der Zukunft bezeichnen könnte. Die virtuelle Realität wird angesprochen wie eine Theaterrealität, nur dass sie mit Mitteln modernster Technik alle material- und schwerkraftbedingten Beschränkungen des Theaters hinter sich lässt – und eine Welt hervorbringt, in der, wie der in dem Film als möglicherweise kommender „Erlöser“ eingeführte Computerprogrammierer Neo, behauptet „alles möglich ist“: eine Welt ohne Schwerkraft, ohne Kontrollen, ohne Grenzen, jenseits aller Naturgesetze. Die Verwendung der digitalen Matrix als Hypertheater, in dem unsere Phantasie sich ohne Beschränkungen durch die träge Materie und ohne den Widerstand des Materials nahezu ungehemmt entfalten kann. Man wird kaum behaupten können, eine Technologie, die so etwas verspricht (und heute nicht mehr nur Science Fiction ist), sei für die künstlerische Phantasie eines Theatermachers ohne Reiz. Der Gedanke auf Menschen und Material zu verzichten und die Ideen und Phantasien, die man im Kopf hat, per Klick unmittelbar in den dreidimensionalen Cyberspace zu übertragen, ist durchaus faszinierend. Manchmal, wenn man sich auf der Probe quält und nichts richtig funktioniert, wünscht man sich so einen Computersklaven, der, gut programmiert, jeden Gedanken des Regisseurs (oder gar des Dramaturgen) genauso auf der Bühne umsetzt, wie er ihn haben will, ohne störende Nebeneffekte und nörgelnde Schauspieler. Die neue Technologie eröffnet hier anscheinend Möglichkeiten von der Art, wie sie Immanuel Kant vor 220 Jahren als „intellektuelle Anschauung“ oder „anschauenden Verstand“ gedacht hat; „ein Verstand durch dessen Vorstellung zugleich die Objekte dieser Vorstellung existieren“ (KdrV), also die Fähigkeit, Gedanken ohne dazwischen geschaltete Arbeit unmittelbar gegenständlich werden zu lassen. Für Kant war diese Form des Realität setzenden Gedankens „ausschließlich der Gottheit als Urwesen“ vorbehalten. Für den Menschen schien sie ihm „gänzlich unmöglich“, weil sie die notwenigen Bedingungen von Erfahrung zerstören würde, zu denen es gehört, dass die Formen der Anschauung und die Begriffe des Verstandes unterschiedliche Wurzeln haben. Eine Technologie, die die beiden Erfahrungsstränge identisch machen könnte, hielt er ebenfalls für völlig unvorstellbar. Das Unglaubliche und wirkliche Neue gegenüber Kants Zeiten besteht darin, dass es heute eine Technologie gibt, die so etwas wie „intellektuelle Anschauung“ als machbar erscheinen lässt, die es Menschen zu ermöglichen scheint, wie Götter zu handeln. Es ist kein Wunder, dass es Menschen gibt, die annehmen, dass diese Technologie das buchstäbliche Traummedium für Künstler und Dichter sein müsste. Der Traum von der völligen Autonomie der Kunst: der Zaubergarten, die blaue Blume. Die Erfüllung der Träume der Romantik: das Poetische – wie bei Novalis – als „das echt absolut Reelle“, die losgelassene Phantasie als dreidimensionale intersubjektiv erfahrbare Echtzeitsimulation! Wenn man sich vergegenwärtigt, wie Friedrich Schiller in seinem Werbepamphlet für „das Theater als moralische Anstalt“, mit dem er die Mannheimer Sponsoren für die Finanzierung eines stehenden Theaters und einer Mannheimer Dramaturgie gewinnen wollte mit dem Hinweis auf einen „allgemeinen und unwiderstehlichen Hang nach dem Neuen und Außerordentlichen“, beginnt, der „der Schaubühne ihre Entstehung gegeben“ habe, wäre er von dieser Technologie, wenn es sie damals schon gegeben hätte, wahrscheinlich hingerissen gewesen.
II.
Bevor wir aber jetzt das Theater endgültig durch den Cyberspace ersetzen und das dramaturgische Wissen des Theaters dort nutzbringend einsetzen und den Dramaturgen ungeahnte Arbeitsfelder eröffnen (wie es Brenda Laurel in ihrem Buch „computers as theatre“ tatsächlich vorschlägt), möchte ich noch einmal auf unser altmodisches Theater mit seinen Beschränktheiten zurückkommen. Der Erweiterung der menschlichen Vor- und Darstellungsmöglichkeiten durch diese neuen Medien steht nämlich, wie wir alle wissen, auch eine zunehmende Verarmung gegenüber, die man nicht unterschlagen sollte.
Eine Theateraufführung unterscheidet sich vom Film und den digitalen Techniken, dadurch dass sie nicht nur andere Realitäten generiert, sondern dass sie darüber hinaus auch ein Akt der Begegnung ist. Das Publikum geht von vorne in das Theater hinein, die Schauspieler von hinten. Im Theatersaal treffen sie sich, meist sind sie durch die Rampe getrennt, aber diese Rampe ist keine absolute Grenze. Die körperliche Anwesenheit (oder die leibliche Co-Präsenz, wie man gerne in der Theaterwissenschaft sagt) beider Gruppen ist die spezifische Voraussetzung für eine Aufführung im Theater. Das ist nicht ganz so trivial, wie es klingt. Denn in den konkurrierenden Medien im Film und in der digitalen „Matrix“-Welt ist es anders. Im Film sind nur die Zuschauer körperlich anwesend, die Schauspieler, deren Spiel auf der Leinwand uns zu Tränen rührt, sitzen während dies geschieht, ganz woanders z. B. in Hollywood am Pool. Und in der virtuellen Welt des Computers ist überhaupt niemand mehr körperlich anwesend, sie besteht ausschließlich aus durch elektronische Signale hervorgebrachten Zeichen und Räumen. Die Menschen, die diese digital erzeugten Räume animieren und wahrnehmen, sitzen isoliert an ihren Computerkonsolen, oder wie im Matrixfilm selbstvergessen mit dem Computer verkabelt in Behältern auf dem Meeresgrund. Hier ist jegliche „leibliche Co-Präsenz“ verschwunden.
Das ursprüngliche Theater unterscheidet sich strukturell von den neuen darstellenden Medien durch die unvermeidliche körperliche Anwesenheit der Beteiligten, dies hat es den so genannten neuen Medien voraus. Die dramaturgischen Strategien des gegenwärtigen Theaters sollten das ernst nehmen. Wenn das Theater auf der Guckkastenbühne nur versucht, den Film mit beschränkteren Mitteln zu imitieren, und die Tugend darin sieht, dass jede Aufführung einer Inszenierung der anderen bis ins letzte Detail gleicht, dass gespielt wird, als seien die Zuschauer gar nicht vorhanden, wenn man den Ehrgeiz darein legt, im Theater ein Kinosituation zu schaffen, die den Zuschauer nur auf das Gezeigte nicht aber die Zeigenden, nämlich die Schauspieler fixiert, kann man nicht mehr sagen, warum man nicht lieber ins Kino gehen soll. Das geht ja auch vielen Menschen so, sogar vielen Theaterschaffenden selber.
Das Theater, das sich als solches ernst nimmt, muss die „leibliche Co-Präsenz“ also nicht kaschieren sondern zum Mittelpunkt seiner Praxis machen, wenn es sich von den neuen darstellenden und herstellenden Medien unterscheiden will. Das haben mittlerweile viele Theaterleute eingesehen, weshalb sie zunehmend das große semiindustrielle Theater meiden und Nischen außerhalb der repräsentativ verhärteten Stadt- und Staatstheaterwelt, sei es nun innerhalb oder außerhalb der Institutionen, suchen.
Plötzlich steht nicht mehr die Bedeutungsanalyse dessen, was zwischen der dargestellten Figur und dem rezipierenden Zuschauer stattfindet, im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Begegnung des Schauspielers mit dem Zuschauer. Man interessiert sich für die körperlichen Vorgänge, für die Spiele der Schauspieler auf der Bühne, die das Publikum verunsichern und erheitern. Das Stück, das gespielt wird und dessen Personal werden marginal, zum bloßen Stoff für die Kreation ungewöhnlicher Begegnungen, aus denen, wie die Theaterwissenschaftlerin Fischer-Lichte postuliert, dann via „Emergenz“ etwas Neues in die Welt kommt. Und dieses Neue sei auch bei noch so genauer Inszenierungsarbeit nicht zu berechnen und vorauszusehen. Waren etwa noch bei Peter Stein die exakte Gleichheit, die Wiederholung und die möglichst perfekte Erzeugung einer Bühnenrealität, auf die sich der Zuschauer einlassen kann, das Ziel der Inszenierung, so ist im neuen Performance-Theater das Gegenteil der Fall: Es lebt von den überraschenden Aktionen der Schauspieler in einer grundsätzlich offenen Situation. Das Theater selbst in seiner Fragilität und Durchlässigkeit wird zum Erfahrungsgegenstand; das Stück, das gezeigt wird, tritt in den Hintergrund, wird zum bloßen Aufhänger von Theatercoups, mit denen die Schauspieler und eben nicht mehr primär die Figuren, die sie spielen, Spannung, Verunsicherung und Witz erzeugen. Sie kennen alle solche Inszenierungen, die man gewöhnlich mit dem Namen Regietheater verbindet. Obwohl es (auch angesichts meiner eigenen Theaterpraxis) nahe liegen würde, möchte ich mich einem solchen Theatermodell, dass nicht mehr die Beziehung des Zuschauers auf die Figur zum Hauptgegenstand hat, sondern die Beziehung des Schauspielers auf den Zuschauer, nicht anschließen. Denn hier wird möglicherweise das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und das Theater als solches unmöglich. Denn wir brauchen, um die Theatersituation aufrecht zu erhalten, auf der Bühne und im Zuschauerraum jeweils zwei konfligierende Identitäten. Auf der Bühne ist das klar: die Rolle oder die Figur und den Darsteller oder Akteur. Im Zuschauerraum ist diese Zweiteilung nicht ganz so klar, denn da sitzt einfach das Publikum, dass sich Darsteller und Figur gleichermaßen anschaut. Und so scheint es gleichgültig zu sein, ob es sich mehr den Figuren des Stückes zuneigt oder dem Schauspieler der die Figur spielt. Das aber ist ein schwerer Irrtum, dem viele Theatermacher und Theaterwissenschaftler anheim fallen. Denn auch im Publikum, bei jedem im Zuschauerraum Anwesenden, gibt es eine Spaltung, die der Zweiteilung in Figur und Darsteller auf der Bühne entspricht. Dies wird in den Theaterwissenschaften, soweit ich sehe, bis heute übersehen und auch im Theater nicht wirklich reflektiert. Der amerikanische Soziologe Erving Goffman hat hingegen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in seinem Buch „Frameanalysis“, in dessen Zentrum die Analyse des Theaterrahmens steht, diese Seite bereits mit Nachdruck betont. Er unterscheidet dort zwischen „Theaterbesucher“ und „Zuschauer“. Der Theaterbesucher entspricht auf der Seite des Publikums dem Schauspieler auf der Seite der Bühne, er ist derjenige, der die Karten kauft, seinen Mantel an der Garderobe abgibt, der feststellt, dass es im Theater kalt ist (obwohl das Stück im Sommer spielt), der gelangweilt während der Vorstellung im Programmheft liest, der sich Sorgen macht, wenn eine Figur auf der Bühne fällt, dass sich der Schauspieler verletzt haben könnte, der über den Schauspieler lacht, der einen Hänger hat, er ist es auch, der nach dem der Vorhang gefallen ist, die Darsteller beklatscht und der bei Feueralarm das Theater räumen muss. Sein Pendant auf der Bühne ist der Schauspieler, der auf der Bühne den gleichen Namen hat wie außerhalb des Theaters, der seinen Hänger überspielen muss, der sich auf der Bühne echt verletzen kann und der den Theaterbesucher, in dem er aus seiner Rolle fällt oder eine systematische Unsicherheit darüber erzeugt, was zur Aufführung, zum Stück gehört und was nicht, zutiefst verunsichern kann. Das Pendant zur Rolle, zur Figur, ist dann der Zuschauer im engeren Sinn, der sich, wenn die Vorstellung beginnt, einstellt auf das, was die Figuren zu sagen haben, der über die Figuren im Stück (und nicht über deren Darsteller) lacht oder weint, weil ihm die Handlung nahe geht, der nicht auf die Uhr guckt sondern in der Verabredung, dass das Theater ihn in eine andere Welt entführt, genauso aufgeht, wie der Schauspieler in seiner Rolle, wenn er sie ernst nimmt und das Spiel gelingt.
War es in den letzten 200 Jahren diese Beziehung, die für das Gelingen des Theaters entscheidend schien: eine Vorstellung galt als umso besser, je reiner sie die emphatische Verbindung zwischen Zuschauer und den Figuren des dargebotenen Werks herstellen konnte, so sind wir jetzt offenbar zur Abwechslung mal auf der andern Seite angekommen. Die leibliche Co-Präsenz zwischen Theaterbesucher und Schauspieler soll das Theatererlebnis prägen, nicht die geistige zwischen Zuschauer und Figur. Nicht mehr realistisches Spiel ist gefragt, sondern die Realität in der sich der Theaterbesucher Herr Meier und der Schauspieler Herr Bierbichler gleichermaßen befinden und dies in einer Ausschließlichkeit, die sich Bert Brecht wahrscheinlich nie hat träumen lassen. Dieses simple aber offenbar nicht triviale, formal vollständige Theatermodell lässt sich zur Fehleranalyse alter und neuer Entwicklungen im Theater verwenden. Das alte Modell, das sich nur auf das Verhältnis von Zuschauer und Figur beschränkt, auf die Semiotik des Theaters, ist, wenn man es ernst nimmt, seitdem es Kino gibt, nicht mehr signifikant. Es unterscheidet sich strukturell nicht von einer Filmvorführung, die aber mit ihren technischen Mitteln ein unvergleichliches Mehr an Information und Illusion vermitteln kann, weshalb selbst Theatermenschen häufig lieber ins Kino gehen. Diese Art von Theater wird vielleicht wirklich schon bald vom Film verdrängt werden, wenn dies nicht schon längst geschehen ist. Aber auch das andere Modell, dass die körperliche Anwesenheit der Theaterbesucher und der Schauspieler zum Angelpunkt macht, gefährdet in meinen Augen das Theater, denn wenn dort nur noch Theaterbesucher mit Akteuren konfrontiert werden, wenn es statt Vorführungen Durchführungen gibt, einfache performative Akte, wird das Theater inhaltslos leer, so wie es als reines kinoähnliches Illusionstheater blind wird für seine eigenen spezifischen Voraussetzungen.
Wir können das Modell des Theaters in seiner simplen Grundstruktur letztlich nicht auflösen, ohne das Theater abzuschaffen. Wie der Soziologe Dirk Becker sagte, handelt es sich beim Theater um eine „Einmalerfindung“, d. h. an seinen wenigen Grundelementen lassen sich keine Änderungen vornehmen, ohne es zu zerstören, Experimente bestätigen reflexiv seine Grundstruktur und sind selbst von ihr abhängig. An diesem Punkt kommen wir über Lessing nicht hinaus: wir können die Gesetze des Theaters nur verletzen, indem wir sie gleichzeitig bestätigen, wir müssen beide Relationen, die zwischen Zuschauer und Figur und die zwischen Theaterbesucher und Schauspieler, zugrunde legen und können auf Dauer weder die eine noch die andere eliminieren, denn sie hängen wechselseitig voneinander ab. Das Theater charakterisiert sich in seiner Grundverfassung durch dieses vierteilige Modell. Das Kino macht daraus ein dreiteiliges (weil die körperliche Präsenz des Schauspielers wegfällt) und in der Matrix-Realität, den virtuellen Welten, reduziert sich alles gleichermaßen auf die elektronisch generierten Figuren, hier fällt auch die körperliche Anwesenheit des Besuchers weg, denn der sitzt ganz woanders und in der Regel allein vor seiner Spielkonsole, oder wie im Matrixfilm in einem Behälter. Alles was in diesem Übertheater geschieht, findet unterschiedslos auf der virtuellen Bühne statt, ohne jede leibliche Co-Präsenz von Akteuren und Publikum.
Wenn wir auf dieses vierteilige Modell verzichten könnten, wäre allerdings die virtuelle Realität das Theater der Zukunft, denn in ihm ist jene Zauberei möglich, von der die Theatermacher immer träumten. Aber wir können offenbar nicht darauf verzichten.
Erstaunlich ist, dass dies nicht nur Theatermacher reflektieren, sondern auch die astralen Gestalten in der „Matrix“. Das macht diesen Film für mich paradigmatisch. Neo, siehe oben, der die digitale Welt als Erlösungsmedium begreifen will und nicht wie die Programmierer dieser Matrix als Ebenbild unserer begrenzten und fremdbestimmten Lebensform, wird von einem Agenten der Matrix mit einem uralten Argument konfrontiert, das die mögliche Befreiung oder Erlösung im grenzenlosen Übertheater in Frage stellt. Er erklärt seinem naiven „Virtual Reality“-Propheten, dass es nicht etwa an der falschen Programmiersprache liegt, dass die Welt der Matrix genauso schlimm und blöd aussieht, wie die gewöhnliche Welt, sondern daran, „dass die Spezies Mensch ihre Wirklichkeit durch das Leiden definiert.“ Absolute Freiheit, Perfektion und Widerstandslosigkeit gibt es nur im Traum und im Spiel. Wie wir oben von Kant gehört haben: für Menschen ist die reine vollständige Freiheit bei der Schaffung von Realität keine mögliche Option.
III.
Und damit stürzen wir von der großen Befreiung wieder zurück. Sozusagen im freien Fall, der nur gebremst wird durch die Unvermeidlichkeit der Tragödie, so wie es schon vor 2500 Jahren von den ersten Tragödiendichtern gestaltet wurde. Das Leiden und das Elend ist im selben Maße Voraussetzung unseres Daseins wie der Wille dieses Leiden zu überwinden oder das Bedürfnis uns aus dem Elend zu erlösen. Wie im Theater lässt sich auch im Leben der Traum nicht zugunsten der Realität und die Realität nicht zugunsten des Traums beseitigen, selbst dann nicht, wenn so etwas technisch machbar wäre. Auf dem Höhepunkt der abendländischen Philosophie hat Friedrich Hölderlin, diese unvermeidliche Dichotomie der menschlichen Existenz auf eine Weise präzisiert, die in der Lage sein könnte, die Defizite der Matrixfilme, die Bedingungen eines genuinen Theatermodells und die Unvermeidlichkeit der Tragödie gleichermaßen zu erhellen. Die kleine Passage aus der metrischen Fassung des „Hyperion“ gehört zu meinen Lieblingstexten, für mich wird hier poetisch entfaltet, was Schiller in seinem berühmten Aufsatz nur andeutet: was es heißt „ein Mensch zu sein“.
„Am Tage, da die schöne Welt für uns begann,
begann für uns die Dürftigkeit (das Leiden)
des Lebens und wir tauschten das Bewußtsein
für unsere Reinigkeit und Freiheit ein. (reine Freiheit ist immer bewusstlos)–
Der reine leidensfreie Geist befaßt
sich mit dem Stoffe nicht, ist aber auch
sich keines Dings und seiner nicht bewußt.
Für ihn ist keine Welt, denn außer ihm
ist nichts. - Doch, was ich sag', ist nur Gedanke. (philosophische Spekulation)–
Nun fülen wir die Schranken unsers Wesens
und die gehemmte Kraft sträubt ungeduldig
sich gegen ihre Fesseln, und es sehnt der Geist
zum ungetrübten Aether sich zurük. (zum „Ozeanischen“, Zustand vor der Geburt – Todesehnsucht?)
Doch ist in uns auch wieder etwas, das
die Fesseln gern behält, denn würd in uns
das Göttliche von keinem Widerstande (die reine Freiheit: intellektuelle Anschauung vs. Daseinsqual)
beschränkt - wir fülten uns und andre nicht.
Sich aber nicht zu fülen, ist der Tod,
von nichts zu wissen, und vernichtet seyn
ist Eins für uns. - Wie sollten wir den Trieb
unendlich fortzuschreiten, uns zu läutern,
uns zu veredlen, zu befrein, verläugnen?
Das wäre thierisch, Doch wir sollten auch
des Triebs, beschränkt zu werden, zu empfangen,
nicht stolz uns überheben, denn es wäre
nicht menschlich, und wir tödteten uns selbst.
Den Widerstreit der Triebe, deren keiner
entbehrlich ist, vereinigt die Liebe (punktuell).“
Dieser Text aus dem Jahr 1795 zeigt vielleicht exemplarisch, warum die Tragödie nicht tot zu kriegen ist. „Wir durchlaufen alle eine exzentrischen Bahn und es ist kein anderer Weg möglich von der Kindheit zur Vollendung“, sagt Hölderlin an anderer Stelle (vorletzte Fassung des „Hyperion“), „Oft ist uns, als wäre die Welt alles und wir Nichts, oft aber auch als wären wir alles und die Welt Nichts.“
Wenn wir uns ausschließlich auf eine der beiden Seiten schlagen könnten, hätten wir sofort völligen Frieden, wären leidensfrei, nicht mehr zerrissen mit der Natur sondern eins mit der Natur (oder wie immer man die von uns nicht selbst bestimmten Kräfte bezeichnen will), allerdings nicht mehr in der Lage, diese Erfahrung der Einheit auch als solche selber zu erfahren, denn wir wären unter der Erde. Wie Kleist später seinen Prinz von Homburg sagen läßt: „Nur schade, dass das Auge modert, dass die Herrlichkeit erblicken soll.“ Nur im Konflikt, nicht in der Harmonie sind wir erfahrungsfähig, das gilt in der Matrix wie im Theater und im Leben überhaupt. Man kann es auch mit Neil Young sagen: “The same things that make you live can kill you.”
Das ist die tragische Erfahrung, dass nur im Tod Erlösung ist, wir aber dann von dieser Erlösung nichts mehr haben, weshalb wir das unerlöste Leben vorziehen, das „die Fesseln gern behält“ und mit einer („Matrix“-) Welt, in der restlos alles möglich ist, nichts zu tun haben wollen. Was wiederum nicht heißt, dass wir nicht alles tun, um die Fesseln abzustreifen und die Hemmnisse zu beseitigen und genau diese Welt anstreben, in der alles möglich ist. Auch wenn wir wissen oder ahnen, dass uns dies bei Strafe des Untergangs nie völlig gelingen wird und darf. Das Theater ist das Modell für diese konstitutive Spannung zwischen Determination und Freiheit, zwischen Allmacht und Ohnmacht. Es hält uns lebendig indem es zeigt, was uns umbringt.
SCHLUSS
Was wollte ich mit diesem Sprung aus den Verstiegenheiten der virtuellen Realität in die Abstraktionen der philosophischen Spekulation? Wahrscheinlich wollte ich darauf hinweisen, dass es für die Dramaturgie des gegenwärtigen Theaters nicht reicht, die vom Markt verlangten Sekundärtugenden zu beherrschen, wie sie etwa in der Fachzeitschrift „Dramaturg“ (herausgegeben von der dramaturgischen Gesellschaft, deren Mitglied ich bin) aufgelistet wurden. Da liest man auf mehreren Seiten über den Dramaturgen als „Produzent, Organisator, Projektmanager, Geldbeschaffer, Kommunikationstalent, Marketingstrategen“ und so weiter. Richtig, auch das Theater befindet sich auf dem Markt, genauer: es produziert im Markt aber nicht für den Markt, und es muss sich auf diesem Gebiet profilieren, aber es muss auch etwas haben, das es anbieten kann, denn alle Marketingstrategien laufen ins Leere, wenn das Produkt nicht zündet. Und bei der Produktverbesserung kann zum Beispiel Hölderlin helfen. Mit einer universalistischen Theorie, die ohne Zwang funktioniert und nicht imperialistisch ist, kann man Kriterien für das Theater entwickeln, die für das Theater spezifisch und nicht beliebig sind. Und nebenbei etwas über das tragische Paradox erfahren, das uns am Leben hält, indem es uns tötet.
Wenn die möglichen Gegenstände und Themen des Theaters grundsätzlich deckungsgleich sind mit den Gegenständen und Themen der Gesellschaft, in der es sich befindet, braucht es Kriterien für die Auswahl und Bearbeitung dieser Gegenstände. Das ist eine, wenn nicht die zentrale Aufgabe der Dramaturgie. Es müssen spezifische Kriterien sein, die das Spezifische der Gegenwart und des Theaters einfangen. Und sogar da kann man von Hölderlin lernen, denn er steht am Beginn der modernen Tragödie. Wenn er schreibt bei uns sei es das Tragische, dass wir „ganz still in irgendeinen Behälter eingepackt von Reiche der Lebendigen hinweggehen“ und dies sei eben nicht das gleiche wie die Tragik bei den alten Griechen, die „in Flammen verzehrt, die Flammen büssen, die sie nicht zu bändigen vermochten.“ Dann können wir das sowohl auf unsere vom alten Griechenland abweichenden Begräbnisarten beziehen, wie auch auf unser gepanzertes Leben in Behältern, seien das nun Container oder Autos, Hotelzimmer oder Computerterminals. Der seltsame Gedanke aus dem Matrixfilm, dass die Menschen als bewegungsunfähige Larven in Behältern vegetieren, illustriert unser modernes Leben der verschwindenden leiblichen Co-Präsenz ganz gut.
Um zum Anfang dieser Überlegungen zurückzukommen: Kunst als Herz der Stadt. Es ist sicher ein vermessener Anspruch, die Kunstform Theater wieder zum schlagenden Herz der Stadt machen zu wollen, was sie vielleicht nie war. Aber zumindest auf symbolische Weise kann man das Desiderat der Matrix-Künstler ernst nehmen. Das Theater als Ort der Begegnung kann darauf hinweisen, dass die Bewohner der Stadt, „in irgendwelche Behälter eingepackt“, sich in der Tendenz nicht mehr aufeinander beziehen, außer anonym über den Markt, und dass dies ein Defizit, eine Gefährdung ist. Zur Schärfung dieser Einsicht sollte diese kleine Denkanstrengung beitragen.
Carl Hegemann
(Manuskript eines Vortrags über die Dramaturgie der Volksbühne von Carl Hegemann. Leipzig, Juli 2005.)
top
Im Grunde waren die überflüssigen Menschen implizit immer ein Thema der Volksbühne; sie gehören sozusagen zu ihrem Gründungsmythos: Die wütenden Menschen, die sich ihre Überflüssigkeit nicht einreden lassen wollen. Auf der Bühne und im Diskurs hat man sich mit den Ausgrenzungen und den Hoheitsrechten, die die reichen Gesellschaften bilden, um einen Teil der Bevölkerung nicht mehr zu beteiligen, schon immer beschäftigt. Frank Castorf hat in all seinen Inszenierungen deklassierte Menschen beschrieben, boshafte Exzentriker und kriminelle Praktiker. Er hat jedes Thema und jede Personage parterre geholt. Die Menschen in Christoph Marthalers Arbeiten sind von Murx angefangen grundsätzlich überflüssige, am Rand stehende, nicht integrierte. René Pollesch reflektiert in seinem Theater, was in den kulturellen Rollenschemata, den Geschlechts- und Gefühlszuweisungen auf der Bühne und in der Gesellschaft repräsentiert werden darf - und was nicht. Christoph Schlingensief hat von seinen ersten Theateraktionen an jene Menschen auf die Bühne geholt, die (selbst von den Sozialarbeitern) nicht mehr wahrgenommen werden sollen. Er produziert auf diese Weise Widersprüche, die jeden in Konflikt bringen, weil es für diese Menschen keinen Platz und keinen Ausdrucksraum gibt: die Behinderten, die abgeschobenen Ausländer, die Neonazis, die ALS-Kranken. Die Kompanie von Meg Stuart, die seit einem Jahr an der Volksbühne arbeitet, heißt „Damaged Goods“ und die Menschen ihrer choreographischen Inszenierungen sind immer verstörte, beschädigte, nirgends hingehörende Personen. Dimiter Gotscheff hat die Bezeichnung „überflüssige Menschen“ im Zusammenhang mit seiner Arbeit an Tschechows Iwanow aufgebracht. Die Volksbühne beherbergte ein Obdachlosentheater, die Eintrittspreise sind nicht mehr so legendär niedrig wie in den ersten Jahren, aber immer noch sehr durchlässig. Die Ästhetik des Hauses, auf der Bühne, in der Grafik, alle optischen Zeichen und Signale sind subkulturell, bohème, grassrouts, Subversion. Sie war auch ein Zeichen von Widerstand gegen koloniale Enteignung.
Jetzt scheint der große Frieden ausgebrochen, das Einverstanden sein mit allem, weil der Markt uns alle gleich macht und wir alle dem gleichen Zahlendiskurs gehorchen. Wir wissen nicht womit wir einverstanden sind, aber wir sind einverstanden. Bei den großen Parties des Einverständnisses - wie sie im WM-Sommer immer wieder zu besichtigen waren - ging es ausschließlich darum, dabei zu sein. Warum ist Kritik nicht mehr zeitgemäß? Weil keiner seinen Platz beim Dabeisein verlieren will. Die Zahl der Menschen, die in Slums wohnen, wächst jedes Jahr weltweit. Das ist die eine reale Bedrohung. Uns fällt kein Ort ein, der außerhalb der uns überflüssig machenden Logik läge. Deshalb beschreiben wir innerhalb des Dabeiseins. Das ist die andere diffuse Bedrohung.
In anderen Sozialitäten ist oder war das Überflüssige eine luxurierende Existenz der schönen Verschwendung: Die Interpretation der bürgerlichen Ökonomie reduzierte den Menschen auf die praktisch notwendigen Eigenschaften. Allerdings wurde in dieser Interpretation immer auch ein Posten für das Notwendige am Überflüssigen eingerichtet: Das Überflüssige als Hoffnungsträger; das, was in der Verwertungslogik nicht vorkommt, wird ausgesperrt und geschützt. Dort sollen sich Energien der Erneuerung entfalten: Projekte, Entwürfe, Alternativen zum Menschen als Marktprodukt, Alternativen zum jeweiligen Realitätsprinzip, auch als lohnende Entdeckungen im Innenleben von Einzelnen und Kollektiven. In der konsequent praktizierten und absolut gesetzten Freien Marktwirtschaft ist alles überflüssig, wonach nicht nachgefragt wird, das, was auf dem Markt nicht mit Profit verkäuflich ist, womit man keinen Profit erzielen kann, was sich nicht rechnet. Die Unterscheidung von gesellschaftlichen Bedürfnissen und Profitbedürfnissen gibt es nicht mehr, und somit natürlich auch nicht die Konstruktionen von verwertbar und authentisch, oder Außen und Innen. Das Überflüssige muss man entsorgen. Wir sind derzeit mehr oder weniger weltweit davon überzeugt, dass der Darwinismus der Freien Marktwirtschaft das Vernünftigste ist, das Praktischste, weil sich Produktion und Nachfrage nach dem Gesetz der Arten-Entwicklung von selber regeln. Überflüssig ist das Unverkäufliche. Unverkäuflich ist, was keinen Profit macht. Ohne Profit kann das Kapital nicht neu investieren. Ohne neue Investition gibt es kein Wachstum. Dann eben kein Wachstum. Aber ohne Wachstum kein Kapital, und ohne neue Investitionen keine Arbeit, keine Beschäftigung. Diese angebliche Gesetzmäßigkeit wird als gegeben, nicht als Annahme oder Behauptung unterstellt wie ein Mythos oder wie die Grundlagen der Erkenntnis oder wie eine neue Glaubensregel. Es gibt zu diesem Schema der Freien Marktwirtschaft keine Alternative, wie man weiß, und ebenfalls als gegeben wird unterstellt, dass Freie Marktwirtschaft mit Demokratie gleichzusetzen ist. Spekulationen sind unverkäuflich. Unverkäufliches darf gar nicht erst vorkommen; es kann nur als Fehler wahrgenommen werden. Angeblich werden auf dem Markt durch Angebot und Nachfrage alle Bedürfnisse artikuliert und können alle Bedürfnisse befriedigt werden. Angeblich gibt es also gar keine bessere Kommunikationsform, um herauszubekommen, was wirklich gebraucht wird, als den globalisierten Kapitalismus und den freien Markt. Es hat sich ja auch gezeigt, dass andere Modelle wie soziale Marktwirtschaft oder verstaatlichte Wirtschaft gescheitert sind, und neue Entwürfe möchte man nicht machen; sie rechnen sich nicht; sie sind eine überflüssige Aktivität. Es gibt aber bekanntlich in diesem perfekten Regelwerk einen Fehler, ein ethisches und ein möglicherweise auch nicht lösbares ökonomisches Problem; gerade da, wo alles so gut ineinander greift in der Marktveranstaltung: Das Problem ist die Definition des Menschen. Bekanntlich ist die Ware Arbeitskraft zu einem großen Teil überflüssig, kann technologisch ersetzt werden, und mit ihr viele menschliche Eigenschaften. Andererseits entsteht der Profit nach Kapitalanalyse aus dem Anteil der lebendigen, also menschlichen Arbeit. Der Kapitalismus hat gelernt, dieses Problem aufzufangen durch Kriege und durch Einsatz von Billigarbeitskräften, durch Schaffung unterschiedlicher Märkte und Arbeitsmärkte, die sich dann rechnen. Ein Teil der Menschen wird also zu Sklaven gemacht, denen Grundversorgung zugestanden wird. Das könnte man bei anderem Zivilisationsstandards vielleicht sogar bis zur Vollbeschäftigung treiben. Aber schon da werden neue Definitionen von "Menschenwürde" nötig, die vielleicht mit dem Anspruch auf Demokratie nicht richtig zu vereinbaren sind. Das ist dann nicht mehr freie Marktwirtschaft. Mit einiger Mühe könnte man Legitimationen finden. Die Frage des Konsums scheint auch lösbar zu sein, wenn man einen Luxusmarkt und einen Billigmarkt mit immer wieder neuen, angeblich brauchbaren Angeboten etabliert. Bleibt das ethische Problem. Was passiert mit den Menschen, die in das Billiglohn- und Billigmarktsystem nicht passen, deren Arbeitskraft auf dem Markt nicht mehr verkäuflich ist? Einige humanitäre Verabredungen, die mit Demokratie verbunden sind – und der Kapitalismus beansprucht mit Demokratie gleichgesetzt zu werden – hindern uns an einer direkten Entsorgung der überflüssigen Menschen. Historisch hat bisher nur der Faschismus eine Legitimationsstrategie gefunden, die Überflüssigen abzuschaffen. Vielleicht gelingt es, heute und in Zukunft eine ähnliche Legitimation zu finden, die praktisch als Faschismus funktioniert, aber Demokratie und freie Marktwirtschaft genannt wird. Nennen wir es Fetischismus der Ökonomie und des Marktes. Der Marktfetischismus setzt sich absolut und bewertet alles ausschließlich nach Profitqualität oder besser gesagt Profitpopularität, auch Namen, Begriffe, Entwürfe, sogenannte Innovationen werden nach profitabler Markttauglichkeit bewertet. Bedürfnisse sind nur die Marktangebote, andere Bedürfnisse gibt es nicht. Erstaunlicherweise glauben wir das. Denn es gehört zur Freie Marktwirtschaft, dass sie nicht hinterfragt wird; sie ist ideologiefrei; sie ist politikfrei; sie ist wahr, weil sie ist; sie ist das Realitätsprinzip und – auch das wird als gesetzt angenommen – sie wird gleichgesetzt mit Kultur, mit Freiheit und mit Individualismus. Deshalb haben wir keine andere Wahl als Zustimmen. Der Kapitalismus funktioniert in der Absolutheit des Wahrheitsanspruchs zurzeit wie eine Religion, die auch von den überflüssig gewordenen Menschen, die gerade abgeschafft werden sollen, nicht in Frage gestellt wird. Denn wer in Frage stellt, gehört zum Realitätsprinzip nicht mehr dazu; es sei denn der Zweifel wird markttauglich, ein verkäufliches Produkt, dann ist er eingeschlossen; andernfalls nimmt der Zweifler nicht mehr teil und ist draußen. Bereiche des Denkens und Entscheidens werden ständig ausgelöscht durch die Zensur der Marktbehörde im Kopf. Sie wirkt wie eine unsichtbare Verseuchung, die als natürlich empfunden wird. Ungelöst bleibt trotzdem immer noch der Faktor Mensch. Man kann allerhand „Brave New World“-Szenarien ausdenken, um den Umbau des Menschen zu registrieren; die Abschaffung von kulturell erworbenen, teilweise auch genetisch gewordenen Eigenschaften, Gefühlen, Fähigkeiten, die unbrauchbar geworden sind. Die Menschen können Teile von sich selber abschaffen, sich in planmäßig und gleichmäßig gelaunte Wesen mit begrenztem Wissen, kalkulierter Emotionalität und langer Jugendlichkeit verwandeln; sie können ihre Produktfähigkeit für den Markt perfektionieren, und trotzdem sind sie zu einem Teil und Teile ihrer Biografie überflüssig geworden. Sie könnten auch bei Unbrauchbarkeit bei entsprechenden Angeboten ihrem freiwilligen Frühableben zustimmen. Sie müssen sich neu definieren. Der historische Faschismus hat für die Tötungslegitimation mit ethnischer Zugehörigkeit und mit Biologie argumentiert. Rassische und soziale Qualitäten wurden genetisch begründet und über die genetische Begründung wurde Exklusion betrieben. Die exkludierten Menschen fielen nicht mehr unter die Menschenrechte. Legitimationsstrategien, die Menschen unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Rechten begründen, die also, ohne Ausnahmezustände auszurufen, das Tötungsverbot teilweise aufheben können, sind heute vorstellbar. (Oder sind sie schon Praxis, und wir wollen es nicht wissen, weil wir zu denen gehören wollen, die ethisch noch erster Klasse behandelt werden müssen?) Ethnische Argumente als Unterscheidungsinstrument sind im globalisierten Kapitalismus unbrauchbar. Der Rekurs auf Natur und die Entwicklung der Arten ist Teil der Bildsprache der Ökonomie. Eine Unterteilung der Menschen in solche, die unter die Humanitätsverabredungen fallen, und solche, für die diese Verabredungen nicht gelten, wird biogenetisch getroffen werden. Sie wird ein Teil des Marktes sein. Sie wird nicht als Totalitarismus funktionieren. Mit einer solchen Unterscheidung wäre es möglich, einen Teil der Menschen oder Teile der nicht mehr brauchbaren Biografie von Menschen zu entsorgen. Man kann sich verschiedene Szenarien vorstellen: Zum Beispiel der überflüssige Teil der Menschen wird grundversorgt mit der Auflage, sich medizinisch zu pflegen und nach dem Ableben seine Organe oder andere Ersatzteile zur Verfügung zu stellen. Oder: die Menschen zweiter Klasse werden auf unterster Stufe am Leben gelassen, ohne Anspruch auf Irgendetwas; oder sie werden eben als "nicht mehr Menschen" definiert, für die das Tötungsverbot nicht gilt. Der Historismus des Marktes ist erstaunlich zynisch. Überall wird das Menschenbild beschworen, das er zerstört hat. Er macht uns alle zu Schauspielern unverwertbarer Eigenschaften, obwohl wir es im Grunde besser wissen. Man hat sich darüber verständigt, dass das Leben eine gute Story ist. Die Wirtschaft hat von der modernen Kunst gelernt. Sie verbündet sich mit unausgelebten Potentialen der Ur- und Frühgeschichte und verschafft sich so den Anschein der Seins-Wahrheit und des Unwiderstehlichen. Dagegen hilft nichts, nur die Position des Nichts, nicht des erlauchten Nichts, sondern des Niemand. Oder Krieg gegen alles, womit wir einverstanden sind. Vor allen Dingen große Skepsis gegenüber dem großen sozialen Frieden in unseren noch privilegierten Hegemonien. Wo sind die Potentiale von Häresie in der allgemeinen angeblich post-ideologischen, Fanclub-artigen Zustimmung zur angeblich alternativlosen entpolitisierten Ökonomie, die als Religion, als Glaube funktioniert? In einem Niemandsland der Zerstörungskräfte, wo die Kriegssimulationen zur Triebabfuhr nicht mehr reichen? Oder immer noch im imaginären Festhalten des Überflüssigen. Jeder sich anbietende gebrauchte oder nicht gebrauchte Menschenteil ist ein offenes Risiko: Der Psychopath, der Pyromane, der Pornograph. Andere Humanitätskategorien. Die Geschichte des Einzelnen muss nach ihrem offenkundigen Ende neu geschrieben werden, zunächst als Bestandsaufnahme der aus unserer Wahrnehmung ausgeschlossenen Schicksale, Gruppen, Klassen.
Stefanie Carp
Vorwort zu: „Das Überflüssige“. Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz & Alexander Verlag Berlin, 2006
Wenn man heute nach Berlin kommt, könnte man denken, dass es gar keine Theater mehr gibt. Auch die Graphiker sind verschwunden, Kunsthochschulen gibt es keine mehr. Viele Plakate zur derzeitigen DREIGROSCHENOPER waren zwar da, nur sie gaben sich nicht mehr als Theaterwerbung zu erkennen.
Als ich 1972 an die Berliner Volksbühne kam, war das anders. Die Theater waren durch ihre Plakate in der Stadt präsent. In den U- und S- Bahnen hingen sie verkleinert. Die einzelnen Häuser konkurrierten mit anspruchsvollen künstlerischen Signalen, die wahrgenommen wurden und zwar nicht nur als Werbung, sondern als Bestandteil kultureller Angebote und zur Schaffung von künstlerischer Identität. Es gab gewagte Aussagen, Provokationen, Skandale, Irritationen und individuelle Handschriften.
Bernd Frank gehörte dazu. Wenn ich mir heute sein BESTES PLAKAT von 1972 zu Othello vergegenwärtige, komme ich aus dem Staunen nicht heraus. Sein typographisch anarchisches Kreuzworträtsel kommt mir jetzt vor wie ein erstes Wetterleuchten einer neuen Epoche, als ein Vorläufer einer Entwicklung im Umgang mit Schrift, die zwar auch Wurzeln im Dadaismus hat, die aber inzwischen tausendfach wiederholt und in sinnentleerter Äußerlichkeit zu Tode geritten ist. Diese frühe grafische Fragmentarisierung hatte durchaus etwas mit der Inszenierung zu tun und für andere Inszenierungen bedurfte es anderer Mittel. Auch Bernd Frank hatte nicht die Freiheit, alles alleine zu erfinden. Es gab ein Kollektiv selbständig denkender und subjektiv empfindender Mitarbeiter, die die Inszenierung hervorbrachten, der öffentliche Auftritt außerhalb der Bühne gehörte dazu. In diesem Rahmen hat Bernd Frank einen eigenständigen Stil bewahrt und mit seiner reizvoll spröden und provokativ uneleganten Ausdrucksweise dem besonderen Gebiet Theater entsprochen, ganz besonders der Volksbühne, die damals schon eine brodelnde Kunststätte war, in der alles möglich sein konnte. Einen Höhepunkt einer solchen großartigen Zusammenarbeit stellt sein Plakat zu MACBETH HEINERMÜLLERNACHSHAKESPEARE dar, das 1982 eine geniale Inszenierung kongenial in die Öffentlichkeit trug.
Ich will Bernd Frank nicht noch mehr loben, aber ich werde nicht vergessen, dass ich ihm eine herbe Lehre verdanke, die mich immer noch amüsiert. Ich kam ja an die Volksbühne als Bühnenbildner. Es ist nicht unüblich, dass man da auch das Plakat entwirft und am Programmheft mitarbeitet. Der Hausgraphiker ist dann freundlicher Helfer und kümmert sich um die Drucklegung und sorgt sich um Korrekturen und Papierqualitäten. Vier Jahre später war ich einverstanden, den Graphiker der Volksbühne für eine Zeit zu vertreten, als er zur Armee musste. Schon freute ich mich auf dankbare Aufgaben. Ich wollte etwas besonders Schönes vollbringen, allerdings hatte ich nicht begriffen, dass ich von der Kaste, die alles besser weiß, gewechselt hatte zu der, die damit zurechtkommen muss. Ähnlich ist es, wenn man von der Regieseite auf die Bühne wechselt, da muss man auch begreifen, dass rechts links ist und links rechts. Nun ist es aber so, dass die Besserwissenden nicht alle alles auf die gleiche Weise besser wissen, sondern, und das ist das Schöne am Theater, (der Vergleich mit einem Irrenhaus trifft das durchaus), dass viele Meinungen gegensätzlich und doch auch wieder richtig sind. Der Graphiker nun muss ununterbrochen vergessen können, was er gerade gelernt hat, er darf es aber auch nicht so stark vergessen, dass er es nicht demnächst wieder hervorholen könnte. Und dann, woran hatte ich auch nicht gedacht: die Schaukästen, die großen Fahnen an der Theaterfassade, die Betteltouren bei unfreundlichen Druckereien, die überall lauernden Gefahren schlechten Papiers, fehlender Genehmigungen und verspäteter Korrekturen, die plötzlichen Änderungen von Terminen und Inhalten, die Einhaltung der Kontingente, die Fragen der Wirtschaftlichkeit, die Transporte, die Kongruenz mit der Besetzungspolitik, das heißt, die Feinfühligkeit, wenn ein gutes Foto, auf dem der Falsche drauf ist, ersetzt werden muss durch ein schlechtes vom Richtigen usw., usw., Doppelbesetzungen in alphabethischer Reihenfolge. So habe ich das besonders Schöne nicht vollbracht. Dagegen fing ich an, Bernd Frank vorbehaltlos zu bewundern und nun wusste ich, dass das Ungewöhnliche, das er oft genug hervorgebracht hatte und immer wieder schaffen würde, eine große Leistung ist.
Helmut Brade
Halle, November 2006
Bernd Frank, geb. 1942, war Grafiker an der Volksbühne von 1970 bis 2002
Es gibt keinen „Beginn“ in unserer Beziehung zu dem, was wir „Antike“ nennen. Alle Versuche des Theaters, sich den Gegenstand ästhetisch einzuverleiben, um ihn als „Herrschaft der Kunst“ politisch auszumünzen, scheitern wesentlich an zwei Umständen: erstens an der Frage der Übersetzbarkeit (d.i. der Lesbarkeit) der alten Texte und zweitens an der Tatsache, dass unser Denken durch das Griechische bedingt ist und wir es daher nie als Ganzes in den Blick kriegen können. Es bleibt der notwendig blinde Fleck in einem Verhältnis, das wir nicht souverän beherrschen, denn „nur die Griechen sind die einzigen, denen die Griechen nicht vorangegangen sind.“
Wenn es aber in unserem Verhältnis zum Antiken keinen Beginn gibt, dann gibt es auch keinen „Ursprung des Theaters“, aus dem sich die Geschichte oder das Erscheinungsbild dieser Kunstform arche teleologisch oder normativ ableiten ließe. Genauso wie der Slogan vom Griechenland als „Wiege der Demokratie“ mehr verstellt als eröffnet.
Ist der Begriff des Klassischen, schreibt Walter Benjamin, ist das Bild eines idealen Griechentums, das am Leitfaden von Humanität, Natur und absoluter Vollendung gewonnen wurde, dem „zerstückten Leben der Gegenwart“ noch vermittelbar? Ja, antwortet er, wenn er hilft, „das Gegenwärtige als ein historisch Entscheidendes zu begreifen“. Die Antike verwandelt sich für ihn in die antike Trümmerstätte, als die das Alte einzig noch Bild werden könne. Das Trümmerfeld aber – als Metapher für eine zerstückte Moderne im Bild des Alten – ist nicht nur Allegorie von Vergänglichkeit, sondern Zeichen des Zeichenhaften selbst. Und markiert den schwankenden Status jeglicher Lesbarkeit von Kunst.
Damit kippt vor allem die souveräne Position des Zuschauers – auch als politischer Bürger einer Demos. Mit der Souveränität aber steht der Begriff des Politischen und seine Herrschaftsformen selbst auf dem Spiel: Hinter den Erschütterungen der Theaterallegorien könnte eine ganz andere, „unsouveräne“ Politik sichtbar werden – eine wirkliche Polistragödie.
Das Tragische
„Brauchten die Athener die Tragödie?“, hat der Althistoriker Christian Meier gefragt: „Und brauchten sie sie vielleicht kaum weniger notwendig als die Volksversammlung und den Rat der Fünfhundert und all die anderen Institutionen ihrer Demokratie?“
Die Tragödie, antwortet er selbst, diene dazu, „das Neue immer wieder im Alten durchzuspielen, mit dem Alten zusammenzudenken – und damit zugleich alte Zweifel, die dunklen Aspekte der Wirklichkeit wach zu halten und in einer neuen Form in die neue Welt einzubringen. So wäre die Tragödie „Fortbildung des ethischen Grundes der Politik, Selbstvergewisserung der Polis und ihrer Bürgerschaft, Problematisierung und Bestätigung der Grundlagen des Lebens, Widerlager und Bedingung rationaler Politik, d.h. politische Tragödie in einem ganz umfassenden aristotelischen Sinn des Wortes: Polistragödie als fundamentale Institution der demokratischen Polis Athen, als Plattform einer höchst eigenartigen institutionalisierten ‚Diskussion’ der tieferen Probleme einer Bürgerschaft.“ (Bernd Seidensticker)
Dass die Tragödie politisch gebraucht wurde, weil sie verstörende Momente von Negativität aufruft, die sich nicht beruhigen ließen, wirft die Frage nach der Art des Gebrauchs auf. Gerade dass sie den Alltag durch ihre verdichtete Darstellung eines „fabelhaften“ Konfliktes von ungekannter Radikalität und Härte unterbricht, bringt ein Element von Sprachlosigkeit in den politischen Diskurs ein, der ihn überfordern muss. Die Polis als Agora setzt sich mit der Tragödie ihrer eigenen Suspension durchs Theater auseinander – ein Gedanke, von dem her die Radikalität der Antike zu denken wäre.
Die europäische Antike ist nichts, was man besitzt, vielmehr sind wir von ihr besessen in vielfachem Sinn. Und Besessenheit macht im besten Fall gleichzeitig blind und hellsichtig. Die von Bert Neumann entworfene Raumkonzeption als ein direkt an die Fassade der Volksbühne ansetzender antikisierender Theaterbau liefert die Kunst Unberechenbarem aus: dem Wetter und den Geräuschen des Platzes. Das Theaterspielen wird in einer Weise zur öffentlichen Angelegenheit, dass es sich mit der zentralen Versammlungsstätte Athens, der Agora, in Korrespondenz gesetzt sieht.
Sechs Wochen lang verleiht die Volksbühne dem Rosa-Luxemburg-Platz den stolzen Titel der Agora, um sich dort der Herausforderung von antiken Stoffen zu stellen: mit Inszenierungen, Lesungen, Filmen, Vorträgen und Diskussionen. Den Anfang machen Prometheus in der Übersetzung von Heiner Müller nach Aischylos in der Inszenierung von Dimiter Gotscheff und Vögel ohne Grenzen von Aristophanes in der Bearbeitung von Jérôme Savary. Tragödie und Komödie als zwei Formen der Befragung dessen, was für die Griechen Politik war: als die Frage der Übersetzbarkeit des Allgemeinen ins Individuelle, des Mythos’ ins Theater. Und das heißt auch als die Frage nach den Verlusten, die sich mit dem prometheischen Geschenk der Kultur als Schriftgedächtnis gleichursprünglich einstellen: Auch Mnemosýne als Mutter der Musen wäre immer zugleich blind und hellsichtig. Eine Erkenntnis, die unseren Vulgärbegriff der Demokratie auf die Füße stellt – einfach, indem sie ihn wieder griechischer macht.
Demokratie ist zunächst eine altgriechische Vokabel mit einer besonderen Verbindung zum politischen Systems Athens. Geprägt wurde die dahinter stehende Idee in der ersten Hälfte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts, d.h., sie existiert erst von einem bestimmten historischen Moment an. Demokratie gehört also keineswegs zur geistigen Grundausstattung des Menschen und ist daher erklärungsbedürftig: Das diskursive Moment - mit Hilfe der Reflexion die Ordnung der menschlichen Gesellschaft aus sich selbst zu begründen - ist wesentliche Voraussetzung dieser politischen Herrschaftsform (so wie die Griechen das Denken des Denkens erfunden haben). Demokratie ist nicht, sondern ereignet sich fortwährend wie das Denken des Gedachten - und zwar im Syntagma eines institutionalisierten Systems, das eine permanente Bedrohung für sein Ereignen darstellt. Daher kann es nur dessen Unterbrechung sein: demokratisch sein heißt, die Demokratie als System performativ aufzuheben.
Was heißt das für das Theater, das sich antiken Texten stellt? Ein Theater, das sich heute nie dem Verdacht entziehen kann, dass seine künstlerischen Subversionen in der Logik des ubiquitären Kapitalismus letztlich raffinierte Affirmationen sind?
Lyotard hat das neuzeitliche Theater unter Generalverdacht gestellt, uns mitten ins Politisch-Religiöse zu führen: die Praktik der Theater-Zeichen beruhe auf der Wirkung einer Repräsentationsmechanik, die Abwesendes durch Anwesendes gültig ersetze. Mit dieser semiotischen Theologie des Vorkapitalismus mache sich das Theater zur bürgerlichen Bastion ausgerechnet gegen den „Energieteufel Kapitalismus“, der unterschiedslos alle Codes zerstöre; denn dessen Wertgesetz stelle uns potentiell in eine nicht-hierarchisierte Zirkulation der Zeichen: sie werden reversibel. Erst ein solcherart entfesseltes, Zeichen entwendendes Denken entwertet diese und wirft sie als Falschgeld wieder auf den Markt: theatrale Blüten ohne Referenten, die in und aus der Logik des Systems das System unterminieren.
In einer radikalen Demokratie geht es um die nicht-geregelte Erfindung von Regeln in einem enthierarchisierten „Theater“, in dem der angeblich passive Zuschauer seine Herrschaft über dieses Theater verloren hat.
„Angeblicher Zuschauer“, weil der Begriff einer solchen Person einhergeht mit der Vorherrschaft der Repräsentation im
gesellschaftlichen Leben und besonders mit dem, was das moderne Abendland Politik nennt. Das Subjekt ist ein Produkt der theologisch-theatralen Repräsentationsmaschine, und es verschwindet mit ihr. Hier könnte sich die Prädramatik des altgriechischen Theaters mit der Postdramatik unserer Zeit berühren: in dem, was der antike Theaterdiskurs als die Undefinierbarkeit des Menschen aufscheinen lässt - als repräsentationsfreie Lücke im Moment der Szene.
Das Fehlen des Anspruchs aufs Herrschen, das ist die attische Demokratie - ein Ausnahmezustand. Politik in einem Zustand des staatlichen Dispositivs dagegen zu annullieren, dafür lautet der Vulgärname: Konsens. Im permanenten Ausnahmezustand, im performativen Sichereignen ist das griechische Denken der Demokratie von dem unseren, das im Wesentlichen der römischen Tradition verpflichtet ist, grundverschieden. Und so fremd uns das radikale politische Denken der Griechen geworden ist, so nah soll uns ein Theater sein, das ein wesentliches Moment davon war.
Theaterarbeit ist - zumindest für dieses Antikenprojekt - die Herstellung von Fremdheit als Moment von Demokratie.
Stefan Rosinski, Kurator der AGORA, April 2009
Das Magazin „Focus“ veröffentlicht diese Woche eine Rangliste deutscher Regisseure. Was zählt? Die Summe von Einladungsquoten zum Theatertreffen, die Teilnahmehäufigkeit bei Talkshows, die Zahl der Theaterpreise. Castorf, Bondy, Kriegenburg, Kimmig, Breth, Marthaler, Peymann, Kusej, Thalheimer, Stückl – das sind sie, die angeblichen zehn „Könige“. Statistik und Oberfläche als Kriterienkrebs, der sich in die Kunst hineinwuchert.
Es ist dies ein neuerlicher Beleg dafür, wie in der Ranking-Kultur jenes Bankenwesen kulminiert, das die Aufmerksamkeit als eine Währung handelt. Töricht! Als könne es in Kunstfragen eine Hitlisten-Praxis geben. Top und Flop sind die Pendel-Pole einer Denkweise, die lüstern auf das schaut, was als „Urteil“ unterm Strich erscheint – und schon ist man unter Niveau. Also auch bei Herrn Markwort vom „Focus“, der in jüngsten Auftritten im Fernsehen immer aussieht wie eine etwas hart gebratene Boulette beim aufweichenden Water-boarding.
Top und Flop, das mediale Analphabeten-Abitur. Sternchenvergabe bei Kinostarts oder Buchneuheiten zum Beispiel werden gern mit Informationshilfe für Leser legitimiert. Aber Kunst taugt nicht zur Tendenz, nicht zur Zensurenvergabe, nicht zur Alternative gut oder schlecht. Was der eine lobt, langweilt den anderen. Kürzlich schrieb uns jemand, Bewertungssternchen seien doch aber hilfreich, immerhin müsse doch eine gewisse Strecke bis zum nächsten Kino zurückgelegt werden, da wolle man schon ein Maß Sicherheit haben, ob sich der Weg lohne. Wer von der Kunstbewertung solche Garantien verlangt, ist schon der Banauserei in die Falle gegangen und weiß im Hinuntersturz in die Primitivität nichts mehr von der Erotik jenes Nullpunktes, an dem Gewissheit endet, aber Erwartung beginnt.
Regisseur FrankCastorf ist laut „Focus“ die Nummer 1 der Regisseure. Die redaktionelle „Jury“ – die doch nur dem Auftrag folgt, fürs Blatt-Image ins Gerede zu kommen; um ins Gespräch zu kommen, reichts wahrscheinlich nicht mit solcher Wertungs-Ziffernstammelei! –, diese Jury weiß wahrscheinlich gar nicht, wie recht sie justament mit dieser Wahl Castorfs hat. Schon allein deshalb möchte man sie in dessen trutzige, antimodisch tapfere, trashige, tiefmelancholische, tolltückische Volksbühne sperren und sie dort höllisch leiden sehen, durch den Wolf der ausgedehnten Zeit gedreht, fluchend, mehr auf die Uhr als auf die Bühne schauend, sich gequält langweilend. Strafe ist das Privileg des Königs.
Hans-Dieter Schütt (Neues Deutschland, 28. September 2011)
Die Mode hat die Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einst bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene. Walter Benjamin, "Über den Begriff der Geschichte"
1
MODE ist gedachter Körper. Mode ist Kunst, die gebraucht wird. Kunst wird gebraucht, wie Luxus, der das Abzeichen der Freiheit am Revers des Einzelnen ist. Mode ist der Luxus, den ganzen Anzug zu tragen. Mode ist die Attitüde der Avantgarde. Mode beginnt, wo ein Mensch sie trägt, wo der Körper sie zur Schau stellt, wie ein Schauspieler sein Kostüm braucht auf der Bühne vor allen. Wir können uns für Inhalte der Kunst nur interessieren, wenn die Form uns interessiert. Sie ist es, die uns anspringt, beunruhigt oder kalt sitzen bleiben läßt, die uns mit einem Inhalt (Gegenstand) konfrontiert, den wir annehmen oder nicht annehmen. Von außen betrachtet, ist die Mode nichts als Form. Von innen her soll sie sitzen, was sie, wenn sie gut ist, oft nicht tun wird, denn sie stört, je mehr sie die Grenze zur Moderne streift. Moderne ist die nicht tragbare Mode. Mode vermittelt zwischen Mir und Ich. Mir ist mir näher als Ich. Mein Ich muß strahlen, mein Mir soll es warm haben, bequem sitzen, kein Schmerz, kein Leid. Mode kann das ausgestellte Leid so gut sein wie die ausgestellte erschöpfende Liebe. Mode ist Form, ihr Inhalt ist Ich. Der Tod der Mode ist die Praxis, Mode hat im Alltag nichts zu suchen. Tragbares ist Sache der Schneider bzw. der Industrie, die die Stangen behängt. Mode ist insofern Kunst, als sie unbequem zu sein hat: Man bewegt sich nicht natürlich in ihr, man wird zum Inhalt gezwungen. Ein Inhalt kann nicht spazieren wie ein Mensch in der Stoßzeit, ein Inhalt steht quer im Gelände, bis der Unfall passiert. Die Kollision zeugt das Neue. Die Mode ist das Theater der Straße, nicht für die Straße. Mode auf der Straße stört, und nur aus der Störung wird neues entstehen.
2
Der Tigersprung der Mode ist eine Volte, die in der Arena stattfindet. Derselbe Sprung unter freiem Himmel ist nach Benjamin der dialektische als den Marx die Revolution definiert. So gesehen ist die Mode reaktionär. Sie verwirklicht sich im Schutzraum der Kunst. Sie verweigert sich, wie auch Theater sich verweigert. Es ist die Weigerung, den Fortschritt mitzutragen, wie er sich historisch zeigt, in der Kontinuität. Kunst ist sprunghaft. Kunst ist Schicksal. Kunst kann Waffe sein. Mode schießt mit Platzpatronen, sie braucht stumpfe Messer. Mode ist Theater, Mode ist Zoo. Die Mode plündert mit dem Reißzahn die Epochen, sie wirkt in der Diskontinuität, überraschend, antihistorisch, sie setzt ihre Marken wie Einschläge in den Konsens. Sie ist nicht Maskerade, sie reißt die Masken der Mehrheit vom Gesicht, indem sie sich den Trends verweigert. Wo der Trend anfängt, hört die Mode auf. Sie ist das ungewisse Etwas. Ganz und gar modern zu sein, ist der Anspruch der Kunst, sie ist die Vorhut der Moderne, sie läuft blindlings Sturm gegen die apokalyptischen Reiter des Zeitgeists. Wo früher Armut war, besetzt der Luxus das Terrain. Man kommt am Luxus nicht vorbei (wenn wir ihn zur Kunst erklären, können wir umgehen mit ihm). Wo die Moderne den Auftritt des Neuen schockartig formuliert, dosiert die Mode den Schock als Placebo für den Einzelnen. Mode ist der unbedingte Wille um Aufmerksamkeit für ein Ich. Der kathartische Moment des Theaters ist die geteilte kollektive Aufmerksamkeit, die mit den Mitteln der Unterhaltung vorgeht gegen das Mißverständnis, daß die Kunst den Dolmetscher gibt zwischen Behagen und Unbehagen. Was die Mode mit den Künsten eint, ist das Extrem, das die Erscheinung des Neuen bedeutet: Mag es unbequem sein, es sieht umwerfend aus.
Berlin Fashion Week in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
22.1. 2011
1
ohne den fatzer
wären wir nicht hier, der fand seinen
weg durch stacheldraht und sogar
durch menschen!
Möglich, Brechts FATZER-Material gehört zu den Jahrhundertfragmenten, von denen Heiner Müller spricht. Das Titelprovisorium DER UNTERGANG DES EGOISTEN JOHANN FATZER legt anderes nahe, es zitiert den Revuecharakter einer Arbeitsphase, die den Prozeß des Schreibens beherrscht hat, kurze Zeit. Woran erkennt man die großen Fragmente? Was sie ausmacht, ist die Brechung zwischen Autor und Figur, zwischen dem Einzelnen und dem unfertigen Stoff, zwischen dem Stoff und der Zeit seines Entstehens. Die Tiefe der Brechung macht die Größe aus und ist Grund für den Abbruch der Arbeit.
Das Jahrhundert, in das FATZER als Fragment gehört, hat mehr gesellschaftliche Fragmente ausgestoßen als literarische, die einen sind von den andern nicht zu trennen. Die großen Fragmente in der Kunst sind auch Fragmente einer Auseinandersetzung mit der Politik, Strukturen eines Scheiterns am Dasein, einen Stoff (einen Gegenstand, eine Figur) aus der Geschichte zu lösen und in die Ewigkeit der Literatur zu zwingen. Vielleicht schreiben wir heute nur noch Fragmente, oder die Computer schreiben sie mit uns. Das Computerfutter von heute ist das Kanonenfutter von gestern. Dagegen kann die Kunst eine Waffe sein, ihr erster Gebrauch dient der Selbsterhaltung des Einzelnen, der Künstler ist, weil er anders nicht kann.
Das Ineinandergreifen von Vers und Prosa, Dia-/Monolog und Kommentar hält das dramatische Tableau als Unruhepol, der ein Ausgangspunkt bleibt für die dramatischen Versuche nach ihm, offen. FATZER ist auch ein Fragment der Form, ein Zeughaus, das bis heute nicht ausgebaut ist. Heiner Müller hat sich daran abgearbeitet als Autor und als Regisseur. Das Modewort vom Scheitern (als »Chance« ein Euphemismus für Fragment) sagt nichts über ein Ergebnis in der Literatur, bestenfalls etwas über den unabgeschlossenen Prozeß. Endstation Museum, wo die Waffen ausgestellt sind. Manchmal, und im schlimmsten Fall, ist das Theater das Museum.
2
mir scheint ich bin vorläufig
aber was
läuft nach
1990 oder wenn ich von mir reden soll: den FATZER-Vers, »wie früher geister kamen aus vergangenheit / so jetzt aus zukunft ebenso«, habe ich gehört das erstemal in der Kantine des Deutschen Theaters, Berlin, aus der Gespensterstimme Heiner Müllers. 22 Jahre später kann ich ihn begreifen. Zwischen Vergangenheit und Zukunft liegt, was wir sind: Gegenwart, heimgesucht von Spukgestalten, nachdem der katastrophal banale Versuch, eine neue Gesellschaftsordnung zu errichten auf dem Rücken der Masse, zerstoben ist unter den Füßen der Masse, die vor allem eins will, Ruhe. Wir, die Masse, können uns nicht abfinden mit der unbequemen Wahrheit, daß die Vergangenheit nicht vergeht. »Die Masse wolle privat behandelt werden, das sei im Umgang mit ihr der dialektische Hauptsatz.« protokolliert Brechts Widersprecher Benjamin für den 12. Juni 1931 ein Gespräch in Le Lavandou/Côte d’Azur. Brecht versucht für die Privatbehandlung einen Film, ein früher Titel WEEKEND KUHLE WAMPE erinnert daran. Privater sollte es nicht werden, Kollektivmaßnahmen wären effektiver, meint er, Brecht, und schreibt Chöre und Arbeiterkampflieder. Benjamin zitiert: »Wenn Brecht in einem Berliner Exekutivkomitee säße: er würde einen Fünftageplan ausarbeiten, auf Grund dessen in der genannten Frist wenigstens 200.000 Berliner zu beseitigen seien. Sei es auch nur, weil man damit ›Leute hineinzieht‹.« Das Theater der Revolution als Modell der revolutionären Phantasie. Er ist damit nicht durchgekommen.
Brecht: ein Autor ohne Gegenwart, eine Insel der Unruhe im Strom der Geschichte, der seine Wirbel aufwirft an ihren Ufern; die Metaphorik für den Torso ist reich. Der Einschuß Nietzsche gegen Marx im Text: »aber von allen unternehmungen bleibt / nur das: zu leben / unternehmung höchster gefährlichkeit, kaum / aussichtsvoll«, resultiert, 80 Jahre nach Johann Fatzers Untergang gelesen, zur Konfession des Terrors, Konfession der Radikalisierung, die jeden Reformversuch, jede Individualisierung auszumerzen hat. Ihr erstes Beispiel: Ich-Fatzer, Egoist, und Abweichler, wird liquidiert, damit er sich ändert, »dadurch, daß er nicht mehr ist«. Ein Opfer im Dienst an der Sache, die den Neuen Menschen auszulösen hat aus der Geschichte, die den Menschen als Opfer des Menschen beschreibt. Die Toten marschieren besser als die Lebenden. Den Totenstrom zu einen mit dem Marsch der Lebenden, kann eine Möglichkeit von Theater sein.
3
seid nicht hochfahrend, brüder
sondern demütig und schlagt es tot
nicht hochfahrend sondern: unmenschlich!
tut nicht zwei dinge sondern
eines. nicht leben und töten sondern
nur töten
Geschichte ist ein kollektiver Strom, Bewußtseinsstrom, unterbrochen vom Auftreten einzelner Dämonen, die wir historische Figuren nennen. Das Drama stellt ihnen die künstlichen entgegen. Ein Drama ist ein historisches Stück, Literatur contra Geschichtsschreibung, es entsteht aus der Kollision Geschichte gegen Gegenwart, Geschichtsschreibung gegen einen Autor. Er ist der Untote, der die Zeitformen ineinander zwingen muß, die Zeitformen gegen die Formen der Kunst. Kunst ist Form, Form ist Fläche, auf ihr tragen wir die Konflikte, die wir im Alltag nicht benennen können, stellvertretend aus. Theater, wenn es wirken will, sollte sich als Schlachtfeld verstehen, von Publikum betretbar gegen Bezahlung. Schutzkleidung kann ausgegeben werden; gegen Pfand, man muß das Publikum in der Hand haben. Wenn Theater nicht die Nahtoderfahrung versucht, stirbt es ab.
Kurz und nicht gut: Theater ist Krieg, es sollte töten können, töten und töten. Der Tod auf der Bühne kann dem tatsächlichen Tod auf dem Schlachtfeld vorgreifen. (Soviel zur Utopie.) Daß Brecht der folgenreichste Dramatiker werden sollte nach Aischylos und Shakespeare, bedeutet auch das Ende einer Parabel. Der Umstand, daß sie nicht wieder aufgenommen wurde, oder wenn ja unbemerkt, beschreibt einen historischen Prozeß, dessen Verlauf keine Aussicht auf einen Horizont zuläßt. Die Himmel sind verbaut, die Bühne ist der offene Horizont. Kunst, wenn sie wirken will, kennt keinen Kompromiß.
Thomas Martin [aus dem Programmheft des Theater-Schwerpunkts "Scheiß auf die Ordnung der Welt – Merda sull' ordine del mondo" zu Bertolt Brechts "Fatzer"-Fragment – in der Volksbühne vom 19.-21. Januar 2012 und im Teatro Stabile, Turin, vom 6.-12.2.2012.]
Roter Salon der Volksbühne, 15.5.2012, 20 Uhr, "Überstürztes Denken" mit Marcus Steinweg
Seinen Vortrag im Rahmen des Projektes "Freitod Selbstmord - ein Fortbildungsprogramm" an der Berliner Volksbühne begann Marcus Steinweg, indem er aus dem Begriff Selbstmord das SELBST herauslöste und es zum zentralen Gegenstand philosophischen Denkens erklärte.
Das Selbst imaginiere einen Besitz an sich selbst, eine Eigentumsform. Die Unsicherheit eines solchen Selbst, seine Inkonsistenz, gehört zum Grundmuster moderner Philosophie. „Ich ist ein anderer“. Der Verlust des Vertrauens in dieses existierende Ich wird als narzisstisch-naive Kränkung empfunden. Es gibt keine einfache Gegenüberstellung des erkennenden Subjektes und des zu erkennenden Objektes mehr, sondern das Subjekt befindet sich endgültig in einem Objektstatus.
Aus der Selbstaneignung wird die Selbstenteignung, eine dem suizidalen Denken nahe Haltung.
Es sei nicht Aufgabe der Philosophie, die Entwicklungsgeschichte des Denkens von der Antike bis heute zu rekapitulieren, sondern es sei ihre Aufgabe, immer wieder die tradierten Begriffe neu zu definieren. So auch den Begriff des Realen. Der französische Psychoanalytiker Jaques Lacan habe für das Bewusstsein eine Trinität angenommen , sie bestehe aus erstens dem Imaginären, also dem Ideal, dem Bild des Ich, der Vorstellung, zweitens aus dem Symbolischen, also dem zeichenhaft geordneten Bewusstsein, einem Über-Ich und drittens dem „R e a l“, das sei ein Bereich, der keineswegs eine objektive Realität meint, sondern ein Dunkles des Bewussteins, eine Gewalt, ein Trauma, das die Inkommensurabilität, die Brüchigkeit unseres Selbst deutlich mache.
Die naturwissenschaftliche Erkennbarkeit des Objektiven und seiner Gesetze hat auch Wittgenstein eingeschränkt, indem er von einer Vereinbarung spricht, von einem funktionierenden Sprachspiel, innerhalb dessen die vereinbarten Regeln gelten, außerhalb gelten sie aber nicht. Ein selbstsicheres Selbst also gibt es nicht, es gibt nur eine Strukturkomposition unseres Ich, gebildet aus unseren kulturellen, sozialen und biologischen Bedingungen.
Das wäre es, was Foucault Sartre entgegenhält, man könne nicht einfach Transzendenz durch Immanenz ersetzen, es gäbe da keine „dialektische Zauberkunst“, mit Hilfe derer man sich seines Selbst vergewissern könne.
Lacan setzt für das einigermaßen sichere Tatsachengewebe unserer Erkenntnis der Realität eine Stütze ein, ein „Phantasma“. Verschiedene moderne Philosophen haben für diesen Bewusstseinsbereich verschiedene Begriffe, Deleuze entwickelt die Theorie des Chaos, Heidegger spricht vom Unheimlichen, Derrida vom Gespenst, spectre.
Jede Philosophie bis zurück zu Plato berühre diese Inkommensurabilität unseres Bewusstseins schon, Plato mit der Stufenpyramide der Abstraktion lande bei der „Idee des Guten“.
Marcus Steinweg betont in seinem Vortrag leidenschaftlich die wirkliche Aufgabe der Philosophie, immer die Begriffe neu zu denken, sich aus dem gesicherten ins Unbekannte zu wagen, was ja auch die Methode des Dekonstruktivismus anmahnt, wenn Derrida eine Lektüre-Ethik fordert, bei deren Intensität die Gewissheiten eines Textes ihre Konsistenz verlieren. Das dürfe aber nicht zu einer Moral des „Wenn ich Zeit hätte“, des Aufschiebens von notwendigen Entscheidungen führen. Deshalb stehe der Philosoph immer mit leeren Händen und ohne Rückhalt da, in der Situation des überstürzten Denkens, der Überhastung, der Atemlosigkeit, im Geruch eines Mangels an Seriösität, ausgestattet aber mit einer starken Resistenz gegen schon Bestehendes, ja mit einem Gewaltmoment der Grenzüberschreitung. Das verbinde den Philosophen mit dem Künstler. Eine Sicherheit des Erkenntnis-Überblicks des Selbst kann es nicht geben, das verbieten schon die Grenzen der Körperlichkeit. In der hinzunehmenden Überstürzung des Denkens gibt es nicht mehr jene aus dem Idealismus stammende innere moralische Stimme, die Moralreligion des Selbst. „Das Subjekt ist tot“. Und es ist immer ein Selbstbetrug, wenn wir nicht zugeben, dass wir sind, wie wir sind. Da sei kein Ideal-Ich in uns, das es herauszufinden gelte, auf das wir uns in unserem Selbstwertgefühl berufen könnten. Wir sind dem Suizidalen, dem Selbstmord nahe wegen dieser atheistischen Haltung auf durchlöchertem Boden.
Aber die Zuversicht liege in der lebendigen Unausweichlichkeit der Bejahung, denn erst eine Bejahung erlaube eine Verneinung.
Ricarda Bethke
Eröffnet wurde mit – man käme nicht darauf: “Wenn der junge Wein blüht“ von Björnstjerne Björnson statt des eigentlich geplanten “Götz von Berlichingen“, der wegen eines Defekts an der Versenkung nicht aufgeführt werden konnte. Der Bau des immer noch größten Sprechtheaters der Stadt ist nicht nur nach belegbaren Zahlen und Maßeinheiten ein gewaltiger. Die Metaphernlast ist ebenso groß. Das Theater zwischen Linienstraße und Rosa-Luxemburg-Platz, schon während der Bauzeit als „Monster an der Linienstraße“ betitelt und in nur 14 Monaten auf der Brache des planierten Scheunenviertels hochgezogen, steht als „kulturelle Wegmarke der deutschen Sozialdemokratie auf den Trümmern des jüdischen Einzelhandels“. Das mag – zitiert nach Franz Mehring – nach grober Übersetzung eines kulturpolitischen Vorgangs klingen, zu leugnen ist der historische Untergrund nicht. Das Scheunenviertel mußte als Teil der Spandauer Vorstadt ein gutes Drittel seines eigentlichen Flächenbestands dem Theaterbau überlassen. Bis zur von Hans Poelzig vorgenommenen Randbebauung Ende der 20er Jahre stand der massige Bau als Solitär auf dem Platz.
Aus dem Monster wurde bald der Monsterbau, der „Monstrequadernbau“, wie ihn Walter Mehring im umstrittenen KAUFMANN VON BERLIN in der Literatur verankert hat. Aus dem Monstrebau wurde der „Kulturtresor“ der Volksbühnenbewegung, 1934 wurde die Umwidmung in „Horst-Wessel-Festspielhaus“ erwogen und dann doch wieder verworfen (ein Eichenhain in Hakenkreuzformation auf dem heutigen Kinderspielplatz war bereits gepflanzt). Nach dem Krieg wurde der „Panzerkreuzer am Alexanderplatz“ gefunden, die bis heute aktuelle Schmähmetapher; sie geht zurück auf Benno Besson, wurde von Frank Castorf übernommen und zur selbstironischen Vokabel – Angriff ist die beste Verteidigung – stilisiert.
Der Platz mit den wechselnden Namen (Babelsberger-, Bülow-, Horst-Wessel-, Liebknecht-, Luxemburg- und schließlich und bis heute: Rosa-Luxemburg-Platz) hat als historischer Schauplatz und zugleich erweiterte Bühnenlandschaft des tatsächlichen Theaterbaus gedient. Frei nach Shakespeare: Der ganze Bau ist eine Bühne.
Theaterbauten stellen wie Bank- oder Regierungspaläste weniger ihre Funktionalität als ihre ideologische Positionierung aus. Im Fall der Volksbühne ist es der mit „Arbeitergroschen“ rapide erbaute wehrhafte Kulturtempel der Volksbühnenbewegung. DIE KUNST DEM VOLKE war dem Gebäude auf die Stirn gemeißelt – eine während kommender Spielzeiten in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen oft und verschieden interpretierte Losung.
Der Baukörper der Volksbühne wurde immer wieder – und wird von uns noch – als Spielkörper gebraucht. Piscator lieferte mit ersten „multimedialen“ Aufführungen schlagkräftige Bilder eines „Entfesselten Theaters“ in gigantomanischen mehretagigen, simultan bespielbaren Bühnenbildern: 1925 mit Paul Zechs Rimbaud-Drama „Das trunkene Schiff“ im Bühnenbild und mit Filmprojektionen von George Grosz, „Sturmflut“ und „Fahnen“ von Alfons Paquet oder „Gewitter über Gottland“ von Ehm Welk, 1927 Piscators letzte Inszenierung an der Volksbühne. Piscator ist bis heute der wirkungsmächtigste Regisseur an der Volksbühne bis zu ihrer Zerstörung 1944 geblieben.
Was dann nach dem 8. Mai 1945 noch stand, war wenig mehr als die klotzige Fassade. Das Theater war nicht bespielbar. Das Ensemble der Volksbühne (unter Fritz Wisten) residierte bis 1954 im Theater am Schiffdauerdamm, das im Anschluß Weigel und Brecht für das Berliner Ensemble übernahmen.
Wo die Volksbühne bis zu den Bombardements des II. Weltkriegs Platz für 2000 Zuschauer bot, wurde der Neubau, inklusive Präsidentenloge, für die knappe Hälfte ausgelegt. Ein zeitgenössischer Architekturführer gibt Auskunft: „Die Volksbühne verfügt neben einem modernen Bühnenhaus mit Drehbühne über einen Zuschauerraum, der dem klassischen Rangtheater verpflichtet bleibt. Holzgetäfelte Wände im Zuschauerraum und den Foyers erzeugen warme und intime Atmosphäre. Auf dem Areal des niedergelegten Scheunenviertels kann sich der Bau in der Blickachse der Rosa-Luxemburg-Straße mit der effektvoll inszenierten monumentalen Kalksteinfassade frei entfalten und bildet den Mittelpunkt des neu geordneten Stadtbereichs. Nach schweren Kriegszerstörungen begann der Wiederaufbau in modernen Formen, wie sie die seitlichen Anbauten dokumentieren. Die Wiederherstellung der Fassade mit der monumental geschwungenen Hauptfront mit sechs Muschelkalksäulen verzichtet auf bildkünstlerischen Schmuck, behält aber die äußere Form bei. Anstelle der Kupferhaube haben wir Flachdächer errichtet, damit erhält das Bühnenhaus einen begradigten Abschluß, der Baukörper eine wuchtige stadträumliche Wirkung. Wiederhergestellt ist im Inneren des Bühnenhauses der halbkreisförmig die Drehbühne überwölbende Kuppelhorizont. Der Zuschauerraum und die umlaufenden Galerien haben ihre typischen wertvollen intarsiengeschmückten Wandtäfelungen, ergänzt durch Marmor- und vergoldete Stuckdekorationen, zurückerhalten.“ – Dabei ist es dank bzw. trotz mehrerer großangelegter Rekonstruktionsmaßnahmen bis heute geblieben.
Zum Spielort ist der komplette Baukörper samt äußerer Anlage zum erstenmal 1974 als „Beitrag zum 25. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik“ funktioniert worden. Das Spektakel „Zeitstücke“ bot über zwei Wochen lang ostdeutsche Gegenwartsdramatik in allen möglichen und unmöglichen bespielbaren Räumen und Nischen des Hauses, inklusive Vorplatz, Straße und Spielplatz nebenan. Die Resonanz war enorm, wiederholt wurde nicht. Erst 1993, zu Beginn der inzwischen 20 Jahre dauernden Intendanz Frank Castorfs, wurde die Spektakelidee wiederaufgenommen und fortgeführt. Zuletzt vor zwei Jahren unter dem Titel SPEKTAKEL X: EXTREM JERNE POLITISCH. Eröffnet wurde mit einer „Realtheaterführung“, die als theatrale Verortung des Volksbühnenbaus und seiner Geschichte zu erleben war. Über vier Stationen wurde das Publikum um den Bau geführt:
1931 – Erich Mielke erschießt hinterrücks zwei Polizisten vor dem Kino Babylon
1934 – Weihe des Polizistendenkmals (westseitig Kaiser-Wilhelm-Straße, unterhalb des heutigen Roten Salons) in Gegenwart von Frick, Heydrich, Göring
1929 – 13 tote Streikende / Blutmai in der Linienstraße / Brecht ist Zeuge der Unruhen am Bühneneingang der Volksbühne
1933 – Stürmung des Karl-Liebknecht-Hauses durch SA, mit der anschließenden Umbenennung des Rosa-Luxemburg-Platzes in Christoph-Schlingensief-Platz für 24 Stunden.
Zum Schluß und zur Erinnerung aus dem Programm unseres bislang letzten Spektakels: „BERLIN: der Titel HAUPTSTADT sagt: Behauptung. Der Mensch behauptet sich mit Denken, der Berliner, wo es ihn noch gibt, mit Schnauze. EXTREM JERNE POLITISCH, zum Beispiel. Am 29. und 30. Oktober 2010 behauptet sich die Volksbühne mit einer Überdosis BERLIN in über 50 – großen, kleinen, kleinsten – Produktionen an über 30 Spielorten im Bermudadreieck zwischen Weydinger-, Rosa-Luxemburg- und Linienstraße, Nähe Alex, Nähe altes Scheunenviertel, Nähe Mitte, Nähe Prenzlauer Berg, Nähe Berlin überall! Die Volksbühne ein Widerstandsnest: gegen den Zeitgeist, gegen den Trend, gegen den Lifestyle, der die Stadt in ein Schaufenster verwandelt. Für die Gegenbewegung, die der Kunst den politischen Anspruch zurückerobert. Merke § 1. Berlin kannste nich erobern, in Berlin kannste dir höchstens behaupten!“
Und ein Nachtrag noch: die Feierlichkeiten zur kommenden Hundertjahrfeier der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz werden am 14. September 2013 mit der künstlerischen Rekonstruktion der Grundsteinlegung (die eine versuchte Ausgrabung des Grundsteins sein kann) vor dann 100 Jahren eingeleitet.
Vortrag, gehalten am 3. September 2012 beim Kongress „Weltkulturerbe Doppeltes Berlin“ im Haus der Kulturen der Welt
Wir freuen uns, euch in diesem Jahr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz begrüßen zu dürfen! Es erwarten euch drei Tage mit intensivem Austausch, kreativer Zusammenarbeit und zwölf Produktionen eurer Klubs, wie sie vielfältiger und individueller nicht sein könnten. Wir wünschen euch viel Freude und Neugier als Spieler, Publikum und Workshop-Teilnehmer! Wir bedanken uns sehr bei den Gewerken und Mitarbeitern der Volksbühne, dem Arbeitskreis der Berliner Theaterpädagogen und dem Berliner Bühnenverein für die Unterstützung bei der Vorbereitung des Festivals: Danke! Ohne euch gäbe es das Festival nicht.
Das Konzept der letzten sieben Festivals hat sich bewährt und so kommen wir auch dieses Jahr zusammen um:
Alle Produktionen der beteiligten Jugendklubs zu sehen. Uns Zeit zu nehmen, über das Gesehene zu reflektieren und zu sprechen. In Workshops in verschiedenen Konstellationen gemeinsam kreativ zu arbeiten.
„Wer wird Berlin?“ Berlin ist eine Verheißung. Die Hauptstadt begeistert und lockt durch ihre Kulturszene, durch die Vielfalt, die Möglichkeit von Experiment, Selbstverwirklichung und Offenheit.
Internationale Künstler und Kulturschaffende wählen diese Stadt, weil sie Freiräume für das Leben und Arbeiten jenseits von Restriktionen und finanzieller Begrenzung bietet. Doch der demographische Wandel beschreibt auch gegenläufige Tendenzen, von Ausverkauf ist die Rede, von Vereinnahmung duch Investoren, von wachsender Abhängigkeit von Erfolg und Konsens.
Was hat es damit auf sich? Welche Träume, Ziele und Inspirationen lassen sich hier verfolgen? Was bedeutet das Leben in Berlin für einen jungen Menschen? Welche Räume gibt es zu besetzen? Und nicht zuletzt: mit welchem Inhalt?
Wir sind stolz, neun Künstler_innen für sieben Workshops gewonnen zu haben und das Thema Wer wird Berlin durch verschiedene Impulse und unterschiedliche theatrale Arbeitsweisen zu verarbeiten. Am dritten Tag gibt es eine kleine Präsentation.
Eure Festivalleitung
Vanessa Unzalu-Troya / Janine Schweiger (Künstlerische Leitung), Maura Meyer (Produktionsleitung)
Wer Berlin wird, ist genauso wenig zu sagen wie was Berlin wird. Schwer genug zu sagen, was Berlin ist. Die anonyme Parole „Berlin kannste nich erobern, in Berlin kannste dir höchstens behaupten!“ gilt für jeden von uns hier, für die Theater gleichermaßen. Es gilt genauso für die KLUBSZENE. Ein Festival der Jugendtheaterklubs kann vielleicht und im besten Fall zeigen, welche Zukunft Berlin als Theaterszene hat. Ob es typisch für die Hauptstadt ist, wird offen bleiben. Wo andere Städte als Theaterstandorte abgeschafft werden bzw. sich selbst abschaffen, ist ein Festival wie die KLUBSZENE immerhin eine hoffnungsfrohe Alternative. Ob ein Aufstand geprobt werden muss, ob mit dem Eintritt des Bio-Apfels wirklich alles anders wird, ob gute oder schlechte Essgewohnheiten gute oder schlechte Spielweisen erzeugen, ob das Leben nicht mehr als eine Reality Show ist, ob der Mensch das Schwein die Krone der Schöpfung ist oder schon darüber hinaus, ob und wie ein Jugendlicher einen Sterbenden spielen kann — die Frage nach der Korrespondenz von Inhalt und Form muss immer neu gestellt werden, damit etwas Neues entsteht. Wir sind froh, dass die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz dafür eine Bühne sein kann. Gerade weil wir uns immer noch einbilden, die ewige Jugend sei hier zuhause.
Enttäuscht uns! Enttäuscht uns, damit das demographische Thema seine Relevanz hat. Drei Tage im Juni sollen auf jeden Fall drei Tage sein, in denen das Spielen so viel Spaß machen soll wie die Gespräche darüber und die Workshops dazu. Ich wünsche der KLUBSZENE, dass sie ihren Namen und den Namen VOLKSBÜHNE mit allen Widersprüchlichkeiten in die Tat umsetzt.
Thomas Martin
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Das Festival dieses Jahres steht unter dem Motto: „Demografischer Wandel“. Das ist ein Schlagwort, das etwas sperrig daher kommt, aber jeden betrifft.
Wir können täglich beobachten: Die Menschen werden älter, die Zahl der Kinder wird geringer, die Zahl der Single-Haushalte nimmt zu. Die Zahl der Arbeitenden im Verhältnis zu den nicht oder nicht mehr Berufstätigen nimmt ab.
Daraus ergeben sich Fragen: Wer pflegt Oma, wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen kann? Wie können Menschen jeden Alters sinnvoll zusammen leben, wenn es die Mehrgenerationen-Familie nicht mehr gibt? Wer soll die Rente für die Alten verdienen? Rebellieren die Jungen nicht, wenn sie einen großen Teil ihres Einkommens für die Rente der Alten abgeben müssen? Wie kann man dafür sorgen, im Alter nicht arm zu sein? Wie weit ist man für sein Leben selbst verantwortlich? Euch werden diese Fragen im Laufe Eures Lebens treffen. Ihr werdet Lösungen finden müssen.
Ich beglückwünsche Euch zu dieser spannenden Themenwahl und wünsche dem Festival einen erfolgreichen Verlauf.
Peter Otto
Geschäftsführer Deutscher Bühnenverein, Landesverband Berlin
soweit ist es also gekommen. Was bedeutet denn das? Bin ich jetzt ein Gewalt ausübender, grauer, in die Jahre gekommener, mit Erfahrung ausgestatteter (Be)Herrscher der Kunst mit einem spitzen Schirm in der Hand, der Gnade vor Recht ergehen lässt und die jungen Künstler unter seinen Schirm nimmt, damit sie nicht nass und krank werden von dem ganzen giftigen Regen aus Ablehnung und Unverständnis, der auf sie niedergeht, seit sie mit IHREN Ideen und Gedanken von neuen Formen und ihrem laut in die Welt geschrienen Zweifeln an allem und Ihrem unerschütterlichen Glauben an sich selbst und Ihre Kunst und Ihr Theater und ihre ganzganzgroßen Themen an die Öffentlichkeit getreten sind? Wenn das so ist, dann bin ich das natürlich gerne, wobei ich mich eigentlich auch lieber unter dem Schirm sehe, als ihn haltend, aber so ist das eben, irgendwann muss man das Ding auch selbst mal in die Hand nehmen. Und seien wir mal ehrlich: Was da auf Euch niedergeht, ist alles andere als Ablehnung! Es ist Interesse, Neugier, Zärtlichkeit und Verständnis, sonst gäbe es nämlich dieses Festival gar nicht. Es freut mich also, dass ich Euch den Schirm halten darf. Vielleicht ist es ja auch gar kein Regenschirm, vielleicht sind es ja nur noch die Speichen und ich ein alter Clown, der mit dem Regenschirmgerippe im Unwetter steht, Euch seinen Schutz anbietet und dabei immer betont, dass die Wolken sicher bald vorübergezogen sein werden und die Sonne auf Euch scheinen wird. Denn das wird sie ...
Milan Peschel
Schauspieler, Regisseur
– Notiz zur Konzeption von Sabine Zielke, Juni 2014
„In einer verbrecherischen Gesellschaft muß man ein Verbrecher sein.“ Dieser Satz ist die Zusammenfassung seiner, de Sades, Ethik. Durch das Verbrechen lehnt der Libertin jedes Komplizentum mit den Schändlichkeiten des Gegebenen ab, deren passive, also verachtenswerte Widerspiegelung die Masse der Menschen ist; er hindert die Gesellschaft daran, die Ungerechtigkeit gleichgültig hinzunehmen, und schafft einen apokalyptischen Zustand, durch den alle Menschen gezwungen werden, ihre Vereinzelung, also ihre Wahrheit, als nie aufhörende Spannung auf sich zu nehmen. (Simone de Beauvoir, „Soll man de Sade verbrennen?“, 1955)
Kein faschistischer Zentralismus hat das geschafft, was der Zentralismus der Konsumgesellschaft geschafft hat.
(Pier Paolo Pasolini, 1973)
Personen
Vier Libertins:
Durcet (Banker) und seine künftige Frau Adelaïde
Blangis (Waffenhändler) und seine spätere Frau Konstanze
Curval (Politiker und Medienbesitzer) und seine Auserwählte Julie
Von (General), überlässt seine Tochter Aline den anderen Libertins
Augustine und Fanny, Mädchen, zuweilen Knaben
Zélamir und Cupidon, Knaben, mitunter Mädchen [Hermaphroditen?]
La Duclos (Bordellbesitzerin)
Herkules (Ficker)
Kind (Mädchen 9 bis 10 Jahre)
Die Szene: ein Bunker. Boden und Gerüste aus Metall, verhängt mit Werbeplakaten. In der Mitte ein Einrad mit Pedalen.
I Die bunte Anrufung des Infernos
Dunkel. Abrupt helles Licht. Stummer und abgehackter Tanz der Frauen. Musik setzt ein. Adelaïde, Konstanze, Julie und Aline tanzen nun in dem Gestus: Was wir hier erleben, hat niemand erlebt! Durcet, Blangis und Curval treten auf und grinsen sich höhnisch an (Na, wartet mal ab!). General Von erscheint als Letzter in Uniform und bricht den Tanz ab. Machtdemonstration. Die Libertins stellen sich breit auf. La Duclos führt die beiden Mädchen und die zwei Jungen herein. Die Wüstlinge werfen Medikamente (Drogen), die aus der Luft gefangen werden müssen. Herkules erscheint mit großem Gemächt und schnappt mit. General Von propagiert den Schliff: „Körper ertüchtigen, alle! Alle, außer uns.“ Großes Gelächter. Musik. Synchrone Sportbewegungen, Gymnastik, Krafttraining und ähnliches. Durcet, auf dem Einrad, gibt den Takt an. Bis zum Umfallen. Erbrechen.
Die Libertins prüfen die körperliche Konstitution der Mädchen, Jungen und Frauen. Obszöne Berührungen. Schnupperproben. Schweiß lecken, Bisse. Angst und Ekel in den Gesichtern der Geschundenen.
Rede Curval: „Liebe Freunde! Dadurch, dass wir gegenseitig unsere Töchter heiraten, werden wir für immer unsere Schicksale vereinen… "…im Schatten junger Mädchenblüte, die nicht an ihr Unglück glauben mag. Sie hören Rundfunk, sie trinken Tee, am Nullpunkt der Freiheit! Sie wissen nicht, dass die Bourgeoisie nie gezögert hat, sogar ihre Söhne zu töten.“, weiter über die Regeln im Bunker: Handy, Internet- und Fotoverbot. Alle dazu Gestoßenen werden für ihre Dienste gut bezahlt (sie wissen nicht, dass sie nie in den Genuss der Vergütung kommen). Die Anwesenden werden als Weltversteher gepriesen, da das Prinzip „Geld regiert die Welt“ verinnerlicht wurde und sie selbst und endgültig in diesen Kreislauf eingetreten sind. Freude, dass die grenzenlose Entäußerung der Gier und der Triebe die wahre Philosophie sei und der Natur des Menschen entspräche (siehe de Sade „Philosophie im Boudoir“).
Herkules bringt jeder der vier Frauen eine lebensgroße Barbiepuppe, das Pendant ihrer selbst. Die Libertins holen den Mädchen eine Jungen- und den Jungen eine Mädchenperücke, entsprechend der Verkleidung Brüste und Gemächte. Jeder Wüstling schnappt sich eines der Mädchen oder einen Jungen und lässt sich als Säugling von ihnen orgiastisch in den Schlaf wiegen, während Herkules der La Duclos den Hof macht und sie nimmt. Tanz. Die vier Frauen tanzen den Barbietraum als Vollendung des Beginns.
II
Installation/Manifestation der dreckigen Passion als Prinzip des Daseins
Realität schlägt Traum. (Tanz): Augustine und Zélamir als neckisches Barbie-Hochzeits-paar sind dieser Mission nicht gewachsen. La Duclos macht sich an Augustine zu schaffen und Herkules der Ficker an Zélamir. Das Paar sträubt sich vorsichtig und versucht, aneinander zu klammern. Fast kokett, ambivalent. Blangis droht mit einem Gewehr. Durcet winkt mit Geldscheinen. Curval filmt höchstselbst. General Von spielt den Regisseur. Ende Tanz und Standbild. Alle verharren. Teilnahmslose Entjungferung der beiden. Gejohle. Musik und Zeremonie der Hochzeit. Das Kind geht von links nach rechts und streut Blüten. Niemand nimmt das Mädchen wahr. Rede Curval zum ersten Paar.
“Iss, iss, meine geliebte Braut. Auch du mein Junge musst Kraft tanken. Ihr und ich braucht Kraft für die Liebesnacht, die uns bevorsteht. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Atem, der nach nichts riecht. Der anale Akt ist der Untergang der menschlichen Spezies. Und er ist der Ambivalenteste, weil er die sozialen Normen akzeptiert und bricht. Es gibt noch Ungeheuerlicheres als den analen Akt, und dies ist Akt des Schlächters. Und es lässt sich ein Weg finden, den Akt des Schlächters zu wiederholen.“
Durcet nimmt ein Goldstück in den Mund und gibt dieses in Augustines Mund, sie in Zélamirs Mund. Er soll es schlucken. Die Gesellschaft gruppiert sich wie bei einem Stehempfang. Erzählung La Duclos über ihre Entjungferung in der Kindheit, die Einübung des Körpers und erstes Geldverdienen als Hure. Die Libertins unterbrechen, fragen nach, es fallen philosophische Bemerkungen zum Bösen, ab und zu ein sexueller Akt. Durcet steigt aufs Fahrrad und strampelt. Es spritzt Wasser. Das animiert zum Pinkeln auf die Frauen, Mädchen und Knaben, auch in die Münder. Für die Wüstlinge ausgelassene Hochzeitsfeier, sie massakrieren die Frauen und entladen bei den Knaben. Fanny muss sich entleeren und kann es nicht zurückhalten. Sie wird später bestraft.
Das Leiden hat Augustine und Zélamir zusammengeschmiedet. Sie halten sich fest einander. Gegenseitiges Schützen ist verboten. Blangis zielt mit dem Gewehr auf die beiden Drückt ab. Kein Schuss. Gelächter.
III
Im Hades der Scheiße
Zuber voll Kot: Zeit für die Besichtigung der Exkremente der Frauen, Mädchen, Knaben. Tanz ohne Musik, sie stellen sich auf. Fannys Teller ist leer. Ihr wird ein Klistier verabreicht. Nichts. Durcet sehr erregt. Fanny wird an ein Kabel angeschlossen, Durcet geht aufs Fahrrad und tritt. Aus dem hinteren Rad spritzen Goldstücke. Die Benutzten sammeln eifrig und hündisch. Die Libertins fallen in orgiastische Zustände und bemächtigen sich derer, die greifbar sind. In Fannys Körper fließt Strom. Sie zuckt. Die Beine leicht geöffnet, fuchtelt sie mit den Armen, während der Leib vibriert. Durcet hat entladen. Der Stromfluss ist abgebrochen. Fanny erstarrt. Aus ihrem Schoß fließt Blut. Ohnmacht. Sie wacht nicht wieder auf. Man schenkt dem Vorgang keine Beachtung.
Durcet ist in seinem Element. Er durchsucht und beschnüffelt die Teller der Fäkalien eingehender. In Zélamirs Teller ist das Goldstück von der Hochzeit. Durcet nimmt es zwischen die Zähne, hält es Augustine hin, die das Stück im Mund reinigen soll. Ekel und Weinen. Die Wüstlinge drohen. Schließlich gibt sie es sauber wieder her. Durcet entblößt Augustines Hintern und lässt das Goldstück zwischen ihren Backen verschwinden.
Durcet ruft: „Runter mit den Tellern! Los, meine Hunde fresst!“ Auf allen Vieren. Bellen. Weinen. Schreie. Erbrechen. General Von sorgt mit Peitschen und Nadeln für Ruhe und Ausführung des Befehls. Zerdeppert eine Flasche und holt sich die Erlaubnis der Wüstlinge, Glasscherben in die Teller zu legen. Cupidon will sich damit die Pulsadern aufschneiden. Er wird im Zuber voll Kot ertränkt. Mit einem Gewehr kitzelt General Von die Frauen und Mädchen und setzt so den Mord durch. Durcet, Cerval und Blangis in Erregung. Phantasien, wie sie mit mehr Geld, mehr Macht noch mehr Untertanen kaufen können bzw. es gar nicht mehr müssten: Verdummung über die Medien reicht, als Gleichschaltung auf freiwilliger Basis. Das braucht nicht mal mehr Wahlen.
IV
In der Hölle des Mordes und der totalen Vernichtung
Das Rad ist eine Tötungsmaschine geworden, funktioniert auch für tägliche Verrichtungen: Sport, Strom erzeugen, Wasser pumpen usw.
Licht auf diese Apparatur. In ihr sitzen eine Frau, in Lumpen gehüllt, auf dem Arm ein Bündel (Säugling) und ein 9-jähriges Mädchen in zu kleinen und abgewetzten Kleidern. Die Frau lässt sich zur Ader und füttert mit ihrem Blut abwechselnd das Bündel und das Mädchen. Das Bündel reagiert nicht. Schreie. Weinen des Mädchens. Sie können sich vor Kälte nicht bewegen. Es geht nur der Mund. Schreie. Das Bündel ist tot. Die Frau füttert das Mädchen. Die Mutter entnimmt dem Bündel ein Stück Fleisch und isst, gibt dem Mädchen, endlos.
Zu obigem Geschehen ein Text von Lidia Ginsburg (während der Blockade Leningrads durch deutsche Truppen 1941-44: „Eine feindliche Welt war auf dem Vormarsch und schickte ihre Stoßtrupps. Plötzlich erwies sich der eigene Körper als der Stoßtrupp, der am dichtesten herangerückt war … im Winter war er ein Hort unablässiger Qualen – immer wieder tauchten neue Ecken und Rippen an ihm auf …als die Menschen einen Knochen nach dem anderen an sich entdeckten, entfremdete sich ihnen ihr Körper, spaltete sich der bewusste Wille vom Körper als einer Erscheinungsform der feindlichen Außenwelt ab. Der Körper erzeugte jetzt neue Empfindungen, die nicht seine eigenen waren … Mit der Auszehrung vertiefte sich die Entfremdung. Schließlich zerfiel alles auf seltsame Weise in zwei Hälften: in die ausgezehrte äußere Hülle aus der Kategorie der Dinge, die zur feindlichen Welt gehörten, und in die Seele, die sich, separat platziert, irgendwo im Brustkorb befand. Eine anschauliche Verkörperung des philosophischen Dualismus. In dieser Phase extremer Auszehrung wurde klar: Das Bewusstsein schleppt den Körper mit.“ Träume brennen die Geschichte in Gedächtnis. Eine furchtbare, gewagte Assoziation, unabwendbar. Niemand stößt sich an den drei, vier Leichen im Raum.
Martialische Musik. Eine Siegesfeier. Konstanze wird vorgeführt wie eine Trophäe. Versuchte Hinrichtung in der Tötungsmaschine: Konstanze ist schwanger. Sie hat sich vor der Zeit hergegeben. Das steht unter Strafe. Blangis versucht, mit dem Gewehr an ihrem Geschlecht zu fummeln. Durcet schließt sie ans Kabel und tritt das Rad. Curval versucht an verschiedenen Stellen mit dem Stromkabel eine Ohnmacht zu erzeugen. Das bringt nichts. Konstanze ist stark. Die Libertins fühlen sich herausgefordert. Konstanzes Widerstand erregt sie. Sie wollen an das Ungeborene. Durcet will daraus Kapital schlagen, Blangis will es entjungfern und Curval sieht in ihm den Heiland der Naturphilosophie des Bösen, des Sadismus und den zukünftigen Herrscher des militärisch-industriellen Komplexes. Die Libertins entschließen sich, Konstanze aufzusparen und den Fötus reifen zu lassen.
Dann werden Augustine und Zélamir verschlungen auf das Rad gesetzt. Sie strampeln um ihr Leben, als könnten sie davoneilen. Ihnen wird Strom zugeführt. Sie werden mit Wasser bespritzt. Sie werden mit Nadeln gestochen, mit brennenden Kerzen malträtiert, und zu guter Letzt werden die Leichen über sie geworfen, um sie zu Tode zu pressen. Durcet schnappt über vor Ekstase und will das Fleisch des Hohen Paares veräußern, das nicht mit Geld zu bezahlen sei, aber mit dem mächtigsten Ejakulat. Man hat jetzt nur die eigenen Frauen, La Duclos und Herkules. Mörderische Orgie. Lust und körperliche Ertüchtigung. Drogen. Abtrennen von Gliedmaßen, Brüsten, Blenden der Augen. Die Geschändeten können nicht leben und nicht sterben. Sie betteln um Erlösung. Gnadenschüsse.
Das 9jährige Mädchen erscheint in Lumpen (Flucht 2. Weltkrieg), wird von La Duclos entkleidet und wie ein Püppchen angezogen, modern und teuer. Das Mädchen wird hofiert von den noch Verbliebenen und soll beschenkt werden. Es kommt eine Art aufgeklappte Kiste oder Koffer. Darin elektronisches Spielzeug, Barbies, Stoffponnies und mehr. „Dein Geburtstagsgeschenk“. Ein Libertin klappt den Koffer zu. Es ist ein schlichter Kindersarg. Dunkelheit.
30.12. 2014
Lieber X.,
die Suche nach Anekdotischem in den uns bekannten Quellen ergibt erstaunlich wenig, an Unbekanntem jedenfalls. Das Anekdotenbuch der Volksbühne hat niemand geschrieben, die Volksbühnenanekdote scheint sich der Verschriftlichung zu entziehen. Nehmen wir an, die Anekdote ist ein Kaugummi, er wird seit 100 Jahren überliefert, von Mund zu Mund, manchmal auch fernmündlich, wenn ein Telefonat Anlaß für eine fristlose Kündigung oder Abbruch einer Inszenierung ist … undsofort. Und manchmal, aber da sollte man mißtrauisch sein, gibt es sie, die Anekdote, auch auf Papier.
Die Uranekdote zieht sich von der Grundsteinlegung am 14. September 1913 bis zur Eröffnung der Volksbühne am 30.12. 1914 hin. Der auffällig schnelle Bau in nicht einmal zwei Jahren, befeuert vom sich abzeichnenden und dann schon ausgebrochnen Weltkrieg, belegt die Erbsünde dieses Theaters: Stimulation durch Krisen. Was sich sagen läßt: die Krise hat diese Eröffnung vor heute 100 Jahren zumindest fristgerecht ermöglicht.
Was Franz Mehring, einer der Volksbühnenväter, als „kulturelle Wegmarke der deutschen Sozialdemokratie auf den Trümmern des jüdischen Einzelhandels“ bezeichnet hat, steht immer noch am Rand des ehemaligen Scheunenviertels: das (nach Mehring, Walter) „Monster an der Linienstraße“. Die Idee für den Bau soll aus einem als Debattierklub getarnten Arbeiterbildungsverein mit Namen „Alte Tante“ im Osten von Berlin gekommen sein. „Alte Tante“, Schimpforden inzwischen für die Sozialdemokratie, sagt nebenbei einiges über den nicht nur proletarischen, auch kleinbürgerlichen Urgrund dieser Bewegung, deren Stammhaus wir 2014 immer noch bespielen.
Und natürlich vergessen wir nicht die Bewegung „Freie Volksbühne“, die den Bau mit ihren „Arbeitergroschen“ genannten Spenden erst losgetreten hat. Hinter jedem Groschen verbirgt sich mit Sicherheit eine genossenschaftliche Anekdote, hinter manchem vermutlich auch eine Tragödie.
Die Geschichte als Anekdotenstrom setzt sich mit der Eröffnung des Hauses fort und ist bekannt: statt „Götz von Berlichingen“, der in der Versenkung steckenblieb, kam Björnsons gut abgehangne Familienklamotte „Wenn der junge Wein blüht“ (nebenbei, kein schlechtes Stück in Zeiten der Genderfragenstellung und Gentrifizierungsprobleme) als erstes auf die Bühne. Was beinahe zur Verwechslungskomödie hätte werden können – Erstintendant Emil Lessing mußte seine eigne Inszenierung des „Jungen Weins“ vom Lessingtheater am Friedrich-Karl-Ufer Nähe Schiffbauerdamm ausleihen – ging dann mit einem ordentlichen Eröffnungsprolog von Julius Bab, Dramaturg der ersten Stunde, über die Bühne.
„Dies Haus gehört so wahrhaft dem Volke wie kein anderes, der Kunst geweihtes Gebäude in der ganzen Welt.“ Es klingt nach Brecht am BE, ist aber Bab an der Volksbühne. Zu schön, wenn er heute, 100 Jahre später, Recht behalten sollte. Vielleicht gehn wir besser noch einmal ins vorvorige Jahrhundert zurück, wo Adolf Glaßbrenner beim Gang durchs revolutionäre Berlin von 1848 rauchenden Barrikadentrümmer sieht und am Großen Schauspielhaus mit Kohle geschriebene Graffitis liest, die sagen: VOLKSEIGENTUM. Möglich, daß auch das eine Keimzelle des Grundes ist, auf dem wir heute stehn.
Der Dank, den Bab vorm ersten Vorhang einem anwesenden Bürgermeister zusprechen konnte, und der „der moralischen und materiellen Unterstützung, die die Stadt Berlin dem Unternehmen im letzten Stadium zu Teil werden ließ“ galt, läßt einen anekdotischen Gehalt erahnen. Mehr noch die wiederholte Erwähnung der „Groschenbeiträge von 50.000 unbemittelten Kunstenthusiasten, die den Baufonds geschaffen haben, durch dessen Existenz eine unterstützungswürdige Bewegung erst anheben konnte“. (Von der Vermutung, daß 50.000 unbemittelte Flugenthusiasten vielleicht ein besserer Fonds für einen Flughafenbau, als Banken, Großgesellschafter und Steuertöpfe wären, reden wir nicht.)
Auch, daß Max Reinhardt, dem sein Deutsches Theater an der Schumannstraße schon 1915 zu eng geworden war, die Volksbühne als Direktor für drei Spielzeiten übernahm, war ein Weg in die falsche Richtung von Beginn an; mehr nicht als ein Zwischenstopp vor dem großen Sprung in den Friedrichstadtpalast und der Expansion der Reinhardt-Bühnen zwischen Berlin, Salzburg und Wien. Reinhardts Direktorium war mehr Theatermiete als Theaterintendanz, finanziell ergiebig, und bis auf die Verdammnis seines Erfolgs in Herbert Iherings Schmähschrift „Der Volksbühnenverrat“ wirkungslos.
Dagegen war Piscators Dreispielzeitenanlauf Richtung Totaltheater – der in der Schaperstraße mündete, aber immerhin den Umweg über Moskau und New York einschloß – von bis heute unübertroffner Wirkungsmacht. Das könnte vor 60 Jahren für Brecht Grund genug gewesen sein, Piscators Wiederkehr in den Berliner Osten und damit mögliche Re-Triumphe auf der Großen Bühne zu verkomplizieren. Er sah den „Pis“ genannten Freundfeind lieber auf der andern Seite der Sektorengrenze auf Distanz. Neun Piscator-Inszenierungen an der Volksbühne in drei Jahren, nicht schlecht für einen derart nachhallenden Ruf. Für ein vorzeitiges Ende des Engagements sorgte 1927 der Volksbühnen-Vorstand mit der Kündigung Piscators. Hier brach die Bühne nicht unter der technischen Innovation zusammen wie unter dem „Kaufmann von Berlin“ am Nollendorfplatz, hier ging sie aus kulturideologischen Gründen in die Knie.
Die besten Anekdoten laufen sowieso knapp am Theater vorbei. Falls es stimmt: warum dann mußte Walter Benjamin seinen Begriff vom „epischen Theater“ erst 1931 während einer Haschisch-Exkursion in Brechts Wohnzimmer beim Betrachten eines stummen Foto-Films von „Mann ist Mann“ erkennen? Warum nicht schon am 4. Januar 1928, drei Jahre zuvor in der Volksbühne am Bülowplatz, wo Erich Engel, Brecht und Heinrich George „nach endlosem Beifall noch bei verdunkeltem Haus vor den Eisernen Vorhang gerufen wurden“? Oder war es am Ende doch Piscator, der 1924 mit Alfons Paquets „Fahnen“ den ersten wirklichen, weil politischen Volksbühnenskandal inszenierte, und ihn „episch“ nannte? Egal wie, das epische Theater, das wir meinen, steht am Rosa-Luxemburg-Platz.
Auf Brecht zurück geht eine andre Anekdote, sie spielt an der Peripherie der Volksbühne, genauer am Bühneneingang und am 1. Mai 1929, Linien-, Ecke Zolastraße, damals hieß sie Koblanckstraße. „Die Dreigroschenoper“ läuft seit Monaten auf Hochtouren am Schiffbauerdamm und inzwischen weltweit. Brecht, unterwegs zu neuen Ufern, besucht beim Philosophen Sternberg Kurse in Marxismus, an diesem Tag gestört vom Krach der Demonstranten und Polizeisirenen draußen. Was vom dritten Stock im Eckhaus zu sehen ist, reicht bis zum Horizont und zeigt einen Fensterausschnitt Bürgerkrieg. KPD und SPD schicken kleine mobile Trupps auf die Straßen, die das stadtweite Demonstrationsverbot unterlaufen und auch in die Bannmeile, die vom Reichstag bis weit in den Osten an Volksbühne reichen. Eingekesselt in der Linienstraße, versuchen sie über die Höfe und in den Bühneneingang der Volksbühne zu entkommen. Von Brechts Fensterblick aus sind das keine 100 Meter. Er hört die Schüsse, sieht die Fallenden, die Toten und das Blut. Und kippt um. Zumindest wird er blaß, wie es Sternberg berichtet, und fährt nachhause ans Charlottenburger Knie und macht sich Notizen zum Thema „Realismus und Realität“. Stelln wir uns Stücke wie „Die Maßnahme“ oder „Die Mutter“ als Folgen dieser Anekdote vom Blutmai 1929 vor.
Anekdotenreif könnte auch der Auftritt Hans Detlef Siercks gewesen sein, der, bevor er als Douglas Sirk Hollywoods Melodramenkönig wurde, hier 1934 Shakespeares „Was ihr wollt“ inszeniert hat. Die Besetzung vermerkt Werner Finck, bekannt geworden als politischer Kabarettist noch in der Nazizeit, und in Erinnerung geblieben als Schauspieler in Faßbinders erster Fernsehserie „Acht Sunden sind kein Tag“ von 1972. Über Siercks Inszenierung wissen wir sonst kaum mehr, als daß Shakespeare auch im Theater am Horst-Wessel-Platz der meistgespielte Autor nicht von deutscher Zunge war. Wo auch „der deutsche Clark Gable“, Joachim Gottschalk, engagiert war, bis er im November 41 seine Frau, eine jüdische Schauspielerin, die auf der Deportationsliste stand, und seinen Sohn, der auch auf der Liste stand, und dann sich mit Tabletten und Gas umbrachte. Wir kennen den Vorgang aus Hans Schweikarts Novelle und aus Kurt Maetzigs Film (den Brecht ein „Epos in Kitsch-Moll“ genannt hat.)
Möglicherweise wirft die schlecht dokumentierte Nazizeit im „Theater am Horst-Wessel-Platz“ mehr anekdotisches ab als die archivmäßig besser belegten Jahrzehnte davor und danach. Die hakenkreuzförmig angelegte Eichenpflanzung überm heutigen Kinderspielplatz hinter dem Pavillon ist die harmloseste, die Aufstellung der Führer-Büste im heutigen Sternfoyer vielleicht die komischste von vielen. Ein Ende haben dann die Fliegerbomben im Januar 1944 gesetzt. Unter den Trümmern begraben wurde – angeblich – auch die sogenannte Technikerkantine, damals ein Stockwerk unter der heutigen Kantine für alle gelegen. Anekdotentauglich auch der Marmor, von dem wir immer noch mit leichtem Grusel annehmen, daß er, der Kantine, Kassenhalle und Foyers pflastert, der von Hitlers Reichskanzlei sei. Wir bleiben dabei, jetzt ist er Volkseigentum.
Seit der Wiedereröffnung 1954 muß die Volksbühne nicht nur mit einer Kantine, auch mit fast 1200 Zuschauerplätzen weniger auskommen als vor dem letzten Weltkrieg – was, wenn wir uns manche Auslastung heute ansehen, als Gewinn betrachtet werden muß. Vielleicht war der Rückbau vor 60 Jahren nicht nur der Nachkriegs-Spar-Armut geschuldet, sondern auch der Weitsicht, daß andere abendliche Unterhaltungsformen den 2000-Plätze-Volksbühnen der Welt das Wasser abgraben werden. Die vor kurzem hier entdeckte Flaschenpost der Firma Junkersdorf – „Wer die findet kann mal an uns denken!“ – und dem stolzen Vermerk auf „herausgearbeitete 400 DM“ nimmt das kurze Zeitalter der volkseigenen Theaterform schon vorweg. Falls ein Stukkateur von damals noch lebt, dürfte er sich wundern, daß über dem Schacht, in dem am 18. Dezember 1953 die Flaschenpost vermauert wurde, heute „freundwärts / feindwärts“ wie eine unbesiegbare Inschrift steht, die noch älter aussieht als 100 Jahre Theater.
Für das Deutsche Theater nützlichere Anekdote als für uns ist auch Wolfgang Heinz’ Kurzzeitintendanz als Direktor des volkseigenen „Theaterkombinats“, bestehend aus Maxim-Gorki-Theater, Volksbühne und Theater im 3. Stock, in dem immerhin Schauspieler wie Rolf Ludwig, Reimar Joh. Baur, Dietrich Körner, Elsa Grube-Deister, Klaus Piontek, Dieter Franke, die man immer noch vermißt, gespielt haben, bevor sie mit Heinz zurück ans Deutsche gingen. (Ludwig allerdings blieb, der spielte später auch Abende simultan in der Schumannstraße und am Rosa-Luxemburg-Platz, was mehr als einmal zu wahnwitziger Verwechslung der Spielorte und Rollen und sozialistischer Abmahnung führte, den Gewinn hatte ein dankbares Publikum.)
Anekdote am Rand ist die knapp zweijährige Passage 1947-48, in der die Volksbühne als „Theater in der Kastanienallee“ auferstand für knapp zwei Jahre unter der Intendanz Heinz Wolfgang Littens im Haus, das wir heut „den Prater“ nennen. Der Prater ist sicher sein eignes Anekdotenbuch wert, und wenn im nächsten Jahr das ehemalige „Theater der Freundschaft“, die heutige „Parkaue“, dort vorübergehend einzieht, ist wieder ein historischer Zwischenstrich zu ziehen. Hinter diesem Zwischenstrich zurück liegt der Prater-Kosmos der Volksbühne – Prater-Spektakel, Prater-Trilogie und Prater-Saga, ein Zyklus New Globe und „Berlins perverstes Theaterstück“, Vinge/Müllers „Borkman“ – jedenfalls Geschichte. Wer Geschichte will, muß das Museum stürmen. In dieser Randzone der Volksbühne, in der die Zeit der Kunst tatsächlich eine andre als die sogenannte Echt-Zeit war, nämlich ein Ausstieg aus der Zeit, war der Sturm zuhause.
Zurück ins Haupthaus. Anekdote oder nicht, immer sehr gefallen hat mir Mitkos Begründung, warum die Volksbühne sein Theater wie kein andres ist: 1966 oder 67 hat er, der in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik wahrscheinlich noch Philosophie und Veterinärmedizin studierte, einen Sommer lang auf die Volksbühne aufgepaßt. Das heißt, er war Pförtner, und wir haben es auch ihm zu danken, daß wir 100 Jahre feiern dürfen. (Überhaupt, man versteht das immer erst später: Philosoph und Tierarzt zusammengenommen können gar nichts anderes ergeben als einen Regisseur.) Von Mitkos Inszenierungen ist viel und genug geredet worden, Anekdote bleibt am ehesten sein „Großes Fressen“, weil der (war er rosa?) Schaum von Katrin Brack die Abwasserkanalisation des Hinterhauses bis in die Garderobengänge überspült hat, gelungene Metapher.
Und nicht mehr als Anekdote ist das große Klassikerprojekt der 70er Jahre geworden, von dem die verschiedensten Ab- und Umläufe erzählt werden: „Nibelungen“, Regie Karge/Langhoff, im Sternfoyer, Kleists „Käthchen“, Regie Besson auf der Hinterbühne, Molières „Menschenfeind“, Regie Marquardt, auf der Bühne. Letztere Arbeit die einzige, die zur Premiere kam, und eine von Fritz’ besten. Anekdote und nicht Aufführung wurden auch Bessons „Mutter Courage“ und „Heilige Johanna der Schlachthöfe“, zu der schon zur Konzeptionsprobe, wie der Volksbühnenmund berichtet, kaum jemand erschien. Beides Brechtstücke, beide nicht aufgeführt am Haus, das „Volkseigentum wie kein anderes ist“.
Anekdotisch am ergiebigsten wären, wie meist, die Stasi-Akten unsrer lieben Mitarbeiter bzw. derer, die es waren. Diejenigen, die freigegeben sind und die wir auf Materialsuche für unser Buch lesen konnten, bringen eigentlich immer das Komische und das Traurige zusammen, auch wenn in ihnen nicht immer von Theater die Rede ist. Am lustigsten das protokollierte Verhör der ehemaligen Botin, die ihre Zigarettenkippen im Papierkorb auszudrücken pflegte im Sinn einer allgemeinen risikofreudigen trotzigen politischen Anti-Haltung. „Ich kippte die gesamte Asche in einen Papierbogen. Diesen warf ich in den im Raum befindlichen Papierkorb.“
Die üblichen lustigen Verwechslungen sind auch in der Hauptsache in den „Akten“ zu finden, wenn z.B. das „operative Material CHEF“ ergibt, daß aus „dem Kreis um Besson eine Partei gemacht wurde, zu der gehören soll: Schumacher, Kurt / Hacks, Peter / Müller, Heiner und Marquardt, Fritz (Pädagoge).“ Oder der namenlose IM, der den „Mitarbeitern des MfS“ in seiner Wohnung auf deren Frage, ob er bereit sei, inoffiziell mit „unserem Organ zusammenarbeiten“, antwortet, daß er glaube, dies schon zu tun – und auf den Umstand der Wahrung von Staatsgeheimnissen hingewiesen, zu bedenken gibt, daß er unter Narkose schon sehr viel aus seinem Leben erzählen haben soll.
Weniger lustig ist das kopierte Schreiben von Jürgen Gosch an Kurt Hager im „Politbüro des ZK der SED“, in dem er um Regie-Arbeit, „egal wo“, bittet, nachdem seine „Leonce-und-Lena-Inszenierung“ mit Gwisdek und Beyer in Unterhosen und einem übergreisten Politbürochor von der Kritik als (zwischen den Zeilen lesbar) klassenfeindlich abgestempelt wurde. Goschs Brief endet mit dem traurigen Satz: „Ich selber habe keine Möglichkeiten über mein Talent und meine Arbeitsfähigkeiten zu verfügen. Und das ist der Zustand, der mich unglücklich macht. Hochachtungsvoll.“
Und daß der ehemalige Stasi-Mitarbeiter und heutige Chefdisponent 1980 in Müllers „Auftrags“-Uraufführung den „Mann, der die Pässe zerreißt“ spielen konnte, ist zwar anekdotisch halbwegs ergiebig, behält aber den unangenehmen Nachgeschmack, den man erst als Nachgeborener nicht mehr spürt. Von Müllers „Auftrag“ im 3. Stock zu reden, bringt eher die Fleisch-klatscht-auf-Stein-Erinnerung an Jürgen Holtz’ kolossalen Körpereinsatz mit sich, als er DER TOD IST DIE MASKE DER REVOLUTION DIE REVOLUTION IST DIE MASKE DES TODES brüllend, von Wand zu Wand lief und sich nackt gegen nackte Mauern warf (in meiner Erinnerung). Zwei Jahre später war es in „Macbeth“ Schliekers goldene Telefonzelle, in der Gwisdek und Harfouch auf- und abwärtsfuhren, und die die endgültige der Ankunft der westdeutschen Theatermoderne im Osten oder wenigstens in der von Fritz Rödel verwalteten Volksbühne symbolisierte.
Anekdote sind die ungezählten Kantinengeschichten, die jeder für sich selbst und anders erlebt bzw. gehört hat, seitdem die Kantine in der Gestalt, wie sie Benno Besson hat einrichten lassen, existiert. Anekdote überhaupt ist der historische Ort, an dem die Volksbühne steht – vom planierten Scheunenviertel über den Blutmai und den Mielke-Mord vorm Kino Babylon, den Sturm der SA auf das Karl-Liebknecht-Haus, den von Goebbels befohlenen 30 Meter hohen Horst-Wessel-Gedenk-Obelisken vor dem Theater, das erwähnte Theaterkombinat und Abwicklungsvorhaben um 1990, bis – ja, bis zum Moment, an dem die wirklichen Anekdoten an der langen Tafel in der Volksbühne erzählt werden. Sie werden erzählt werden vor allem von denen, die während des bald vollständigen Vierteljahrhunderts unter Castorfs Intendanz, hier arbeiteten und immer noch arbeiten und feiern werden nachher.
Mit Grüßen!
Y
Chris Dercon will an seinem neuen Arbeitsplatz alles richtig machen. Das ist falsch
Chris Dercon ist unendlich sympathisch, erfolgreich, ökonomiekritisch, empathisch, mitreißend und glamourös. Kein Wunder, dass er mit dem Tate Modern das größte und bestdotierte Museum für moderne Kunst auf der Welt leitet. Und jetzt der nächste Schritt: Volksbühne Berlin. Inhaltlich vertritt er tatsächlich nichts, was an der Volksbühne nicht schon vertreten worden wäre. Das betonte er bei seiner ersten Pressekonferenz ausdrücklich. Er lobte seine Vorgänger und versuchte den Eindruck zu erwecken, man verstünde sich blendend. Seine programmatische Rede gipfelte in dem Satz: „Die Volksbühne wird nicht anders sein, sie wird sich weiterentwickeln.“ Das wäre ja schön und niemand hätte etwas dagegen. Aber natürlich wird die Volksbühne völlig anders sein, wenn Frank Castorf, René Pollesch und Bert Neumann nicht mehr dort arbeiten. Sie alle sind als Theaterkünstler mit ihren Teams für Berlin verloren. Sie sollen anderen Platz machen. Ich habe nichts gegen die Künstler, die Dercon aus dem Hut gezaubert hat. Sie sind in Berlin alle bekannt, aber sie als Bewahrer der Kontinuität oder Weiterentwickler der Arbeit von Castorf und Pollesch zu imaginieren, übersteigt meine Vorstellungskraft.
Dieser etwas kleinmütig wirkende „Coup“ – Susanne Kennedy statt Castorf, Romuald Karmakar statt Pollesch – ist eine Zumutung, auch für die Berufenen selbst, die nun an etwas gemessen werden, mit dem sie künstlerisch kaum etwas zu tun haben. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Dercon so im Rahmen des business as usual bleibt. Der Direktor des weltgrößten Museums für moderne Kunst schleift das immer noch irritierendste Theater in Europa, um dort selbst das Theatermachen zu erlernen und Horváth aufzuführen. Er will am neuen Arbeitsplatz alles richtig machen. Das ist falsch. Das sieht wie Rückentwicklung aus. Anders wäre es, wenn Dercon ein paar singuläre bildende Künstler überzeugen könnte (Isa Genzken, Cindy Sherman, Banksy, Damien Hirst, Ryan Trecartin? Keine Ahnung), auf der Volksbühne oder in Tempelhof das Theater noch mal neu zu erfinden. Jetzt mit den gleichen Leuten zu kommen, die bei den anderen Bühnen auch schon auf der Liste stehen, klingt wenig spezifisch.
Wenn man die Volksbühne weiterentwickeln will, sollte man deren Substanz nicht zerstören. Das ließe sich vermeiden, wenn man die Dercon versprochenen zusätzlichen fünf Millionen in eine dauerhafte Kollaboration Volksbühne/ Tate Modern investieren würde. Damit würde die ästhetische Spiegelung zweier dem Kapitalismus unterschiedlich entgegentretender Metropolen ermöglicht und Theater und bildende Kunst auf zwanglose Art institutionell zusammengebracht. Dann könnten Castorf und Neumann oder Pollesch oder Fritsch dort mal für ein, zwei Jahre die Leitung übernehmen und die Volksbühne in der durchökonomisierten Tate Modern aufschlagen lassen. Und Dercon könnte mit den besten Künstlern der Welt, die alle in seinem Telefonbuch stehen, in Berlin und der Volksbühne neue, im Theater nie dagewesene antiökonomische Impulse liefern. Und wenn Bruce Nauman plötzlich Horváth inszenierte, würde das zumindest neugierig machen.
Ich würde Chris Dercon allen Ernstes empfehlen, sich das Ganze noch mal zu überlegen. Ist nicht Flexibilität auch eine seiner Stärken? Die feindliche Übernahme eines Theaters macht keinen Sinn, wenn man das, was man selbst an dem Theater gut findet, damit zerstört.
Carl Hegemann
Quelle: Der Freitag 18/2015
Bislang wurde die Umwandlung der Berliner Volksbühne zu einem von Chris Dercon geleiteten interdisziplinären Theater als singulärer Einschnitt diskutiert. Doch es sprechen gute Gründe dafür, den Vorgang als Pilotprojekt zu verstehen, das langfristig Folgen für die gesamte deutsche Theaterlandschaft zeitigen wird und im Erfolgsfall Städte wie Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln oder Mannheim veranlassen dürfte, ihre Theater ebenfalls aus der lokalen Verankerung zu lösen.
Auch wenn das Team Dercon beteuert, am Ensembletheater festhalten zu wollen, spricht die Logik der Betriebsabläufe dagegen. Ein festes Ensemble hat nur Sinn, wenn die Schauspieler durchgehend beschäftigt sind, wenn tagsüber geprobt und abends gespielt wird. Sobald die Anzahl der Aufführungen drastisch reduziert wird, gebietet es die ökonomische Vernunft, die einzelnen Schauspieler nicht über Jahre anzustellen, sondern mit einem weit kostengünstigeren Stückvertrag zu binden. Wenn sie nicht permanent an einem Ort präsent sein müssen, können Gastspiele zudem viel freier disponiert werden. Von dort aus ist es nur noch ein kleiner Schritt, die Stücke samt Ausstattung (Bühne und Kostüme) gleich mit anderen Anbietern zusammen an den Start zu bringen, wie das im Festivalgeschäft und zwischen Produktionshäusern üblich ist, und sie als Koproduktionen von Festivals und Kunst-Theaterhäusern in ganz Europa auf die Reise zu schicken.
Der Neustrukturierung erwischt die Stadttheater in einer Situation, in der sie durch Etatkürzungen, Spartenschließung und Zusammenlegung ohnehin unter Druck geraten sind. Auch wenn das Zuschauerinteresse nicht nachlässt, schrumpft der künstlerische Etat stetig. In den sechziger Jahren kam die Hälfte des Budgets der Kunst zu Gute; heute verschlingen Technik und Verwaltung mehr als 85 Prozent des Gesamthaushalts. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen, da das Gros der Belegschaft aus nicht-künstlerischem Personal besteht, für das Tarifverträge gelten, während die Zuwendungen der kommunalen Haushalte zumeist stagnieren.
Gleichzeitig stehen die Städte, wie der Soziologe Gregor Betz schreibt, unter einem zunehmenden „Eventisierungsdruck“, der von der
Tourismus -, Kultur- und Kreativwirtschaft ausgeht. Seit Richard Florida vor gut zehn Jahren die zunehmende Bedeutung der kreativen Klasse beschwor, findet sich das Leitbild der „creative city“ auf der Agenda jeder ambitionierten Stadtverwaltung. Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz beschreibt eine Gegenwart, die „die Förderung und Etablierung des ästhetisch Neuen zum Gegenstand der politischen Steuerung und Planung“ macht. Kreativität, einstmals ein Medium individueller Selbstverwirklichung und Authentizität, hat sich – man sieht es an „Deutschland sucht den Superstar“ – zu einer „umfassenden ästhetischen Mobilisierung der Subjekte und des Sozialen“ (Reckwitz) entwickelt. Ausgerechnet der Volksbühnenautor und -regisseur René Pollesch wird nicht müde, solche Kreativitätsgebote szenisch zu attackieren. Von daher musste kein Prophet sein, wer voraussagte, dass Dercons lautstarke und öffentliche Werbung um Pollesch nicht auf Gegenliebe stoßen würde.
Als Bürgermeister Müller sich im Parlament über die Skepsis wunderte, die seine Entscheidung für den Theaterneuling Dercon hervorrief, während die Besetzung des Humboldt-Forums „mit einer herausragenden internationalen Persönlichkeit“ doch Beifall fand, stellte er selber einen beredeten Zusammenhang zwischen Stadtschloss und dem Kuratorenmodell Volksbühne her. Beide sollen offenbar jene Images hervorbringen, die die Attraktivität der deutschen Hauptstadt erhöhen, die sich seit 2006 „UNESCO City of Design“ nennen darf und damit Mitglied des UNESCO-Netzwerk der Creative Cities ist.
Neben den 3,5 Millionen Einheimischen werden mit den neugeformten urbanen Herz in Mitte vorrangig jene Touristenscharen angesprochen, die mit knapp dreißig Millionen Übernachtungen pro Jahr einiges zur Konsolidierung der schwer verschuldeten Stadt beitragen. Eine Zahl, die sich mit Stadtschloss und Humboldtforum, aber auch mittels der Eventmarke Volksbühne gezielt vergrößern lässt, um sich weiter an das in Schlagweite entfernte Paris, der europäischen Nummer 2 im touristischen Städteranking heranzuarbeiten. Wenn das Angebot nun tatsächlich den erlebnishungrigen, mit allen avantgardistischen Wassern gewaschenen und im Billigflieger angereisten Hipster anregen soll, vorm Clubbing noch einen performativen Event ins Abendprogramm zu schieben, passt die querulatorische Kunst Castorfs mit seinen sechsstündigen Arbeiten kaum ins Konzept - Abende, die viel zu lang und sprachlastig sind, als dass ein audiovisuell orientiertes, der Landessprache unkundiges Publikum sie goutieren könnte. Dass Dercon mit zwei Choreographen, der Dänin Mette Invargsen und dem Franzosen Boris Charmatz aufwartet - „ich will mitmischen, herausfinden, wie die Kultur der Zukunft arbeitet“ -, den wortlosen Tanz im europäischen Zukunftslabor stark macht, spricht ebenso Bände wie die von Dercon und Piepenbrock unterschriebene Bekundung, dass sie sich der Rolle des Hauses in künftigen Raumplanungskonzepten bewusst sind: „Dievolksbühne berlin schafft eine programmatische Achse zwischen den zukünftigen Strategieräumen Mitte und Tempelhofer Feld/ Neukölln. Gleichzeitig verbindet die neue urbane Konstellation die Architekturentwürfe der frühen Moderne von Poelzig, Kaufmann und Sagebiel mit den fluiden Architekturen der digitalen Medien.“ Künftige Intendanten dürften nach diesem Statement wohl nur noch mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eingestellt werden.
Fatal ist das Bekenntnis zum künftigen Strategieraum Mitte vor allem insofern, als es die Stadtgesellschaft und deren Bedürfnisse offenbar geringer veranschlagt als einen zwar finanzstarken, ansonsten aber anonymen und geschichtslosen flow von Touristen. Theater als ein Gegenüber der lokalen Bevölkerung scheint in der internationalisierten Zukunft keinen Platz zu haben. Tatsächlich ist das städtische Ensembletheater global ein äußerst seltenes Gewächs, das weder in der angloamerikanischen Welt noch in den romanischen Ländern anzutreffen ist. Ein Modell, das unter den besonderen Umständen der deutschen Geschichte, der „verspäteten“ Nation samt seiner Kleinstaaten entstand und Deutschland zu einer der führenden Theaternationen der Welt wachsen ließ. Denn Ensembletheater kommt primär der Schauspielkunst zu Gute. Die Festivalisierung trocknet das Biotop, in dem sich diese ästhetische Praxis allmählich entfaltet, zusehends aus. Spezielle Spielweisen zu entwickeln, die ein Esemble auszeichnen und die z. B. das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz weltweit berühmt machte, ist somit unmöglich. Macht das interdisziplinäre Theater - realiter ein Frontangriff auf das Sprechtheater - Schule, wird es absehbar einen immensen Verfall der Theaterkultur nach sich ziehen.
Der beabsichtigte Sprung vom Lokalen zum Globalen ist ein Moment der allgegenwärtigen Standardisierung und Homogenisierung. Die weltweite Etablierung derselben Produkte und Ketten lässt den Bezug auf das Einmalige eines Ortes und seiner Geschichte anachronistisch erscheinen. Das gilt ebenso für die Struktur der Sprechtheater wie etwa für die drei Versalien OST auf dem Dach der Volksbühne oder Castorfs ständige Verweise auf noch nicht verflüssigte ostdeutsche Identitätskerne in seinen Inszenierungen. Die konkrete Verankerung der Volksbühne in der Geschichte der lange geteilten Stadt und ihrer daraus entstandenen Mentalität wird vom Stadtmarketing zu den Akten gelegt. Statt aus der Auseinandersetzung mit dem Lokalen und der eigenen Geschichte eine unverwechselbare ästhetische Gestalt zu gewinnen und damit auf der Welttheaterbühne anzutreten, soll der Stadtgesellschaft künftig das gleiche Produkt serviert werden, das auch in London, Paris, Amsterdam, Brüssel, Venedig zu haben ist – und wohl auch bald in Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt am Main.
FRANK RADDATZ / FELIX RADDATZ
„Am Abend kommt noch die etwas peinliche Nachricht, daß der Schauspieler Gottschalk, der mit einer Jüdin verheiratet war, mit Frau und Kind Selbstmord begangen hat.“ Notierte Joseph Goebbels am 7. November 1941 in seinem Tagebuch. Der Tod dreier Menschen ist dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda lediglich eine „etwas peinliche Nachricht“. Man lebe in einer „harten Zeit“, beruhigt sich Goebbels, da sei es gut, wenn man „ein festes Fundament“ besitze. Gottschalk habe im „Konflikt zwischen Staat und Familie“ versagt. So überhebt sich der Minister über die Toten mit der banalen Folgerung, dass wer „heute keine feste Position“ besitze, ein „schwaches Rohr“ sei, „das jeder Sturm zerknickt“.
Der Schauspieler Joachim Gottschalk, 1904 in Calau, nahe des Spreewaldes, geboren, war populär. Regisseure schätzten ihn wegen seines verhaltenen Sprechstils. Er war kein Pathetiker. Sein schauspielerisches Understatement verfing, Kritikern galt er als deutscher Clark Gable. Etabliert hatte er sich auf den Bühnen in Stuttgart und Leipzig. Den Durchbruch schaffte er in Frankfurt am Main, wo er, 30 Jahre alt, als jugendlicher Held agierte; unter anderem reüssierte er in Schillers „Fiesco“, eine Rolle, mit der er auch bei der Berliner Volksbühne auf sich aufmerksam machte. Seit 1930 mit einer Jüdin verheiratet, der Schauspielerin Meta Wolff, die sich auf seinen Wunsch 1933 evangelisch taufen ließ, kam im selben Jahr ihr gemeinsamer Sohn Michael zur Welt. In Frankfurt sah sich Gottschalk wegen seiner Familie zunehmend ausgegrenzt und denunziert. Seine Frau unterlag bereits einem Berufsverbot. In dieser Situation vermittelte ihn der Intendant der Frankfurter Bühnen an Eugen Klöpfer, der dem Theater am Horst-Wessel-Platz, wie die Berliner Volksbühne seit der Umbenennung des Bülowplatzes 1933 hieß, vorstand. Klöpfer stand in offensichtlicher Konkurrenz zu Gustaf Gründgens, der das Schauspielhaus leitete. Beide wetteiferten um die besten Schauspieler und um die größte Aufmerksamkeit. Obwohl Klöpfers Intendanz von skandalösen Vorkommnissen nicht frei und er ein politischer Opportunist von hohen Graden war, bot sein Ensemble Schutz vor politischen Nachstellungen. So fand sich der aufstrebende Star Gottschalk, von Klöpfer protegiert, in einer Riege jüngerer Schauspieler, zu denen René Deltgen, Werner Hinz und Ernst Wilhelm Borchert gehörten. Gottschalks Theatererfolge fanden in einer rasanten Filmkarriere ihre Ergänzung. Zwischen 1938 und 1941 spielte er in sieben Filmen die Hauptrolle und wirkte noch Anfang November 1941 in einem frühen Fernsehfilm mit.
1939 war Gottschalk auf der Bühne des Theaters in der Saarlandstraße – zu dieser Zeit ein Teil der Volksbühne – in der Rolle eines jungen Grafen der Sieger über einen von Fritz Rasp gespielten Antifaschisten in dem Stück „Morgengabe“. Geschrieben hatte es der Mussolini-Freund Giovacchino Forzano. Doch auch solch weltanschaulich eindeutige Rollenbesetzung schützte im Leben nicht vor Verfolgung und Ausgrenzung. Der Anfang vom Ende kam jäh. Im Frühjahr 1941 wurde gegen Gottschalk Berufsverbot verhängt. Dem vorausgegangen war eine unerwartete Begegnung zwischen Goebbels und Meta Gottschalk, die im April 1941 ihren Mann zur Premiere des Films „Die schwedische Nachtigall“ begleitet hatte und im Verlaufe des Abends auch dem Minister vorgestellt worden war. Als dieser erfuhr, dass er einer Jüdin die Hand gegeben hatte, veranlasste er, Druck auf Gottschalk auszuüben, sich ultimativ von seiner Frau zu trennen. Die Deportation seiner Frau und des Sohnes ins Lager Theresienstadt war verfügt. In der Nacht vom 5. auf den 6. November 1941 ging die Familie in den Tod.
Man kann diesen Suizid als Akt des Widerstands sehen. Sich der Verfolgung zu entziehen, sich der Anweisung zur Scheidung zu verweigern, erforderte Mut. Und Vertrauen zueinander. Vertrauen, das auf menschlicher Zuneigung basierte. Auf Liebe.
Einen Tag, nachdem ihn die Nachricht von dem Selbstmord erreicht hatte, verfasste Goebbels abermals einen rechtfertigenden Eintrag in seinem Tagebuch. Selbstgewiss bramarbasierte er, dass der Staat „immer den Vorrang“ haben müsse. Und dass, „wenn ein junger Mann in einer Zeit, in der das Vaterland um seinen Bestand kämpfe, nicht wüßte, wo sein Platz wäre, beim Vaterlande oder bei seiner jüdischen Familie, er dann auf die Sympathie der Öffentlichkeit kaum rechnen könne“. Eben dieser Goebbels, Menschenvernichter und sich selbst genug, entzog sich am 1. Mai 1945 aller moralischen und politischen Verantwortung. Sein „festes Fundament“ trug nicht mehr – nicht ihn noch andere. Er und seine Frau töteten sich mit Zyankali. Ihre sechs Kinder hatten sie zuvor vergiftet.
Das Schicksal der Gottschalks blieb einer begrenzten Öffentlichkeit nicht verborgen. 1947 verfilmte der Regisseur Kurt Maetzig nach einer Novelle von Hans Schweikart die Geschehnisse unter dem Titel „Ehe im Schatten“. In der Szene vor dem gemeinsamen Tod heißt ein Dialogsatz: „Sterben, was ist das für ein Wort, sag es mir ...“ Und die Eheleute rezitieren den letzten Monolog aus Schillers „Die Jungfrau von Orleans“: „Hinauf – hinauf – Die Erde flieht zurück – / Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude!“
Menschenwürde – das ist das tragende Motiv in der Geschichte der Gottschalks. Ein unumstößlicher gesellschaftlicher Begriff. Und ein antidiktatorisches Wort. Falsch wäre, wenn ihr Leben und ihr Tod nur in die Legende überginge.
Rolf Aurich ist Lektor und Redakteur an der Deutschen Kinemathek, Berlin, Wolfgang Jacobsen ist Leiter der Forschung ebendort. Ihr Artikel erscheint anläßlich der Aufstellung der Porträtbüste des ehemaligen Volksbühnen-Ensemblemitglieds Joachim Gottschalk im oberen Parkettfoyer. Dank sei Rosemarie Kilius gesagt, die das 1946 entstandene Werk des Bildhauers Knud Knudsen in den Archiven der Stiftung Stadtmuseum Berlin ausfindig gemacht hat.
Die Autoren weisen auf folgendes hin: Eine ausgesprochene Gottschalk-Forschung existiert nicht, am weitgehendsten bislang dürften die Erkundungen von Ulrich Liebe in seiner Gedenk-Anthologie zu bewerten sein („Verehrt, verfolgt, vergessen. Schauspieler als Naziopfer“, zuletzt Beltz 2005). Wiederkehrende Bemühungen um ein Wachhalten der Erinnerung an Gottschalk und seine Familie haben ihren Ausgangspunkt häufig in dem Erinnerungsfilm „Ehe im Schatten“ von 1947 oder, wie zuletzt, in dessen wiederaufgefundener literarischen Vorlage: Hans Schweikarts Erzählung „Es wird schon nicht so schlimm“ (Verbrecher Verlag 2014).
Rolf Aurich / Wolfgang Jacobsen

Porträtbüste des ehemaligen Volksbühnen-Ensemblemitglieds Joachim Gottschalk im oberen Parkettfoyer des Theaters
Berlins kulturinteressierte Kreise kennen fast nur noch ein Thema: Was wird aus der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz? Dass den seit 1992 amtierenden Intendanten Frank Castorf im Sommer 2017 der belgische Kurator Chris Dercon ablösen wird, wissen selbst Menschen, die nicht zum Stammpublikum der Volksbühne zählen. Und die meisten finden das nicht gut.
Aber warum eigentlich? Passt die ganz und gar nicht hip, schick und trendy wirkende Sehnsucht der Castorf-Fraktion nach Kontinuität heute noch zu Berlin, dieser Stadt im permanenten Wandel, in der man sich besser nicht an ein Lokal oder ein Geschäft gewöhnt, weil es innerhalb weniger Tage geschlossen oder als etwas völlig Neues eröffnet werden könnte? Offenbar hat die Volksbühne auf Grund ihrer Geschichte und ihrer künstlerischen Ausstrahlung eine Ausnahmeposition, die vital mit der Stadt und ihren Bewohnern verbunden ist und von diesen ebenso wahrgenommen, gefordert und geschätzt wird. Mit Fug und Recht könnte man sogar behaupten, dass die Volksbühne für Kultur-Berlin mehr zählt als Hertha BSC für Sport-Berlin. Das zeigt sich auch daran, dass der Konflikt um die Neubesetzung der Volksbühne seit April 2015 nicht zu brodeln aufhört.
Damals wurde Chris Dercon vom Regierenden Bürgermeister und Kultursenator Michael Müller (SPD) offiziell als nächster Intendant der Volksbühne vorgestellt. Leider wurde inhaltlich außer wolkigen Floskeln nichts Konkretes verlautbart, woran sich bis kaum etwas geändert hat: Genauere Aussagen von Dercon und seiner Programmdirektorin Marietta Piekenbrock zu ihrem "Globaltheater für das 21. Jahrhundert" liegen immer noch nicht vor.
Zahlreiche Theaterleute schlugen nach der Verkündigung umgehend Alarm und äußerten ihre Bedenken, dem theaterunerfahrenen Kurator das renommierte Haus zu übergeben. Chris Dercon (Jahrgang 1958) war unter anderem von 2003 bis 2011 Direktor des Hauses der Kunst in München und wechselte dann in gleicher Funktion an die Tate Gallery of Modern Art in London. Zu den Warnern gehörte auch Ulrich Khuon, der besonnene, zurückhaltende Chef des Deutschen Theaters. Er begann seine Laufbahn als Dramaturg, ehe er Intendant wurde und über Stationen in Konstanz, Hannover und Hamburg an die Spitze der Traditionsbühne im Herzen Berlins gelangte. Natürlich hätte er diese Position als Anfänger nicht seriös erfüllen können, betont er jetzt im Gespräch, schließlich sei Intendant ein Beruf "wie Flugzeugpilot auch. Wir haben theaterspezifische Erfahrungen, haben den Apparat im Griff, bringen unsere Ensembles voran, sind in der Öffentlichkeit präsent, treffen ökonomische wie ästhetische Entscheidungen. Wir sind nicht einfach nur alte, weiße Männer, die nicht loslassen können, sondern wir beherrschen eben bestimmte Dinge." Obwohl er gern in Museen geht, eine Liebe zur bildenden Kunst hat und auch "ein bisschen was" von ihr versteht, wie er bescheiden anfügt, und obwohl er in Hannover eng und gern mit dem dortigen Kunstverein kooperierte, wäre es für ihn undenkbar, vielleicht den Hamburger Bahnhof, das Berliner Museum für Gegenwartskunst, zu übernehmen - von der Tate Modern ganz zu schweigen.
Was mag die Berliner Kulturpolitik überhaupt dazu veranlasst haben, der erwiesenermaßen im In- wie im Ausland höchst erfolgreichen Volksbühne einen solchen "radikalen Neuanfang" zu verordnen, wie es Kulturstaatssekretär Tim Renner nannte? Vielleicht, so Khuon, sei es eine "Unterschätzung unseres reichen, beweglichen, lebendigen Theatersystems. Man fand das seitens der Senatsverwaltung okay, wollte nun aber frisch, fromm, fröhlich, frei etwas ganz anderes!"
Selbst Thomas Ostermeier, seit 1999 künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne, weiß nichts über künftige Projekte an der Volksbühne, und die Informationen, die man bekomme, seien "spärlich und widersprüchlich". Aber: "Wenn der Intendantenwechsel das Ende des Ensembletheaters an der Volksbühne bedeuten sollte, wäre das für die anderen Ensembletheater in Deutschland ein verhängnisvolles Signal." Obwohl die Schaubühne mit Londoner Bühnen wie dem Royal Court Theatre, dem Barbican Center und dem Théâtre de Complicité kooperiert, hatte Ostermeier bisher persönlich nichts mit Chris Dercon zu tun und weiß auch nicht, "ob er Gastspiele der Schaubühne in London besucht hat". Schon lange betrachtet Ostermeier die Volksbühne "als das wichtigste Gegenüber" in Berlin, ärgert sich aber, dass diese stets höher subventioniert ist als sein Haus. 2017 betrug die Differenz fünf Millionen Euro - ungeachtet der Tatsache, dass beide Theater "die gleiche Anzahl an Mitarbeitern haben und in der gleichen Liga spielen".
Ostermeier argwöhnt sicherlich nicht zu Unrecht, dass Dercon mit einer vermutlich finanziell künftig noch besser ausgerüsteten Volksbühne die Marktführerschaft in Berlin anstreben und übernehmen werde: "Die Schaubühne hat mit ihrem Budget keine Chance dagegen." Wenn Dercon etwa "La Passione", Romeo Castelluccis szenische Adaption von Bachs "Matthäus-Passion" mit dem Philharmonischen Staatsorchester unter Kent Nagano aus Hamburg in die Volksbühne einlädt, obwohl Castellucci bisher an der Schaubühne gearbeitet hat, merkt Ostermeier schmerzlich, dass Geld doch Tore schießt: "Ich muss sehr oft bei Regisseuren die Freundschaft bemühen und sie daran erinnern, dass wir eine künstlerische Vision teilen, weil ich ökonomisch mit anderen Bühnen nicht konkurrieren kann."
Von offizieller Senatsseite heißt es freilich, außer einem Vorbereitungsbudget von 2,23 Millionen Euro gebe es keine Pläne für Etaterhöhungen der Volksbühne, weil über den Haushalt 2017/2018 noch gar nicht verhandelt worden sei. Den politischen Willen, Chris Dercon finanziell besser auszustatten und die ihm offerierten neuen Spielstätten - das Kino Babylon und den Hangar 5 auf dem Flughafen Tempelhof sowie die digitale Plattform "Terminal Plus" - auskömmlich zu finanzieren, kann man allerdings voraussetzen. Dass diese Expansionen in den konkreten wie virtuellen Raum nicht zum Nulltarif zu haben sein werden, versteht sich von selbst. Welche Einsparungen ziehen sie an anderer Stelle nach sich? fragt sich da so mancher.
Die Gerüchte kochten erst recht hoch, seit sich am 20. Juni 180 Mitarbeiter aus allen Gewerken in einem offenen Brief an die Parteien im Abgeordnetenhaus von Berlin und Kultur-Staatsministerin Monika Grütters gewandt haben (F.A.Z. vom 22. Juni). Darin wehren sie sich nicht gegen mögliche Neuerungen, sondern gegen strukturelle Änderungen. Sie fürchten nach Gesprächen mit Dercon und Piekenbrock, dass ihr Theater zum reinen internationalen Gastspielbetrieb umfunktioniert wird, dass sie als Dienstleister eingestuft werden sollen und nicht mehr als künstlerische Mitarbeiter gelten, dass die Volksbühne insgesamt ihre gesellschaftliche Relevanz verlieren könnte. Und natürlich fürchten sie um ihre Arbeitsplätze, wenn aus dem Repertoirebetrieb mit seinem täglichen Auf- und nächtlichen Abbau von Bühnenbildern für das jeweilige Stück ein En-Suite-Betrieb werden soll, also Inszenierungen ein, zwei Wochen durchlaufen.
Aus der Senatskanzlei heißt es dagegen, nein, all das sei völlig unbegründet, der Offene Brief enthalte "viele Vermutungen, aber wenig Fakten". Denn keineswegs werde bei Dercons Amtsantritt jeder zweite Arbeitsplatz nicht verlängert, es würden nur etwa 20 bis 25 Stellen wegfallen. Auch sei es definitiv falsch, dass, wie seit geraumer Weile aus dem Umfeld der Volksbühne kolportiert wird, Englisch die neue Arbeits- und Verkehrssprache sein würde. Interessant ist in diesem Zusammenhang indes die Frage, warum dies trotzdem halb Berlin glaubt oder für möglich hält - und offenbar die ganze Volksbühne. Das Vertrauen ist offenbar schon jetzt dahin und wird sich in einem sensiblen Organismus wie einem Theater nicht im Handumdrehen wiederherstellen lassen.
"Dercon muss sich jetzt schnellstens bekennen und offenlegen, was für einen Typ Theater er entwickeln will", rät Christina Weiss, von 2002 bis 2005 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und als solche erfahren im Umgang mit komplexen Institutionen und politischen Handlungsweisen: "Dann würden auch die Gerüchte abgemildert und im Haus könnte wieder eine andere Atmosphäre entstehen. Was für ein Theater mit welchen Künstlern will er anregen, wie das Ensemble halten und pflegen, wie Brücken zwischen alten und neuen Mitarbeitern bauen - das sind doch Grundsatzfragen, die eigentlich in einer Betriebsversammlung geklärt werden sollten. Obwohl man Hemmungen hat, bei der Volksbühne von Betriebsversammlung zu sprechen, weil da ja alle zusammen ein künstlerisches Kollektiv bilden." Sie ist für Transparenz und eine nach allen Richtungen offene Kommunikation. Man müsse nicht nur miteinander reden, sondern einander vor allem auch zuhören.
"Bleiben wir ein Sprechtheater?", soll Chris Dercon laut der "Welt" bei einer Vollversammlung Ende April gefragt worden sein, und geantwortet haben, sprechen könne er selbst. Das ist wohl nicht die Kommunikation, die Christina Weiss meint, und nicht die "Neugierde aufeinander", die sich Ulrich Khuon wünscht. In einem Interview äußerte sich dazu zuletzt auch Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele. "Ich werde nicht auf Dercon herumhacken", sagte er, warnte gleichzeitig jedoch vor einem "Systemwechsel" an der Volksbühne und mahnte zum behutsamen Umgang mit diesem "bedeutendsten Sprechtheater der Welt". Claus Peymann wiederum forderte Bürgermeister Müller auf, seinen Fehler bei der Besetzung des Intendantenstuhls einzuräumen und Dercon einfach auszuzahlen - das wäre immer noch billiger als all die angekündigten "unsinnigen Pläne" für den nächsten kommerziellen "Event-Schuppen" samt Folgekosten.
Die wären im Schiller-Theater vermutlich geringer, das derzeit von der Staatsoper bespielt wird, bis sie im Sommer 2017 zurück in ihr dann restauriertes Stammhaus Unter den Linden kehrt. Planungen für die weitere Nutzung liegen derzeit nicht vor, da die Komische Oper, die das Haus ursprünglich während Renovierungsarbeiten zu ihrem Ausweichquartier machen sollte, dies nun doch nicht tun wird. Im Zuge der aktuellen städtebaulichen Neustrukturierung des Berliner Westens sieht der eine oder andere da schon Dercon einen Plan B realisieren und im Schiller-Theater seinen Festivalbetrieb aufziehen, falls er in Sachen Volksbühne das Handtuch wirft. Berlins Gerüchteküche brodelt.
"Jawoll, dit is Berlin", jubelte sich 1994 in der Volksbühne Henry Hübchen durch Frank Castorfs hinreißende Inszenierung von "Pension Schoeller / Die Schlacht". Dazu hieß es damals in dieser Zeitung: "Der Wahnsinn aber geht weiter. Der Schwank ist endlos. Und nur Gelächter hilft." In manchem Theaterstreit liegt die Wahrheit eben auf dem Theaterspielplatz.
IRENE BAZINGER
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.
Vermutlich hat niemand erwartet, daß ein Theaterstreit – einer nur von vielen – zum Kulturkampf avanciert. Und was, das sollte man sich auch gleich fragen, wird die Stei-gerung dessen sein, am Ende noch ein Klassenkampf? Wir wissen es nicht. Aber wir sehen, der Kampf spiegelt eine Krankheit der Epoche. Der Krankheitsverlauf zeigt sich schriftlich an. Zuletzt im Offenen Unterstützer- und Entgegnungsbrief, den Haus-der-Kunst-Direktor Enwezor an Berlins Kulturbürgermeister Müller im Namen weltbekann-ter Museumsleiter, Architekten und anderer schrieb. Wo sich 25 theaterfern global agie-rende Kulturakteure (cultural actors), deren Namen programmatisch für Kulturgestal-tung und -Überlieferung einstehen, für einen der ihren in die Bresche werfen, agiert auf der Gegenseite ein über 100 Jahre altes Stadttheater mit seiner Belegschaft. Man muß nicht den bekannten Terminus vom „Panzerkreuzer vor dem Alexanderplatz“ bemühen, um den militanten Gehalt dieser Auseinandersetzung zu verdeutlichen. Der Ton der Briefe tuts. Kritik und Kommentar, Politik und Publikum schaukeln sich in der Reso-nanz wechselseitig hoch.
Auffällig und bereits zahlreich kommentiert ist die inhaltliche Lücke im System. Es geht bislang, soweit es Dercons Seite angeht, kaum um Konkretes. Das mal als „volksbühne berlin“, mal als „volksbühne plus“ betitelte Programm ist den Begriff nicht wert. Zu reden ist bestenfalls von einem theoretisch verbrämten Überbau, von einer Handvoll Namen unterfüttert. Wobei die Zahl der bislang in Rede stehenden Künstler der Zahl der kommenden Spielstätten entspricht, es sind fünf. Chris Dercons und Marietta Piekenbrocks im April 2015 über die Webseite der Senatskanzlei verbreitetes Konzept ist so allgemein wie unklar und wohlfeil. Wo Formulierungen wie „Bauhausbühne“, „programmatische Achse“, „Strategieräume“, unter der Überschrift „kollaboration als modell“ großgeschrieben werden, wird außer „global verbreiteten Verkaufsfloskeln“, wie die Süddeutsche Zeitung meint, wenig konkretes benannt noch belegt.
Daß das „Ende der Ära Castorf mit einem Epochenwechsel“ zusammenfalle, „der die darstellenden Künste mit neuen globalen Themen konfrontiert und in digitale Medien expandieren läßt“, bezeichnet einerseits einen Akt der politischen Willkür, ist anderer-seits alles andere als neu. Gerade die Volksbühne hat unter Frank Castorfs Intendanz die neuen globalen Themen aufgegriffen und sich ihnen mit der Entwicklung neuer Formen gestellt, unter anderem auch digital. „Globalisierung und Medialisierung stellen Theaterhäuser und Museen vor Herausforderungen, die ihre traditionellen Aufgaben übersteigen. Als Orte der Präsentation und der Selbstvergewisserung haben sie viel institutionelles Wissen aufgebaut und müssen nun erleben, dass Strukturen und Erfahrungen das innere Betriebssystem belasten können, wenn es darum geht, auf kulturelle, ökonomische und demographische Veränderungen dynamisch zu reagieren. Dieser Transformationsbedarf wird in Berlin besonders intensiv diskutiert. Mit der Gründung des Humbold(!)forums und der Neuausrichtung der Volksbühne werden von der Hauptstadt modellhafte Orientierungen und Impulse erwartet.“ Mit den zitierten Sätzen bewirbt Marietta Piekenbrock ihr Projektseminar „berlin-college / laboratorium für gegenwart / sommersemster 2016“.
Mag sein, daß die Strukturen der Volksbühne die Subventions- und Kulturpolitik der Stadt Berlin belasten. Dagegen hat sich das Betriebssystem der Volksbühne den von Piekenbrock aufgefahrenen Herausforderungen als gewappnet und effizient erwiesen. Fröhlich, melancholisch, grausam, selbstzerfressen, langatmig, kurzweilig, sinnlos, tief-schürfend und vor allem weltweit. Dieses Betriebs- oder Antriebssystem ist die Voraus-setzung der erfolg- und einflußreichsten Theatergeschichte unserer Zeit. Es paart Wir-kung mit Erfolg und hat eine kaum überschaubare Deutungsebene im Kielwasser er-zeugt, die der Kritik genügend Arbeit bringt und ihren Adepten erst recht. Um einen von Richard Sennett (auch er Unterzeichner des pro-Dercon-Briefs) geprägten Terminus zu gebrauchen: die Strukturen der Volksbühne ändern sich im Rahmen einer „flexiblen Spezialisierung“. Sie reagieren auf Notwendigkeiten einer globalisierten Kulturwirt-schaft, indem sie nach wie vor einen großen künstlerischen Freiraum in der Produktion ermöglichen. Die in diesem Freiraum arbeitenden Künstler und ihre Arbeiten, die am Rosa-Luxemburg-Platz entstehen sind bekannt.
Ein für das Theater wesentliches Thema ist der unter den Prämissen des Neoliberalismus global vereinheitlichte Kunst- und Kulturmarkt. Es geht um diesen Platz am Markt. Daß er bislang, ohne Profit abwerfen zu müssen und von Steuergeldern subventioniert, so erfolgreich am Rosa-Luxemburg-Platz behauptet werden konnte, ist ein Glücksfall für die Kunst, für die Politik mithin.
Der Glücksfall hat mit Geschichte zu tun. Der sozialdemokratische Hintergrund, aus dem die Volksbühnenbewegung erwuchs, die 1914 zum Bau des Theaters am damaligen Bülowplatz auf dem zum großen Teil planierten Einzelhandel des Scheunenviertels führte, die Geschichte dieses umkämpften Areals, sind wesentlich mit der Wirkungs-macht der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz verbunden. Die Geschichte, ihre Er-eignisse und ihr Theater sind konkret. Sie sind Berlin-spezifisch. Und sie wirken, um den abgenutzten Terminus noch einmal aufzugreifen, global. Kein deutsches Theater, möglicherweise kein Theater weltweit, wirkt derart tiefgreifend. Das betrifft die ästheti-schen Innovationen so sehr wie den Einfluß auf die Sehgewohnheiten des lokalen und internationalen Publikums. Was um so bedeutender ist, da es der ostdeutsche Intendant Castorf war, der wie kein anderer in entgegengesetzten politischen Systemen sozialisier-te Künstler unterm damals (1992) schwer renovierungsbedürftigen Dach der Volksbüh-ne zusammenführte. Lilienthal, Marthaler, Kresnik und Schlingensief allen anderen voran. Daß jetzt ausgerechnet eine sozialdemokratisch gelenkte Kulturpolitik dieses Berliner Spezifikum allen Eigenheiten beraubt, kann nur als historischer Treppenwitz verstanden werden. Sie beansprucht seit April 2015 eine „Weiterentwicklung der Volksbühne“ und kann weder Notwendigkeit noch Formen noch Inhalte dieser Weiter-entwicklung bieten. Naheliegend die Vermutung, daß die Volksbühne in ihrer jetzigen Gestalt der jetzigen Politik ein Dorn im Auge bzw. ein Reißzahn im Arsch ist, um einen weiteren Offenen-Brief-Autor zu zitieren.
Um von Biographien zu reden: Was mich persönlich angeht, ist die geplante Umfor-mung der Volksbühne ein Eingriff in meine Biographie. Zu der dieses Theater, das seit seiner Gründung durch die Volksbühnenbewegung mehr als nur ein Theater ist, gehört. Ich war 14, als ich Jürgen Goschs „Leonce und Lena“ sah, die mehr als alles, was ich zuvor und lange danach sehen konnte, das Lebensumfeld des Totalitarismus, aus dem ich kam, zur Disposition stellte: absurd, tragikomisch, dadaesk. Formal extrem, wütend, wild. Erschreckend. Eine Einladung zur offenen Austragung von Konflikten. Daß Kunst eine Waffe sein kann verstand ich zum erstenmal anders, subversiv. Seitdem begleitet mich und begleite ich dieses Theater. Über lange Strecken von außen, seit einigen Jahren von innen. Während der restlichen Jahre der DDR war die Volksbühne Instanz einer alternativen Republik, danach eine Insel der Utopie, die Freiräume der Kunst ermöglicht hat, die – und kleiner läßt es sich für mich nicht sagen – das Leben lebenswert machen.
Der Freiraum, in dem vor einem Prisma historischer Gegebenheiten die Gegenwart ver-handelt wird, ist bedroht, wenn zugunsten eines Kompensationsgeschäfts der Standort Volksbühne mit seinen unverwechselbaren Entwicklungsmöglichkeiten vernachlässigt wird. Die Auslieferung der Volksbühne an einen weltweit zirkulierenden Gastspielbe-trieb, der am Rosa-Luxemburg-Platz lediglich Station macht, nach dem Prinzip „Ein-kaufen–Präsentieren-Weiterverkaufen“ wäre ein solches Kompensationsgeschäft. Der spezifische Standort würde seine Eigenheiten verlieren, übrig bliebe lediglich die Hülle, die dann bestenfalls den Marktwert einer historisch aufgeladenen Location mit Retro-chic hätte.
Die Metamorphosen der Volksbühne die mehr als an anderen Theater von innen heraus gestaltet wurden – ungeheure Entwicklungen, ungeahnte Krisen, nie erwartete Erfolge, nicht abzusehende Konflikte, Zusammenbrüche, Wiederauferstehungen, das Scheitern, die Chancen, die Scheidungen, die alten und die neuen Allianzen – all das, was Namen von Künstlern, Titel von Stücken und Aufführungen trägt, ist mit diesem Ort und seiner Historiographie verbunden. Ich brauche das Wort Tradition nicht gern, doch hier habe ich es neu verstanden. Das Tradierte besteht nur fort, indem es sich erneuert, heißt, in-dem man es sich unablässig erkämpft.
Sollte es auch eine materialistische Binsenweisheit sein, hier muß sie mit Walter Ben-jamin ins Feld geführt werden: „Vergangenes historisch artikulieren heißt …, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern.“
Daß es ein ideologischer Feldzug ist, sieht man mit Abstand vielleicht besser. Es müssen nicht immer Heuschrecken sein. Man muß nicht, nein bloß nicht, Vergleiche aus dem Tierreich bemühen, aber natürlich, sie drängen sich auf. Ein Rudel vergoldeter Karpfen, das sich um ein letztes Frischwasserspundloch drängt. Im Fall des Stadttheaters am Rosa-Luxemburg-Platz, das eine letzte nicht gentrifizierte Lokalität inmitten einer gentrifizierten Gegenwart ist, ein treffendes Bild. Ein Bild, mit dem ein Freund, der, nachdem er einige Aufführungen an der Volksbühne gesehen hatte, zurück in Los Angeles, den hiesigen Kulturkampf kommentiert. Daß die Briefform in diesem Kampf zu Ehren kommt, kann als Gruß an die Epoche der Briefschreiber gelten, in der das Stadttheater sich zu dem entwickelte, was es auszeichnet: eine Gegenrepublik zu sein.
Und ja, natürlich auch: Es geht um Macht! Der moralisierende, von weit her und von oben klingende Ton der „besorgten Kulturakteure“ erinnert zunächst an das bekannte Zitat, das vom vor Jahrzehnten auch an der Volksbühne wirkenden Brecht kommt. Mo-ral, ja, aber Fressen geht vor. Für die Globalen: „First comes food, then comes the morals.“ So gesehen sind die Unterstellungen, die von „Rechtsmißbrauch“ und „Miß-brauch des Privilegs öffentlich Angestellter“, um eine „persönliche Vision zu vernich-ten“, bis hin zum Vorwurf des „engstirnigen und selbstsüchtigen Putschversuchs“ nur verständliche Gegenschläge, wo es um nicht weniger als um alles geht.
Die in sich verdrehte Komik der Behauptung eines Putschversuchs gegen eine noch längst nicht installierte Macht, die Gleichsetzung einer „association with museums“ mit „Konsenskultur“, wird nicht von den Mitarbeitern der Volksbühne sondern von Dercons Unterstützern erzeugt. Der hochmütige Ton, in dem jenes „Ich mach dich weltberühmt!“ anklingt, wenn darauf hingewiesen wird, daß der Museumsmann Dercon die Reputation der Volksbühne stärken und verbessern würde, erschwert den Dialog zusätzlich. Daß die Bildende Kunst, die Begriffe Museum und Archiv an eben diesem Theater durchaus willkommen sind und Neuartiges und Umstrittenes hervorbringen, zeigten die Arbeiten von Jonathan Meese, Hannah Hurtzig, Richard Wright, Gregor Schneider und Paul McCarthy. Zeigten auch die die Grenzen von Performance, Schauspiel und Bildender Kunst übereinanderschichtenden Arbeiten von Vegard Vinge, Ida Müller, Ragnar Kjartansson und Markus Öhrn.
Ein Theater, das sich als Gesellschaftsmodell unter allem gesellschaftlichen Druck als flexibel, widerständig und progressiv verhalten konnte, muß, wenn es überleben will, die Chance zur inneren Verjüngung zu nutzen. Die Volksbühne, als Theater wie als Markenzeichen, hat gezeigt und zeigt, daß es sie nutzen kann. Die Chance ist ein Prin-zip. Brecht hat dieses Prinzip als „Episches Theater“ benannt und beschrieben. Eine offene Produktionsweise, die den historischen Moment, die Biographien und die Prob-leme eines Probenprozesses in die Darstellung einbezieht. Frank Castorfs und René Polleschs Arbeiten haben dieses Prinzip im Sinn der Wahrhaftigkeit weiterentwickelt. Der Schauspieler auf der Bühne tritt als Existenz in Erscheinung, der Zeitraum der Auf-führung ist zugleich künstlich wie existentiell. Daß es nicht ausschließlich an der Volksbühne entwickelt werden kann, zeigen die zahlreichen Gastinszenierungen an so gut wie allen großen Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Dennoch ist der Ursprungsort in Gefahr. Insofern ist die Politik gut beraten, die Volksbühne an jene zu überstellen, die sich befähigt und berufen fühlen, dieses Theater aus seiner Geschich-te heraus und mit seiner Geschichte weiterzuentwickeln. Wer immer das sein wird, ***
Die politischen, ideologischen, finanziellen, strukturellen Zwänge, Freundschaft, Haß, Intrigen, sich ändernde Arbeitsprozesse und Allianzen, stellen im Kontext seiner Kunst-produktion ein einmaliges Versuchsfeld dar. Das dialektische Verhältnis von künstlerischer Stabilität (die Krisen bekanntlich nicht ausschließt) zum Älterwerden und zur Kraft der Verjüngung ist hier erprobt worden und sollte weiter geprobt werden kön-nen. Das über Generationen weiterzuentwickeln, wäre die Herausforderung der man sich stellen sollte. Dem Volksbühnenorganismus sollte sein Standort dafür belassen werden. Für Dercons Modellbühne plus oder wie sie sonst noch heißen wird, wäre ein bereits neutralisierter Ort wie das ehemalige Schillertheater oder sonst ein entkernter Großbetrieb der angemessenere. Ein funktionierendes Stadttheater ohne Not in einen zum Großteil auf Gastspiele spezialisierten Durchgangsbetrieb umzuwidmen, führt zur anhaltenden Ausdünnung der Stadttheaterlandschaft nicht nur Berlins. Ist die subventi-onierte Produktionsstätte Volksbühne tot, wird sie kein Haushalt dieser Stadt je wieder mit wieviel Millionen auch immer zurück ins Leben befördern. Diese Zäsur wird die endgültige sein.
Am Ende ist die Politik gefordert – doch wer will angesichts einer überforderten Personage von dort Hilfe erwarten? So bleibt der Vorwurf, bleibt die Forderung nach Revision einer Fehlentscheidung. Sie richten sich an eine blinde, fehlgeleitete oder gar nicht agierende Berliner Stadt- und Kulturpolitik, die nicht nur an der Abschaffung ihrer eigenen Deutungshoheit, die weit folgenschwerer an der Abschaffung Berlins als spezi-fischer Kulturstadt, als Hauptstadt, ja als Stadt überhaupt, arbeitet. Eine Weltstadt als Vorgarten eines Rings globaler Superstädte, wie sie der hiesigen Politik vorzuschweben scheint, ist der sicherste Weg, Berlin, das nach der Abwicklung seiner Industriestandor-te wenig mehr als seine Kultur und Geschichte besitzt, in die Bedeutungslosigkeit zu führen. Es sollte nicht wie große Landstriche auf dem Territorium der ehemaligen bei-den deutschen Staaten zu Freilichtmuseen zurechtgestutzt werden. Dasselbe gilt für die Theaterlandschaft, die im deutschen Osten vielerorts zu sogenannten Theaterkonglome-raten zusammengeschrumpft wurde, letztes Beispiel Rostock, nächstes Beispiel, wer weiß. Tatsache ist, daß 25 Kunstarbeiter die Volksbühne verlassen müssen, damit – vielleicht – 25 neue kommen. Eine Garantie, daß die restlichen 200 bleiben, gibt es nicht.
Ja, es geht um Macht, um Geld, um Arbeit, um die Kunst und wo und wie man sie aus-übt. Es geht um die Macht.
Thomas Martin
Quelle: Berliner Gazette, 16.7. 2016
Nichts muss bleiben wie es ist – so oder anders formuliert gehörte das Motto schon immer zur raison d'être der Berliner Volksbühne. Daher mag es verwundern, dass sich nach einem Vierteljahrhundert Castorf-Intendanz die Mitarbeiter und Freunde des Hauses vehement gegen die Ernennung eines neuen Leiters wenden. Es wäre eine Neuauflage des ewigen Konflikts zwischen Nostalgikern und Traditionalisten auf der einen Seite, Visionären und Erneuerern auf der anderen. Dieser banalen Interpretation kann mit einigen Einwänden entgegnet werden.
Erfahrungsgemäß gibt es gute Gründe, einer solchen Einschüchterungsrhetorik gegenüber misstrauisch zu sein. Ist Veränderung per se begrüßenswert - Hartz-IV, BER-Geisterflughafen, Pokemon Go? Offenkundig ist die Tradition der Volksbühne eine des ungewissen Ausgangs, des permanenten Regelbruchs und der Unangepasstheit. Die Befürchtung ist also legitim, der angekündigte Wandel könne das genaue Gegenteil davon hervorbringen. Sicherlich sind das vorerst Mutmaßungen. Bisweilen wurden von Mr. Dercon nur lauter Worthülsen durch die Gegend geschleudert. Konkrete Pläne liegen noch nicht vor, daher, so Kulturstaatssekretär Renner, sei es „schofelig“, sie vorzuverurteilen. Nur: Nicht weil ein Konzept leer ist, kann man es füllen.
Von offizieller Seite wird vor „alarmistischen“ Gerüchten gewarnt: Niemand habe die Absicht, ein Theater abzuwickeln. Dennoch lassen einige Aussagen aufhorchen. Der künftige Intendant eines der berühmtesten Sprechtheaters der Welt scheint nämlich gegen das gesprochene Wort eine bedenkliche Abneigung zu haben. Zumindest dieses Mantra wiederholt er konsequent: Es gebe immer mehr Neuberliner, die kein Deutsch sprechen. Gemeint sind natürlich nicht die geflüchteten Syrer und Afghanen, die tunlichst Deutsch lernen müssen, um überleben zu können, sondern die global class der jungen Innovatoren und Kreativen, die sich in ihrem Alltag leisten können, die Landessprache souverän zu ignorieren. Statistisch gesehen mag diese Schicht eine unbedeutende Minderheit darstellen, konsumtechnisch ist sie immerhin die wichtigste Zielgruppe. Allmählich setzt sich die Praxis überall durch. Die jüngste „Manifesto“-Ausstellung im Hamburger Bahnhof war for english speakers only, selbst die Texte von Bruno Taut oder Kurt Schwitters hätte man dort in Originalsprache vergeblich gesucht. Je mehr die Kultureinrichtungen der Stadt auf maximale Besucherzahlen angewiesen sind, desto mehr müssen sie sich der (angenommenen) Bedürfnisse ausländischer Besucher anpassen. Von denen wird man wohl nicht erwarten, dass sie René Polleschs akrobatische Wortkaskaden oder Frank Castorfs extravagante Textkollisionen goutieren können. Also müsse sich das Theater umstellen, sei es, indem es nicht-verbale Formen der performing arts (vor allem Tanz) privilegiert, oder Symposien auf Küchenenglisch veranstaltet, oder gar „neue Formen der Sprache, die für mehr Menschen verständlich sind“ (Dercon) entwickelt. Schließlich wurde bereits Shakespeare in SMS-Sprache übersetzt. Den internationalen Gästen zuliebe soll vom Sprechtheater ein Sound übrig bleiben, etwa die eindrucksvolle Stimme von Sophie Rois, ganz gleich, ob sie Müllers Bildbeschreibung oder das Berliner Branchenbuch rezitiert.
Aus Sicht des Stadtmarketings gibt es nur zwei Gruppen von Kulturkonsumenten: economy class und business class. Einerseits Riesentouristenschlangen, die sich einbilden, etwas von Berlin mitzunehmen, obschon sie dasselbe genauso gut in Barcelona bekommen hätten, mit schönerem Wetter obendrein. Andererseits den Kern der gut ausgebildeten, mobilen, dynamischen und wohl betuchten Residenten, die oft selbst Symbolproduzenten sind und mit ihren Mitkreaturen in anderen Metropolen in engerem Kontakt sind, als mit den Reststadtbewohnern. Zweifellos ist da die Volksbühne ein Anachronismus. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist der Brief, den namhafte Vertreter des Kunstestablishments (darunter kein Theatermensch) an den Berliner Bürgermeister zur Unterstützung ihresgleichen adressiert haben, standesgemäß auf Englisch verfasst. Die Proteste von Belegschaft und Publikum werden als „Putschversuch“ abgetan, gut neoliberal wird der „Missbrauch eines Privilegs“ moniert, „das sich einer öffentlichen Einstellung verdankt“; vor allem wird ausdrücklich betont, dass es mit der Neubesetzung der Intendanz ums Ganze geht: das „weltweite Ansehen Berlins“, den „globalen Überblick“ und den „Anspruch, eine offene, kosmopolitische Stadt“ zu werden.
Um eine persönliche Note einzuwerfen: Ich fühle mich damit doppelt angegriffen, als Berliner und als Ausländer. Ich wohne hier genau so lange, wie Frank Castorf Intendant ist. In der Zwischenzeit sind beinah alle Merkmale verschwunden, die aus dieser Stadt eine unvergleichbare Stadt ausmachten. Noch ist die Volksbühne da. Wie der Journalist Jan Küveler treffend bemerkt: Sie „repräsentiert genau den Sehnsuchtsort, für den die ganze Welt nach Berlin zieht, den es aber nicht mehr so richtig gibt, außer hier.“ Angefangen mit der verlebten, verrauchten Kantine, von der genau gesehen die Bühne bloß eine Extension ist (und ich möchte mir nicht ausmalen, welche weißgestrichene, gefriertrocknete Lounge an ihrer Stelle eingerichtet wird). Nichts gegen das HAU oder das HKW, nur könnten solche Institutionen problemlos nach München oder Hamburg transplantiert werden. Die Volksbühne nicht. Wenn ich von Kosmopolitismus höre, fühle ich mich als korsischer Berlinfranzose angesprochen. Nur: Nach meinem Verständnis ergötzt sich der Kosmopolit an der Vielfalt der Kulturformen, die ihm begegnen. Er weiß, dass Sprache nicht bloß Grammatik und Wortschatz ist, sondern Wahrnehmungsweise. Schätzt das deutschsprachige Theater samt Geschrei und Exzessen nicht obwohl, sondern weil „typisch deutsch“. Möchte also keine austauschbaren, extra für ihn geschusterten Produkte serviert bekommen.
Ungeklärt bleibt außerdem, weshalb ein Museumsmann das Haus leiten soll. Wenn eine Konditorei von einem Meisterfleischer übernommen wird, der zudem kein Hehl daraus macht, sich mit Backkunst nicht auszukennen, dürfen sich doch die Kunden um den künftigen Geschmack der Torten Sorgen machen. Wir hören nur die aufgewärmten Floskeln: Innovation, Vision, Crossover und vor allem: Verflüssigung. Es muss alles ineinander fließen: innere und äußere Räume, Ökonomie und Kunst, Alltag und Kultur. Passender als „Verflüssigung“ wäre vielleicht hier doch das sinnverwandte Wort „Liquidierung“ mit seinen Nebentönen von Abwicklung, Finanzialisierung und Mord. Mittlerweile haben wir doch gelernt, die Metaphorik der Herrschaft zu entziffern. Fließen, das tun hauptsächlich die Kapitalströme. Abgebaut gehören die konventionellen Schranken, die noch eine Marktüberschwemmung eindämmen. „Kein Theater ist eine Insel“ bedeutet im Klartext: Leisten Sie keinen Widerstand!
Bemerkenswert ist allerdings der Totenschein, den Mr. Dercon jener Sphäre verpasst, die er gerade verlassen hat. In der bildenden Kunst sei nichts mehr los, alles sei vom Markt aufgefressen worden, verblichen, durchökonomisiert, standardisiert. Künstler produzierten nur noch „Ikea-Arbeiten“. Darum kehrt der enttäuschte Held der Tote Modern den Rücken und begibt sich dorthin, wo noch Leben pulsiert. Von der maßgeblichen Rolle, die seine Peer-Group, die Obristenjunta, in der besagten Durchökonomisierung spielte, sagt er nichts. Stattdessen behauptet er: „Nicht die bildende Kunst soll das Theater retten, sondern umgekehrt das Theater die Kunst.“ Das klingt recht bedrohlich. Wie man weiß, haben Kunstbetrieb und Kapital mindestens Eines gemeinsam: Vampirisch sind sie ständig auf neue, äußere Quellen der Wertschöpfung angewiesen. Bislang wurde das Stadttheater von der Ausweitung der Marktzone weitgehend verschont. Daher die Befürchtung aller Intendanten der Republik, die jetzige Umstellung sei nur das Vorspiel eines Systemwechsels. Undiplomatischer als sein Freund Dercon wettert Ai Weiwei, der wie kein Zweiter Kunstgeschäft, Neukosmopolitismus und Immobilienspekulation vereint, gegen das "linke Establishment“ um die Volksbühne: "Was ist das Problem mit Kommerz? Alles ist Kommerz. Ohne Kommerz würden wir noch im Erdloch leben."
Sehr viel Wasser ist die Spree hinabgeflossen, seitdem die Berliner Arbeiter begannen, ihre Spargroschen zu spenden, um sich eigene, gute und bezahlbare Veranstaltungen zu verschaffen. So war die Volksbühnenbewegung entstanden. Dezidiert Anti-Kommerz. Im Gründungsaufruf hieß es: „Der Geschmack der Masse ist in allen Gesellschaftsklassen vorwiegend durch gewisse wirtschaftliche Zustände korrumpiert worden.“ Freilich kam schon immer der Vorwurf, eigentlich diene die Volksbühne dazu, die Ausgeschlossenen in die bürgerliche Gesellschaft zu integrieren anstatt diese zu bekämpfen. Nein, nie war das Haus ein Bollwerk des Widerstands und der Reinheit. Erst recht nicht unter Castorf. Immer rieben sich Wut und Zynismus mit dem gewollten Effekt, Widersprüchlichkeiten und Zerwürfnisse wahrnehmbar zu machen. Nicht erst seit gestern wird über die staatssubventionierten Anarchisten am Rosa-Luxemburg-Platz gespottet. Jetzt wird damit aber angedeutet: Genug in die Suppe gespuckt! Die Zeichen stehen auf reibungsloses, integriertes Reinheitsmanagement. Währenddessen schreitet in der konkreten Stadt die soziale Desintegration fort. Ein Fünftel leben unter der Armutsgrenze, immer mehr werden aus ihren Wohnungen vertrieben, zunehmend leben globale Elite und Abgehängte in Parallelwelten. Wie wir lesen, werden Leiter gebraucht, die „auf der Höhe unserer Zeit“ sind. Besser wär's, sie bewegten sich in die Tiefe unserer Zeit, um dort die wachsenden Risse und Abgründe zu erkunden. Vielleicht wäre es opportun, die Volksbühnenbewegung neu zu gründen.
Guillaume Paoli
Quelle: Texte zur Kunst, 27.9. 2016